Wo immer Angela Merkel im Wahlkampf auftaucht, stören Pfiffe und Rufe ihre Auftritte. Mitglieder der AfD und anderer rechter Gruppierungen orchestrieren diese Demonstrationen. Sie stellen Wahlkampf in eigener Sache dar, denn der Protest verspricht Aufmerksamkeit. Mit der AfD wird wohl erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik eine Partei rechts von CDU und CSU in den Bundestag einziehen. Doch was wissen wir wirklich über die Ursachen und Motive des Protestes? Was wissen wir über die Ursachen der Ohnmacht und den Grund für den Hass auf Einwanderer und Flüchtlinge? Während am einen Extrem alarmierte Intellektuelle einen Rückfall in die Barbarei des Faschismus befürchten und die Ursache für den Rechtsruck im Aufwallen „rechtsextremer Einstell
Der Trost des Nationalismus
Wahlkampf Warum protestieren die Menschen gegen Flüchtlinge und nicht gegen kapitalistische Ausbeutung? Über Mobilisierungserfolge, die nicht irrational sind
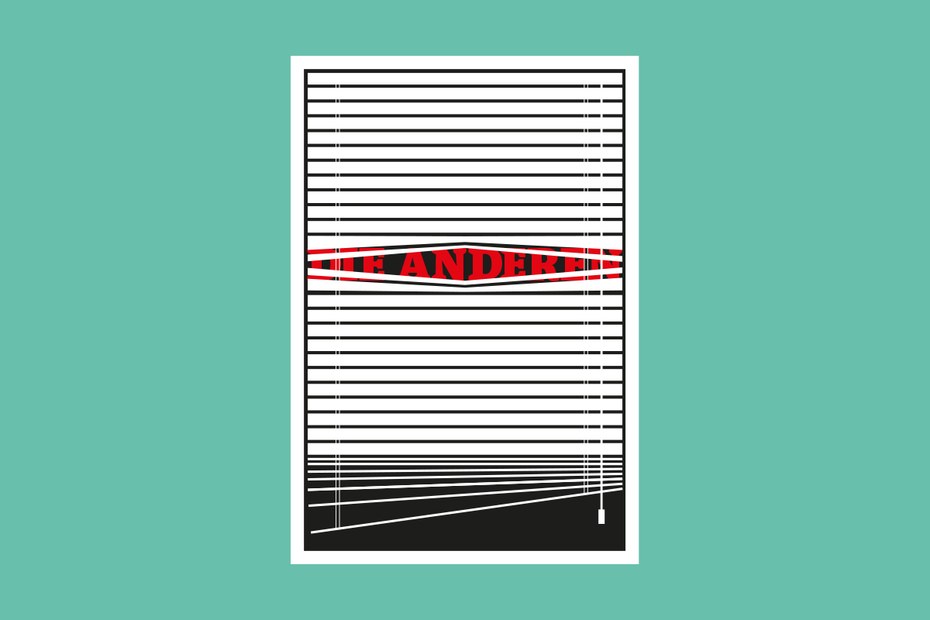
Illustration: Jonas Hasselmann für der Freitag
ellungen“ und autoritärer Persönlichkeitsstrukturen vermuten, deuten andere wie die US-Philosophin Nancy Fraser den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien als Zeichen eines baldigen Endes der Vorherrschaft des Neoliberalismus. Die Irritation bleibt: Warum schließen sich die Protestler nicht lieber gleich den linken Parteien an? Warum protestieren sie gegen Einwanderung, Asylunterkünfte und Islam anstatt gegen kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse?Herablassung der MedienDie alte BRD und später auch das vereinigte Deutschland schienen aufgrund jahrzehntelanger wirtschaftlicher Prosperität, aber auch infolge der intensiven Auseinandersetzung mit dem NS-Erbe und dessen Aufarbeitung lange gefeit gegen ernstzunehmende Erfolge rechtspopulistischer Parteien. Der Erfolg der AfD war auch deshalb für viele eine Überraschung, weil die rechtspopulistischen Strömungen und Parteien in anderen europäischen Ländern zunächst als vorübergehende Erscheinung galten, die bald wieder verschwinden würde.Eine solche Sichtweise ist spätestens mit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA im November 2016 nicht mehr plausibel. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist Deutschland daher lediglich ein Nachzügler einer Entwicklung, die in anderen westlichen Ländern schon weiter fortgeschritten ist. Die Fortsetzung der Eurokrise, bei der die Überschuldung immer weiterer südlicher EU-Länder offenbar wird, und der vermutlich anhaltende Druck von Migrantenströmen nach Europa dürften dazu führen, dass sich die AfD dauerhaft im Parteienspektrum etabliert. Quer durch Europa hat sich seit den 1980er Jahren der durchschnittliche Anteil rechtspopulistischer Parteien an Wählerstimmen in den nationalen Parlamenten von 5,1 auf 13,2 Prozent verdoppelt, ihr Anteil an Sitzen von 3,8 auf 12,8 Prozent verdreifacht.Nachdem der fulminante Aufstieg der AfD und die Wahl Trumps in Medien und Öffentlichkeit zunächst mit Weltuntergangsprognosen quittiert wurden, herrscht in der aktuellen Berichterstattung eher ein mild herablassender Ton. Fast scheint es, als wolle man ganz im Sinne des sprichwörtlichen Pfeifens im Walde die Bedrohung, die von einer aufsteigenden Rechtspartei ausgeht, kleinreden. AfD-Anhänger und Demonstranten werden den Lesern deutscher Feuilletons oftmals wie missmutige Kinder präsentiert, die von irrationalen Ängsten und Ohnmachtsgefühlen geplagt würden, sich ständig benachteiligt fühlten, über wenig Zuversicht verfügten und ihren Unmut laut herausschrien. Damit wird nicht nur geleugnet, für den Erfolg des Populismus in gehörigem Maße mitverantwortlich zu sein, man betreibt hinsichtlich seiner Verortung eine Form der Zuschreibung, die in der Anthropologie von Edward Said als „Othering“ bekannt geworden ist: Man hebt sich selbst und sein soziales Image hervor, indem man rechte und populistische Haltungen als fremd klassifiziert, diese in die Persönlichkeitsausstattung „der Anderen“ projiziert und eine betonte Unterscheidung und Distanzierung von diesen „Anderen“ vornimmt.Will man hingegen verstehen, warum Islam, Asylpolitik und Einwanderung zu Reizthemen und zu den Mobilisierungserfolgen der populistischen Rechtsparteien überall in Europa werden konnten, muss man einen Schritt zurücktreten und dabei die gesellschaftliche Standortgebundenheit auch der eigenen Sichtweise in Rechnung stellen.Ungleichheit der ChancenDass sich die aufgeklärten Leser und die liberalen Deutungseliten nicht von Migranten irritieren lassen, hat zunächst einen simplen Grund: Migranten werden von ihnen zumeist nicht als Konkurrenten um begehrte Güter, um gesellschaftliche Machtpositionen, Arbeitsplätze, Wohnraum, Sozialleistungen oder staatliche Zuwendungen wahrgenommen. Dies zeigt sich vor allem in großen Städten, wo man Asylsuchende in mannigfacher Form unterstützt, allerdings keine sonstigen Berührungspunkte mit ihnen hat. In vielen Stadtteilen Berlins etwa, in Prenzlauer Berg oder Kreuzberg, finden sich zumeist Milieus, die über exklusive Lebensräume und höhere Gehälter sowie über unsichtbare und wirksame Schließungsmechanismen verfügen. Deshalb besitzen gegen Zuwanderer gerichtete Anwandlungen hier keine lebensweltliche Grundlage und stoßen daher meist auf Unverständnis. Migranten kommen in dieser Welt zumeist in der Rolle als „Diener“ vor – das heißt als Wachschützer und Verkäufer, Paketfahrer und Hilfsarbeiter – oder eben in der Rolle hilfsbedürftiger „Flüchtlinge“. In diesen gesellschaftlichen Logenpositionen entgeht einem zumeist auch, dass sich soziale Konflikte seit den 1970er Jahren gravierend verändert haben und heute nicht mehr in die klassische Form von Ungleichheits- und Verteilungskonflikten gekleidet sind.Die Flüchtlingsthematik kommt nicht von ungefähr. An ihr kristallisieren sich die Konturen einer neuen gesellschaftlichen Konfliktordnung heraus. Drehte sich der politische Konflikt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch um die Forderung, den produzierten Reichtum innerhalb des Territoriums der Nation gerechter zu verteilen und die Ungleichheit der Chancen zwischen den sozialen Klassen zu bekämpfen, so resultiert der zu Beginn des 21. Jahrhunderts aufsteigende Konflikt aus der viel grundlegenderen Frage, welche gesellschaftlichen Kollektive im politischen Raum des Nationalstaates überhaupt noch repräsentiert werden sollen und können. Die Brisanz dieser Frage ergibt sich daraus, dass wirtschaftliche Wertschöpfung und Markt-Transaktionen wie auch wohlfahrtsstaatliche Umverteilungstransaktionen durch die Transnationalisierung von Wertschöpfungsketten aus der gesellschaftlichen Klammer des Nationalstaates herausgelöst worden sind. Sie haben die Welt in globale, nationale und lokale Zonen aufgeteilt. Dazu hat einerseits die Etablierung globaler Produktions- und Lieferketten und andererseits die Herausbildung neuer Kommunikationstechnologie beigetragen. Soziale Klassen unterscheiden sich nun in der Frage, in welcher Zone sie ansässig sind, es entstehen neue transnationale Klassen. Dieser Prozess ist allerdings nicht mit Migration gleichzusetzen, da ganz unterschiedliche transnationale Lagen unter dem Dach ein und desselben Nationalstaates beherbergt sind.Das transnationale UntenDie hochqualifizierten Arbeitnehmer der oberen Mitte stellen das transnationale Oben dar. Sie verfügen über transnational einsetzbares kulturelles Kapital, transnational verwertbare Bildung und Qualifikation und sind in dem Maße eher lose mit dem nationalen Wirtschafts- und Gesellschaftsraum verbunden, wie ihre transnationale Verflechtung in den globalen Metropolen zunimmt. Über ihre soziale Lage wird immer weniger allein im eigenen Land entschieden. Eine Unternehmensberaterin in Frankfurt, ein Investmentbanker in London und eine Architektin in Taiwan bewohnen einen gemeinsamen Verkehrs- und Transaktionsraum, selbst wenn sie sich nie persönlich begegnet sind und stets innerhalb ihrer Länder verbleiben. Häufig teilen die transnationalen Experten, die sich vorrangig in den Beratungs-, Finanz- und Kulturindustrien finden, nicht nur eine gemeinsame professionelle Identität, sondern auch einen gemeinsamen kosmopolitischen Lebensstil. Der resultiert aus dem Leben in Metropolen, die in allen Ländern der Welt ähnliche Infrastrukturen und Konsumkulturen aufweisen und somit eine kosmopolitische Heimat darstellen, wie die Soziologin Saskia Sassen herausgefunden hat. Zudem sind die unterschiedlichen Territorien durch das Internet miteinander verbunden. Dadurch werden sich die Lebensbedingungen zukünftig noch stärker international angleichen. Das Zugehörigkeitsgefühl der kosmopolitischen oberen Mittelschicht zur eigenen Nation lockert sich in demselben Maße, wie ihre transnationale Verflechtung innerhalb der Global Cities zunimmt.Auf der anderen Seite entsteht ebenfalls eine Klasse, ein „transnationales Unten“. Hier finden sich Geringverdiener aus unterschiedlichen Weltregionen, gering- und dequalifizierte einheimische Arbeitnehmer und Migranten aus Zweitwelt- und Drittweltstaaten als modernes transnationales Dienstleistungsproletariat wieder. Für die einheimischen Arbeitnehmer entstehen daraus gravierende Nachteile, weil ihre Löhne an die niedrigeren internationalen Maßstäbe angeglichen werden. Für sie existiert die „soziale Rolltreppe“ in die Mittelschicht nun nicht mehr, da sie als Arbeitnehmer innerhalb eines transnationalen Wirtschaftsraums faktisch nicht mehr unter dem Dach ihrer heimischen Volkswirtschaft angesiedelt sind, selbst wenn sie als Staatsbürger über alle politischen Rechte verfügen. Die Herausbildung des transnationalen Unten wird durch zwei komplementäre Prozesse vorangetrieben: durch die Verlagerung von Unternehmen in sogenannte Niedriglohnländer und durch Arbeitsmigranten aus ärmeren Ländern, welche die gleiche Arbeit günstiger anbieten. Die polnische Altenpflegerin, der Wachschützer aus Sri Lanka und die Haushaltshilfe aus Mexiko machen den einheimischen Arbeitnehmern Konkurrenz.Der Fall der MittelschichtenZwischen dem transnationalen Oben aus Eliten und oberer Mittelschicht und dem transnationalen Unten befindet sich eine in den nationalen Wirtschafts- und Wohlfahrtsraum eingebundene Mittelschicht, deren Wohlstandsniveau vorläufig noch weitgehend von innerstaatlichen Institutionen geprägt wird und für die die Staatsangehörigkeit in einem reichen nationalen Wohlfahrtsstaat ein erhebliches Privileg darstellt. Doch dieser Teil der Mittelschicht verliert zunehmend seinen Einfluss auf die Geschicke des Landes. Über Lebenschancen und Ressourcenzuteilungen entscheiden immer weniger klassische Anwälte der Mitte wie Gewerkschaften, Berufsverbände oder Volksparteien, sondern globale Wirtschaftsverflechtungen, transnationale Einrichtungen und Governance-Strukturen. Die hier skizzierten Frontverläufe werden in Medien und Öffentlichkeit durch die weit verbreitete Rede von „der Mittelschicht“ jedoch verdeckt.Der Nationalstaat ist längst nicht mehr der fraglos gegebene Behälter einer durch Volksparteien und Gewerkschaften vertretenen Mittelschicht: Mittelschichtsfraktionen spalten sich entlang ihrer wirtschaftlichen Verflechtungen in regionale, nationale oder transnationale Klassen. Denn auch die Trennlinie zwischen wachsenden Großstadtregionen und stagnierenden oder schrumpfenden peripheren Regionen, in denen soziale Infrastrukturen abgebaut werden und Lebenswelten sich verengen, verändert das Gefüge sozialer Ungleichheiten nachhaltig.Die tiefere politische Logik rechtspopulistischer Parteien besteht in dem Versprechen, die verlorene Symbiose zwischen Mittelschicht (dem Volk) und Nationalstaat wiederherzustellen. Dies geschieht, indem eine neue politische Konfliktlinie gezogen wird: Die zwischen Alteingesessenen und Zuwanderern, zwischen Mehrheitsbevölkerung und Separatisten, zwischen Weltbürgern und den unterschiedlichen „Provinzen“. Während Gewerkschaften die Mitglieder schwinden, verändern populistische Rechtsparteien das Tableau der politischen Auseinandersetzung: Welche Gruppen sollen überhaupt Teil der Gesellschaft sein? Die Privilegien und Schutzwirkungen, die starke, westliche Staaten vergeben können, stehen somit im Zentrum der rechtspopulistischen Mobilisierung. Und dies ist keineswegs irrational, wenn man bedenkt, dass für die meisten Bürger in Schwellen- oder Entwicklungsländern der einzige Weg, zu Wohlstand zu kommen, nicht Bildung, Anstrengung oder Beruf, sondern allein die Migration darstellt. Darüber hinaus ist noch ein anderer Aspekt hervorzuheben: Die AfD wie auch andere Rechtsparteien konstituieren ein tragfähiges politisches Subjekt, wenn sie „das Volk“ adressieren, und heben sich damit vom postdemokratischen, neoliberal-individualistischen Politikmuster anderer Parteien ab. Im Unterschied zu den Linken, denen ihr ureigenes politisches Subjekt, die „Arbeiterklasse“, abhandengekommen ist, errichten sie gegen den Trend zur Vereinzelung und Entsolidarisierung der Gesellschaft eine Gemeinschaft, ein Kollektiv. Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass die Ausgrenzung von Einwanderern in wirtschaftlicher Hinsicht rational ist. Denn in Wahrheit tragen Migranten mehr zur Finanzierung des Sozialstaates bei, als sie an Sozialtransfers und sozialen Diensten beziehen.Kulturelle HomogenitätDas liegt zum Teil daran, dass sie jünger sind als die einheimische Bevölkerung. Viele Menschen machen sich ein einseitiges Bild vom Ausmaß der Einwanderung und den Verhaltensweisen von Migranten, weil sich diese zumeist durch Hautfarbe, Kleidung, Ausdrucksweise und Verhalten von der Mehrheitsbevölkerung abheben. Die Vorstellung vom Einwanderer als „Sozialschmarotzer“ ist zwar falsch, doch darf nicht vergessen werden, dass bei der Gestaltung des Wohlfahrtsstaates in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern von einer ethnisch und kulturell homogenen Bevölkerung ausgegangen wurde. Die kulturelle Homogenität sichert dieser Auffassung nach eine Grundsolidarität unterschiedlicher Bevölkerungssegmente, Vertrauen in die Gerechtigkeit des Wohlfahrtsstaates – Generationengerechtigkeit – und damit die Einhaltung von Normen und den Schutz vor Sozialstaatsbetrug. Mit anderen Worten: Die Gegner von Globalisierung, Asyl und Einwanderung sehen nicht nur ihre angestammten Lebensformen, sondern auch die Funktionstüchtigkeit des Wohlfahrtsstaates bedroht. Eine Bedrohung, die durch die zahlreichen jüngeren Angriffe auf den Sozialstaat – Kürzungen im öffentlichen Gesundheits- und Bildungswesen, steigende Gebühren für öffentliche Dienste, marode Infrastrukturen, immer weitere Anhebung des Rentenalters, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes – bestätigt wird. Diese sind Angriffe auf die Mittelschicht, die der größte Nutznießer der staatlichen Versorgungsleistung ist.Fazit: Die Flüchtlingsthematik ist nicht die Ursache, wohl aber das Symbol für die neue, durch transnationale Ungleichheiten und globale Wohlfahrtskonflikte geprägte Konfliktordnung des 21. Jahrhunderts.Placeholder authorbio-1Placeholder link-1
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.