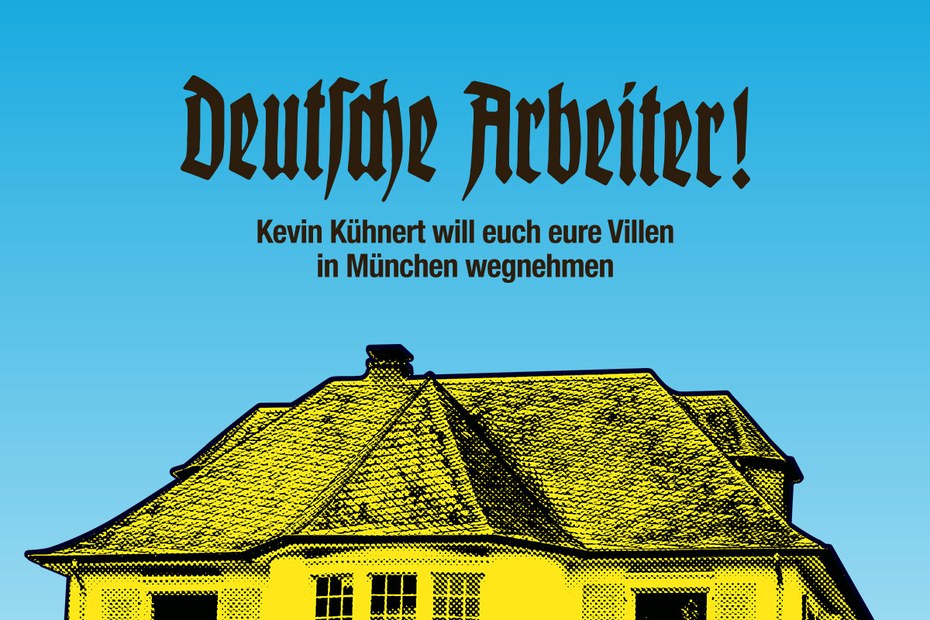Wirtschaftsformen jenseits des Kapitalismus stehen wieder auf der Tagesordnung. Wie sonst ließe sich erklären, dass die in einem Interview mit der Zeit geäußerte Sympathie des SPD-Politikers Kevin Kühnert mit der Kollektivierung bestimmter Unternehmen derart heftige Reaktionen provoziert hat? Von Dummheit und Naivität war da die Rede, die Empörten verkniffen sich auch DDR-Vergleiche nicht.
Empfindlich getroffen fühlen sich all jene, die seit Jahrzehnten vom neoliberalen Regime der Deregulierung und wachsenden Ungleichheit Nutzen ziehen. Linke Parteien und Gewerkschaften sind in die Defensive gedrängt worden – oder haben wie die SPD sogar an der Entwicklung aktiv teilgehabt. Eine Kühnert-SPD sei für die Arbeiter nicht mehr wäh
nicht mehr wählbar, sagte der Betriebsratschef von BMW. Das zeigt, dass auch die Betriebsräte sich teilweise eher dem Co-Management als der Vergesellschaftung von Produktion verschreiben.Doch die große Mehrheit der Bevölkerung sieht in ungleicher Verteilung ein Problem für die Demokratie. Zuletzt erfuhren die Menschen in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/2008, wie die Allgemeinheit für die Rettung von Banken aufkam, ohne dafür je demokratische Mitbestimmung über das Finanzwesen zu erhalten. Angesichts der ökologischen Katastrophe wird zudem gerade von den Jüngeren nicht nur die Verteilungs-, sondern die Systemfrage gestellt: Was muss jetzt getan werden, um den Planeten zu retten? Wir sollten hinzufügen: Wie müssten die Produktion und unser Leben aussehen, damit es sozial gerecht und lebenswert zugeht?Diese Fragen und die Debatte um Wirtschaftsdemokratie beschäftigten die Arbeiterbewegung von Beginn an. Nach der Krise blühten sie in linken Gewerkschaftskreisen wieder auf, doch erst heute öffnet sich ein historisches Fenster, um sie breiter zu diskutieren. Klar ist, dass die Antworten eines demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert andere sein werden als zu Zeiten von Karl Marx. Realpolitik muss im Bestehenden ansetzen und die ökologische Krise vor Augen haben. Klar ist, dass demokratische Strukturen mit der Profitmaximierung brechen müssen und darum so radikal sind wie vor 150 Jahren.Was ist Eigentum?Was ist also jetzt schon möglich? Zunächst: Das Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch offen. Aktuelle Versuche, sie auf die soziale Marktwirtschaft festzuschreiben, sind ein panikartiger Versuch, das Comeback der Wirtschaftsdemokratie zu vereiteln. Zudem ist die Verfassung mit ihrem Sozialstaatsverständnis, der Allgemeinwohlpflichtigkeit des Eigentums und durch die Möglichkeit zur Vergesellschaftung sogar für andere wirtschaftliche Strukturen ausgelegt; sie wurden nur in den vergangenen 40 Jahren für das Gegenteil genutzt.Realistisch müssten wirtschaftsdemokratische Forderungen auf drei Ebenen ansetzen. Zunächst direkt auf betrieblicher: Gewerkschaften kämpfen seit jeher für mehr Mitbestimmung, meist bleibt diese beim wirtschaftlichen Kerngeschäft von Unternehmen aus. Dabei sind Beschäftige Experten. Stehen Betriebe vor der Schließung, sind Genossenschaften Notlösungen. Möglich ist, sie zur Regel zu machen.Die zweite Ebene ist eine sektorale oder auch regionale. Hier zeigt sich vor allem in der Wohnungspolitik, wie viel Bewegung in die Debatte gekommen ist. Städte wie Berlin können den nötigen Wohnraum Konzernen wie „Deutsche Wohnen“ durch Enteignung gegen Entschädigung entziehen.Wer hier an Staatssozialismus denkt, liegt falsch: Schon der Berliner Mietenvolksentscheid 2015 forderte die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts, die eigenständige Benutzer – in diesem Fall Mieterinnen und Mieter – vorsieht. Was als Priorität für die Allgemeinheit bei Sparkassen und öffentlichem Rundfunk gilt, kann auf andere Sektoren übertragen werden.Auch Wirtschafts- und Sozialräte sind denkbar, die über die Produktion regional mitbestimmen können. Das ist nicht von der DDR, sondern aus Schweden abgeschaut. Das „Preston-Modell“, das als Vorläufer für eine Labour-Wirtschaftspolitik im Vereinigten Königreich gilt, deutet darauf hin, wie regionale Struktur- und Industriepolitik aussehen kann. Wie in einem Labor zeigt es, wie Politik fernab des Repräsentationsprinzips möglich wird.Das beinhaltet nicht nur Investitionen, sondern auch die Beteiligung der Menschen vor Ort. Es geht um eine Gewinnbeteiligung – also Umverteilung – und Mitbestimmung, etwa bei Gesundheit, Bildung, Transport, Stadtplanung, Bankenkontrolle. Besonders de-industrialisierte Regionen würden davon profitieren. Beide Ebenen, die betriebliche wie die regionale, kommen auch mit den besten Modellen nicht aus ohne eine übergeordnete Wirtschaftspolitik, die mit dem Neoliberalismus bricht.Wirtschaftsdemokratische Labore sind nur dann möglich, wenn sie in einem gesellschaftlichen Konsens gedeihen können, der das Allgemeinwohl zum obersten Prinzip erklärt. Dafür ist ein Bruch mit der vorherrschenden Politik nötig, vor allem innerhalb der SPD. Sowohl die „Schwarze Null“ als auch das Festhalten an Niedriglöhnen und Hartz IV stehen dem entgegen. Es braucht mehr als einen Kevin Kühnert. Wichtig sind linke Erzählungen, die realistisch sind und Menschen überzeugen.Soziale Bewegungen und Proteste in Städten wie Berlin beweisen, dass der Druck wächst. Es gibt Mehrheiten für Enteignungen, weil die Realität zu dieser Radikalität zwingt. Doch auch die besten Mietenproteste reichen nicht aus. Sie müssen gestützt werden von Akteuren wie Parteien, Gewerkschaften, Think Tanks, die eine Vorstellung von einem anderen Wirtschaften entwickeln und selbst durchsetzen.Ein solches Gesellschaftsprojekt müsste die Vorstellung von Eigentum verändern. Und zwar so, dass ökonomische Planung nicht bloß von privaten auf staatliche Eliten übergeht. Es geht um die Gründung von „Gesellschaftseigentum“. Macht und Ressourcen lägen dann in Händen normaler Menschen, durch neue Formen der demokratischen Mitbestimmung und des öffentlichen Eigentums auf der lokalen, der regionalen und der nationalen Ebene.Placeholder authorbio-1