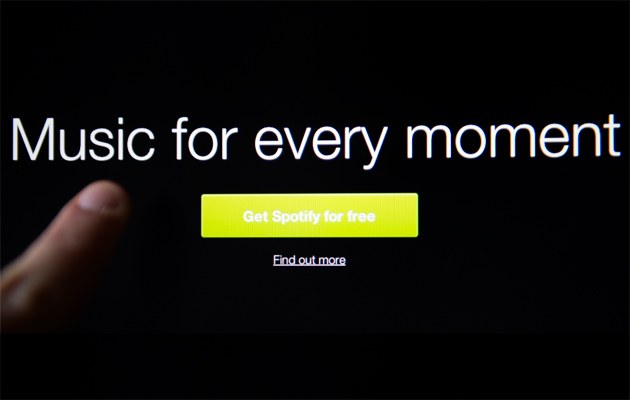Dass Musikbusiness nicht nur manchmal eher an ein Irrenhaus erinnert als an regulär kapitalistische Marktwirtschaft, ist nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Investitionen in die Ware Popmusik waren schon immer Hochrisiko-Kapital, der geschäftliche Erfolg ohne Spekulation, den Riecher für Innovation und unkonventionelle Herangehensweise nicht möglich. Los ging der Schlamassel erst, als diese Binsenweisheit zwischenzeitlich verdrängt wurde und Musik als sichere Kapitalanlage galt – es waren die goldenen Zeiten der CD und ihrer fantastischen Gewinne, die klassische Finanzinvestoren anzogen und aus herkömmlichen Plattenfirmen in verblüffend kurzer Zeit strikt renditeorientierte Kapitalgesellschaften machten. So ziemlich jeder der vielen verhängni
gnisvollen Fehler der Musikindustrie in den letzten 25 Jahren lässt sich mehr oder weniger direkt auf die – nun doch urkapitalistische – Logik der kurzfristigen Gewinnmaximierung zurückführen. Die folgende „Krise der Musikindustrie“ lässt sich denn auch ganz rational als Innovationsversagen ansehen, als das Festhalten an nicht zukunftsfähigen Geschäftsmodellen in einem sich stark wandelnden Marktumfeld.Inzwischen allerdings – so hört man von allen relevanten Dachverbänden der internationalen Musikindustrie – ist die Wende geschafft, die Gewinne steigen wieder, wenn auch auf sehr bescheidenem Niveau. Man ist wieder zukunftsfroh. Die Zukunft – denn dort kommen diese Gewinne her – das sind die Streaming-Modelle à la Pandora oder Spotify. Alles gut also? Und jetzt wird es fast schon wieder lustig: Denn ausgerechnet von Musikern – im System eigentlich auf die Rolle des zwar irgendwie unverzichtbaren aber letztendlich austauschbaren und sowieso unsicheren Kantonisten ohne einen Hauch Ahnung von oder Verantwortung für das große Business festgelegt – muss man sich vorwerfen lassen, man solle doch bitte erstmal ein überhaupt funktionierendes Geschäftsmodell entwickeln.David Lowery hat das letztens getan, nachdem auch er – wie immer mehr Musiker – öffentlich verwundert auf seine Abrechnungen geschaut hat. 16,89 Dollar hat er für über eine Million Abrufe seines Songs „Low“ auf Pandora erhalten. Der Treppenwitz dabei: Pandora – Amerikas größter Streamingservice – macht gerade mächtig Lobbydruck, um die gesetzlich festgelegten Abgaben an die Künstler verringern zu lassen. 60 Prozent der Einnahmen fließen derzeit zurück an die Rechteinhaber der abgerufenen Musik. Zuviel – so Pandora – um im Medienmix-Markt konkurrenzfähig zu sein. Sprich: Zu viel, um profitabel zu werden.Alle Streamingdienste – und es werden momentan immer noch mehr – arbeiten von Anbeginn an mit Verlusten. Spotify, weltweiter Marktführer, hat bei 430 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr 60 Millionen Euro Verlust gemacht. Mit dem steigenden Umsatz der letzten Jahre ist dabei auch der Verlust gestiegen. Erfolg sieht normalerweise anders aus. Trotzdem gilt Spotify als Musterbeispiel des neuen Musikmarktes, gar als Heilsversprechen der Branche, und zieht immer noch Investoren an. Die zählen auf das weiter anhaltende Wachstum der Firma, auf ungebremst steigende Premium-Kunden (ein Viertel der Nutzer sollen zahlende Abonnenten sein) – und auf eine unausweichliche Bereinigung des Marktes zugunsten des derzeit größten Fisches, also Spotify.Wenn es eine Lehre der Internet-Ära nach der Aufbruchseuphorie gibt, dann die, dass sich nur das Monopol geschäftlich behaupten kann. Nie war das Sprichwort wahrer, dass der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt. Der Prozess war immer ähnlich: Aus einer Reihe von Anbietern kann sich nur einer durchsetzen und dominiert irgendwann den kompletten Markt. Platz für andere bleibt nur noch in marginalen Nischen. So sieht das auch David Byrne, vormals Mastermind der Talking Heads und wie Lowery einer jener Künstler, die gemeinhin als sachkundig gelten, wenn sie sich zum Thema Musikgeschäft äußern. Für ihn ist die aktuelle Entwicklung vor allem für noch nicht etablierte Musiker verhängnisvoll. Denn nicht die allseits gepredigten Möglichkeiten zur Vielfalt werden im Netz verwirklicht, sondern „a culture of blockbusters“. Das Standardargument der Streamingdienste, sie würden mit ihren Empfehlungsalgorithmen ja überhaupt erst für Bekanntheit eines Künstlers sorgen, lässt Byrne nicht gelten. Und mal ehrlich: Wer hat die penetranten „Du hast letztens XY gehört, die gefällt sicher auch YZ“-Meldungen jemals nicht als reine Nerverei empfunden?Im Kampf um Aufmerksamkeit und Erlöse haben die Majors wieder den Finger am Drücker. Sie dominieren mit ihren riesigen Backkatalogen das Angebot und nur sie sind überdies in der Lage, einzelne Themen mit enormem Aufwand weltweit zu pushen. Blockbuster eben, wie aktuell Lady Gaga oder Katy Perry. Deswegen sind sie – wenn auch noch vorsichtig aber deutlich – optimistisch, fließt doch der Löwenanteil der Erträge an sie. Und das ist – Kleinvieh für jeden einzelnen abgerufenen Track macht auch Mist – gar nicht mal so wenig. Nur: Davon kommt bei den eigentlichen Produzenten, den Urhebern und Musikern, oft kaum etwas an.Gern bezahlt die Musikindustrie gerade im Majorbereich immer noch nach den alten Vertragsregeln der physischen Welt. Dort waren erhebliche Kostenposten für Herstellung und Vertrieb von Tonträgern eingepreist. Beim Musiker kamen vielleicht noch zehn oder ein paar mehr Prozent des Ladenpreises an. So ist das heute auch noch. Nur, dass der Ladenpreis jetzt durch die vielfach kleinere Pauschale der Streaming-Abrufe abgelöst wurde. Daher auch die – abseits der Urheberrechte – kümmerlichen Ausschüttungen sogar oft gespielter Künstler.In Schweden – Spotify-Mutterland und allseits als Zukunftslabor angesehen – ist es jetzt vielen Musikern genug. Sie drohen per Musikergewerkschaft , die Labels zu verklagen, die nicht bereit sind, die Konditionen der Gewinnverteilung den realen Gegebenheiten der digitalen Vertriebs-Welt anzupassen. Grob über den Daumen kalkuliert wäre das immerhin eine Vervierfachung, von zehn oder 15 auf wenigstens 50 Prozent der Streamingerlöse. Anderenfalls würde man die eigenen Songs so weit wie möglich aus dem Streaming-Angebot nehmen. Das wiederum gefährdet eine der Geschäftsgrundlagen von Spotify und Co, die nur wirklich funktionieren können, wenn sie möglichst keine Lücken im Angebot haben. Das ist schon ohne allgemeinen Boykott schwierig genug, etliche Musiker sind bei ihnen nicht präsent; weil sie nicht wollen, weil die Rechte ungeklärt sind oder weil sie im weltweiten digitalen Katalog an Musik einfach nicht enthalten sind. Das zu vermeiden ist übrigens neben dem klassischen Produktionskostenvorschuss einer der Hauptgründe, warum man auch heutzutage noch so etwas wie ein Label benötigen könnte.