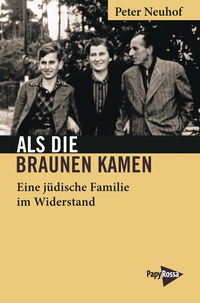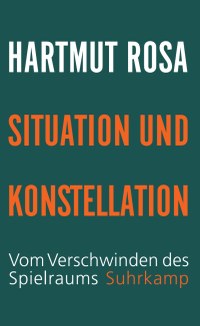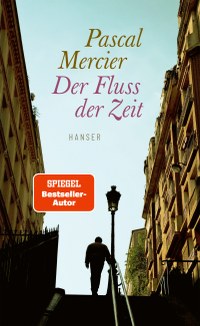Für Stunden der Fron entronnen
Der 3. Oktober 1941 ist ein sommerlich warmer Herbsttag. Ein Mann sitzt vor einem Zeichenblock und lässt aus Wasserfarben inmitten märkischer Landschaft ein Bild entstehen. Kein Meisterwerk. Keine große Kunst. Auch nicht für die Nachwelt gedacht. Erinnerung an Stunden im Tegeler Wald. Und dennoch nicht irgendein Bild.
Oktober 1991 – Ein halbes Jahrhundert später. Wie schon so oft blicke ich auf ein langsam verblassendes Aquarell. Es hat die Zeit und den Maler überdauert, der es einst seinem Freund schenkte.
Durch den Tegeler Wald wandern an jenem 3. Oktober 1941 zwei Männer, für Stunden der Zwangsarbeit entronnen. Sie sind Juden. Sie wissen, was ihnen und ihren Familien bevorsteht. Die Nazis haben es oft genug und lautstark verkündet. Juden sind längst Menschen zweiter Klasse. Sie führen ein Leben zwischen Angst und Hoffnung. Die Hoffnung schwindet immer mehr. Das Programm der Braunen läuft auf »Endlösung« hinaus.
Nach dem Reichsbürgergesetz sind Juden keine Reichsbürger. Sie sind Freiwild, sie mussten es schon oft genug erleben.
Die beiden – der eine Architekt, der andere Getreidehändler – haben schon lange Berufsverbot. Mit der Pogromnacht kam das endgültige Aus. Jetzt müssen sie in der »Judenkolonne« der Farbenfabrik Warnecke & Böhm in Weißensee Zwangsarbeit leisten. Für wenig Geld und viele Stunden. Sie werden angetrieben vom Betriebsführer Pagenkopf. Der gehört zu den vielen kleinen Herrenmenschen, die sich jetzt austoben dürfen. Die beiden Freunde entweichen für wenige Stunden der Fronarbeit. Sie fahren hinaus in den Tegeler Forst. Sie laufen kreuz und quer, sprechen über ihre Lage. Wer soll Juden noch retten? Die Grenzen sind geschlossen. Sie waren schon früher für allzu viele unpassierbar. Juden sind seit Jahren gekennzeichnet, mit dem »J« in der Kennkarte, durch Zwangsnamen, durch den gelben Stern.
Seit Monaten tobt der Krieg im Osten. Sind die Faschisten nicht aufzuhalten? Gibt es niemanden, der sie niederringt? Wo bleibt die Rote Armee? Verzweiflung, Resignation. Die beiden Männer suchen nach einem Schlupfwinkel für ihre Familien. Aber wo sollen sie ihn finden?
In den Mittagsstunden machen sie Rast. Sie vergessen fast ihren Alltag. Sie genießen die Stunden der Einsamkeit. Der Architekt hat einen Tuschkasten dabei. Woher er in dieser Situation noch die Kraft zum Malen nimmt. So entsteht das Aquarell. Sonnendurchflutete Kiefern. Weiche, sanfte Grünpolster, blasses, schon verblühtes Heidekraut. Der Maler signiert: »3.10.41, UM«. Der Maler heißt Ullrich Meyer. Er überlässt das Bild seinem Freund, meinem Vater. Auch der hat keine Illusionen mehr. Ja, wenn der Krieg bald zu Ende ginge, mit einer Niederlage der Nazis. Im Oktober 1941 stehen die Zeichen dafür schlecht. Ullrich Meyer versucht noch verzweifelt, seinen kleinen Jungen Michael zu retten. Aber wer verbirgt schon ein jüdisches Kind?
Ullrich Meyer wird nicht mehr lange leben. Auch mein Vater nicht. Die Spuren der beiden werden in den Gaskammern und Krematorien verloren gehen. An Ullrich Meyer wird 50 Jahre später nur noch das Aquarell erinnern. Es hängt heute in meiner Wohnung.
In einem der 46 Osttransporte wird Ullrich Meyer von Berlin aus zusammen mit seiner Frau Annemarie und seinem Sohn einem qualvollen Tode entgegenfahren. Später wird es im Gedenkbuch für die ermordeten deutschen Juden heißen: »Ullrich Meyer, geb. 1.6.10, verschollen in Auschwitz.«
Für Karl Neuhof wird das Standesamt II Oranienburg – zuständig für das KZ Sachsenhausen – die Sterbeurkunde ausstellen: »Verstorben am 15.11.43 um 16 Uhr 20«.
50 Jahre danach. Ich schreibe die Geschichte dieser kurzen Freundschaft nieder. Sie erscheint in einer Zeitung. Ich vergesse dabei nicht, das Leben und Überleben der Mörder nachzuzeichnen. Deren Namen sind bekannt.
Wenige Tage darauf klingelt das Telefon. Es meldet sich eine Stimme mit englischem Akzent. Ob ich der Autor des Artikels sei. Und dann stellt sich heraus, dass der Anruf von der Schwägerin des Ullrich Meyer kommt. Sie, die in England einen Bruder von Ullrich Meyer geheiratet hatte, kam nach dem Krieg mit ihrem Mann nach Deutschland. Von Ullrich Meyer wussten sie nur, dass er in Auschwitz ermordet worden war. Woher sollten sie auch wissen, wie die Jahre vor der Deportation verlaufen waren?
Ullrich Meyer hatte die Chance, Deutschland den Rücken zu kehren. Er war 1938 zu Besuch in England, war aber wieder nach Deutschland zurückgekehrt, weil seine Frau keine Einreise nach England erhalten hatte.
Monate nach dem Gespräch mit Frau Meyer erreicht mich ein Brief aus England. Absender Klaus Meyer. Es ist der Bruder von Ullrich Meyer. Ihm war noch rechtzeitig die Flucht gelungen. »… sofort nach dem Ausbruch des Krieges waren alle Nachrichten abgeschnitten, und sein Leben in der Zwischenzeit vor der Deportation war uns hier unbekannt. Wir wussten nur, dass die Verfolgung schlimmer wurde, aber was wirklich geschah, blieb noch schleierhaft. Von der Zwangsarbeit wusste ich nichts, auch nicht, ob er etwas einbringen konnte, um die Familie zu ernähren.
Von seiner Freundschaft mit Ihrem Vater zu hören, wirft noch ein besonderes Licht auf sein damaliges Leben. Ullrich war ein ziemlich stiller Mensch, aber so sensitiv wie sein Farbsinn. Er spielte auch Cello, und ich habe viele Stunden lang zu Hause der Kammermusik zugehört. Seine Freundschaften waren fest und gingen tief. Ich weiß daher, dass Ihr Vater ein feiner Mensch war und betraure ihn als meinen eigenen Freund. Dass Ullrich zu jener deprimierenden Zeit noch so ein schönes Bild malen konnte, ist ein persönlicher Triumph über die Verhältnisse.«
Soldat des Kaisers
In den Ersten Weltkrieg zieht Karl Neuhof als »Einjähriger«. Er wird später nie über den Krieg sprechen, über die Gefechte, die er mitmachte, über das Leben in den Schützengräben und in der Etappe. Auch nicht über seine Verwundungen. Frontgeschichten sind ihm zuwider. Er hat genug gesehen, mitgemacht, mitgeteilt.
Sein Militärpass ist erhalten geblieben. Ausgestellt im Jahre 1913 für den sog. »Einjährigen Freiwilligen«. Freiwillig für Deutschland? Sein Vaterland? Will er es in Kriegszeiten verteidigen? An Sarajevo ist noch nicht zu denken. Auf der Bergkaserne dann die Ausbildung. Schießübungen im nahen Ockstadt. Die Monate gehen schnell herum. Doch dann die Mobilmachung. In den Militärpass wird eine Zusatzseite eingeklebt. Die Adressen von Angehörigen werden verlangt. Für die Benachrichtigung im Falle…
In der Stadt kursieren die wildesten Gerüchte. Russische Spione sollen gesichtet worden sein. Die Stadt in Aufregung. Das IR 168 rückt aus. In den Krieg zieht Karl Neuhof als Gefreiter. Der Kompanieführer bestätigt ihm eine gute Führung. Für die jungen Rekruten heißt es Abschied nehmen. Es geht an die Westfront. Der Soldat Neuhof ist laut Militärpass an dem Gewehr 98 ausgebildet, hat die Stiefellänge 28 und die Stiefelweite 5. Er hat auch Putzzeuggeld erhalten.
Kaum an der Westfront, wird er in einem der ersten Gefechte verwundet. Der Kompanieführer, ein Leutnant der Reserve, führt genau Buch: 22.8.14 – Schlacht bei Neufchâteau – verwundet bei Neufchâteau – Schulter. Nach der Genesung wird er an die Ostfront versetzt. Der Transport dauert 10 Tage. Er nimmt an der Verfolgung russischer Truppen im Gebiet an der Zlota-Lipa (kl. Fluss im ehem. Galizien, östlich von Lwow (Lemberg)) teil, an den dann folgenden Stellungskämpfen und der Durchbruchsschlacht. Der Militärpass zählt die einzelnen Stationen der mitgemachten Gefechte auf. Es sind viele, und sie kosten viele Opfer. Verfolgungskämpfe wechseln immer wieder mit Stellungskrieg ab. So geht es über Monate. Aus dieser Zeit ist auch ein Feldpostbrief vom 24. September 1915 erhalten geblieben, der einen kleinen Einblick in den Alltag an der Front von Galizien gibt.
»Also so vor gestern Mittag so gegen fünf herum, wir sind gerade fest am Exerzieren: Stillgestanden, rührt Euch. Da sprengt auf schäumendem Ross eine Ordonnanz heran, ich betrachte mir gerade die russischen Schrapnellwölkchen, die ganz in der Ferne irgendwo platzen, und schon heißt’s: Abrücken, sofort fertig machen. Es geht weiter. Wir hatten es uns schon wohlig gemacht, in den Unterständen, die vor einem Dorf mit unaussprechlichem Namen liegen. Das Dorf selbst war zum Teil abgebrannt, und es waren dort nur wenig Truppen unterzubringen. Deshalb der Notbehelf.
Gepackt ist schnell; wir marschieren los, eine kleine Stunde bis zum Ziel. Seit vielen Tagen haben wir von der Sonne erst gegen Abend einen meist armseligen Untergang zu sehen bekommen. Aber ein plötzlicher Wetterumschlag ließ mich einige wunderschöne Minuten erleben. Ich marschiere am Schluss der Kompanie und drehe mich wieder und wieder um und schaue vor mich im höchsten Entzücken. Vor mir marschiert die Kompanie, einer spielt die Mundharmonika und es geht im Gleichschritt vorwärts. Die Leute sind in lauter Purpur, im flüssigen Gold der scheidenden Sonne eingehüllt. Und ich sehe zurück und sehe das sonst so arme, schmutzige Dorf in Rosen gebettet. Ein mächtiges Purpurstrahlenbüschel und darum ranken sich rote Rosen, steigen, fallen, wachsen und vergehen. Ich fühle mich zu arm, einen solchen Sonnenuntergang zu beschreiben; ich glaube, nur ein großer Künstler kann das, und das muss ein Maler und Musikant sein. Aber gesehen habe ich ihn in all seiner Schönheit.
Wir kommen in den Schützengraben, und ich habe Arbeit vorerst. Die Lauscherposten werden vorgesandt, die Wachen nochmals instruiert, und was der Dienst noch mit sich bringt. Es ist schnell dunkel, und ich sitze noch lange beim Kerzenschein essend, trinkend und mich mit den Kameraden unterhaltend. Das Abendessen war dem schönen Unterstand entsprechend (Bett! Tisch, Bank, Wandbrett, Tür). Glänzend. Es interessiert vielleicht: Auf Patentapparat gewärmte Lenden, Aprikosen, Kommissbrot, Rotwein, der als Liebesgabe kurz vor dem Abrücken empfangen wurde. Immer ist’s natürlich nicht so; wenn aber die Post kommt, leben wir nicht schlecht. Und das dürfen wir auch nicht.
Ich stehe nachts einmal auf und sehe einen wunderbaren klaren Mond und über weite Strecken Silberland. Und als ich morgens erwache, steht eine hellglänzende Morgensonne am Himmel. Es ist noch etwas kühl, aber an diesem Tag sieht mich meine Bude nicht mehr. Ich mache einen Morgenspaziergang, besichtige den kolossal starken Drahtverhau und gehe etwas weiter vor. Die Russen haben an dieser Stelle am 13. und 14. September, als die Garde hier lag, stark angegriffen, sollen aber ungeheure Verluste erlitten haben und sind nun weit weg von uns, sodass ich heute den ganzen Tag wie alle anderen frei auf der Deckung herumlaufe und die liebe Sonne mich streicheln kann.
Es wird gekocht und gebraten, als ob Manöver wäre. Da sieht man nun doch die kleinen Löcher, die sich die Russen als Deckung beim Heranarbeiten machten und auch unsere Volltreffer, die auf einen Schlag Dutzende Menschenleben teils vernichteten, teils verstümmelten. Ein einsames Russengrab liegt auf halber Höhe. Jetzt sieht man noch was davon und übers Jahr geht der Pflug vielleicht schon drüber. Ein viereckiges Stückchen schon eingesunkener Erde, am Kopfende eine Mütze, das ist alles. Da sieht man noch ein paar blutige Fetzen von Verbandspäckchen, ein paar Patronen liegen zerstreut umher, noch ein paar Fetzen von Kleidungsstücken, Granattrichter, und das ist alles von dem großen Kampf. Auf der Gegenseite hinter den Gräben so schön hergerichtete deutsche Gräber gefallener Gardisten, vier Mann, hie und da im Gelände noch ein Kreuz.
Unsere Gräber sind schön gebaut, man hat die Schrift so gut wie möglich geschrieben, Kreuze hergerichtet und alles ist dazu angetan, schöne, frische Morgenstimmung ins Sentimentale umschlagen zu lassen. Aber ein Blick zur Sonne genügt; sie hat mit ihrem strahlenden Glanz unsere ganze, kleine Welt umfasst, und es tauchen aus Büschen und Gräben Menschen auf, die sich in der fast vergessenen Sonne strecken und dehnen und in denen eine lebensbejahende Freude aufquillt, die der Morgen erfrischt und beinahe zu anderen Menschen umarbeitet.
Wir werden hart und egoistisch. Der Tod ist zur Selbstverständlichkeit geworden, denn er nahm uns unsere guten Freunde und wir konnten es nicht ändern; wir fanden neue und sie gingen, wie sie kamen und uns war er oft nahe; so nahe, dass diese egoistische Lebensfreude, die bei näherer Überlegung sich gar nicht als Egoismus erweist, nur zu verständlich wird. Es ist ein Leben in den Tag hinein, oft ein fröhliches, selten ein trauriges. Nur manchmal nach großen Anstrengungen ein etwas stumpfes Leben. Aber immer wieder taucht aus dem Meer des Lebens der Humor und die Freude auf. Das ist unser Leben; wir haben uns daran gewöhnt. Freude am Heute und daneben stilles Verzichten und Entsagen, das im innersten Herzwinkel ruht und nur selten zum Vorschein kommt.
Wir sind alle Menschen geblieben. Die kleinen Streitigkeiten des Alltagslebens sind rasch vergessen. Man trägt sich nichts nach und ist bald wieder gut Freund. Ganz als kleiner Mensch fühlt man sich sekundenlang, wenn einmal die ersten Granaten platzen, aber das vergeht doch schnell.
Jetzt muss ich aber aufhören. Die Regimentsmusik ist an den Schützengraben gekommen und fängt gerade mit dem Hoch und Deutschmeister an. Es ist der reinste Jahrmarkt.
Musik, Musik im Schützengraben. Muss man da nicht mit Schreiben Schluss machen? Mögen sie spielen, was sie wollen; es ist Musik, es singt und tönt und die Sonne scheint. Heut’ leben wir, heute lachen wir, heute freuen wir uns. Die Musik spielt uns ein lustig’ Lebenslied. Unser Leben ist das schönste auf der Welt, denn was ist uns morgen? Ein Nichts, eine Erscheinung, die vielleicht mal flüchtig auftaucht und wieder ebenso schnell verschwindet. Heute leben wir und die Musik singt und lacht uns ein lustig’ Lebenslied.
Und da drüben schießen sie mit Kanonen, und da lauert heimtückisch ein Fesselballon, Flieger sausen in den Lüften, am Drahtverhau wird gearbeitet.
Da liegen Leute im Grab, die noch vorgestern lebten, und ich sehe fast lauter neue Gesichter um mich. Wo sind die alten Kameraden? Die Musik spielt auf; ja, weg damit, einen lustigen Marsch spielt sie und wir freuen uns und lachen. Lass’ ihn grüßen und von Ferne winken. Heute herrschen wir, meinetwegen morgen er.
Wir und der Tod
Kess pfeifen die Granaten,
Sie können Dir nichts schaden,
Wem gilt’s? Ei ja, dem Feind!
Und wenn sie morgen schießen,
Und uns mit Eisen grüßen?
Dann gilt es eben uns!
Wir nehmen’s wie’s Schicksal will.
Und winkt es, folgen wir ihm still –
Sonst – trutzen wir ihm lachend.
Fast ein halbes Jahr dauern die Stellungskämpfe an der Strypa an. Wilhelm II. besucht die kämpfende Truppe. Im Reisegepäck Orden und Ehrenzeichen für Soldaten und Offiziere. Auch Karl Neuhof, inzwischen Vizefeldwebel, ist an der Reihe.
Wilhelm II. höchstpersönlich heftet ihm das Eiserne Kreuz 2. Klasse an die Brust. »Von wo er denn sei«, will der Oberbefehlshaber wissen. »Aus Friedberg«, war die Antwort. »Da hast du aber Glück gehabt.« »Majestät« fällt wohl nichts Besseres ein. »Der trug einen Schal, den seine Auguste wohl selbst gestrickt hatte«, schreibt der junge Vizefeldwebel an seine Mutter. Ein Fotograf hält die Szene fest. Zeitungen bringen das Bild. Die Schwester meines Vaters lässt es rahmen, hängt es ins Schaufenster ihres Metzgerladens in Worms. Ihr jüdischer Bruder und der Kaiser. Alle sollen es sehen.
Im Dezember wird Karl Neuhof die österreichische Tapferkeitsmedaille verliehen. Deutsche und österreichische Truppenteile kämpfen gemeinsam an der galizischen Front.
Ein halbes Jahr später, am 15. Juni 1916, muss der Kompanieführer, ein Rittmeister, erneut eine Verwundung von Karl Neuhof in den Militärpass eintragen. Wieder ist der linke Oberarm durchschossen worden. Es folgen Lazarettbehandlung, Genesungsurlaub, Versetzung in eine Ersatzkompanie, schließlich erneut Einsatz an der Westfront. Im Militärpass wird die Teilnahme an Gefechten vor der Siegfriedfront vermerkt. In einer Wirtschaftskompanie er lebt er das Kriegsende. Kurz zuvor erhält er noch das Verwundetenabzeichen in Schwarz. Ein Hauptmann Goebel teilt am 21. November 1918 handschriftlich mit, dass der Vizefeldwebel Neuhof infolge Demobilmachung nach Friedberg entlassen wird. »Führung: sehr gut. Strafen: keine.«
Am 7. Januar 1919 erhält Karl Neuhof Entlassungsgeld in Höhe von 50 Mark und eine Marschgebühr von 15 Mark. Das Kapitel Krieg ist für ihn beendet. Er kehrt aus dem Ersten Weltkrieg mit zwei Verwundungen und dem Eisernen Kreuz zurück, aber auch als Gegner des Krieges. Und trotzdem – oder gerade deshalb – greift er 1920 noch einmal zur Waffe zur Verteidigung der jungen Republik gegen monarchistisch-militaristische Kräfte aus Freikorps und Reichswehr. Die haben den sozialdemokratischen Reichspräsidenten Ebert und die Regierung gestürzt. Ein konterrevolutionärer Putsch. Er geht in die Geschichte als Kapp-Putsch ein. Ein Generalstreik führt zu einer Niederlage der Putschisten. Eine Rote Ruhrarmee aus Freiwilligen aller Schichten der Bevölkerung, darunter mein Vater, jagt im Ruhrgebiet die Putschisten davon, will die politische Macht erobern. Ziel: Sozialismus. Jetzt wird sie selbst gejagt. Der sozialdemokratische Reichswehrminister Noske gibt die Befehle.
Die Zentrale der KPD schreibt in jenen Tagen: »Im Ruhrgebiet entscheidet sich die Sache des gesamten deutschen Proletariates. Dort fallen die Würfel darüber, ob der Säbel herrschen soll wie unter Noske oder ob die Arbeiterklasse die Säbel zerbricht.« Die Säbel zerbrechen nicht. Visionen werden niederkartätscht. Im Ruhrgebiet und anderswo. Die Kanonenkönige und die Generäle bleiben.