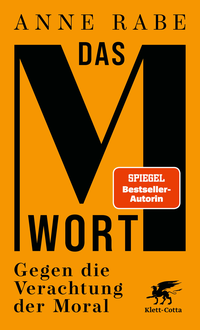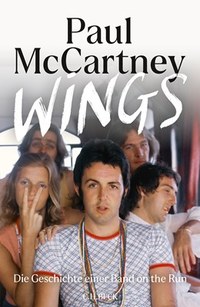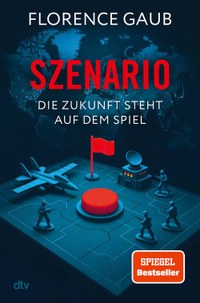Wir wissen ja alle nicht, wo das enden wird.
Das ist ein Satz, der mir in politischen Diskussionen der letzten Wochen und Monate häufig begegnet. In ihm schwingen die Angst vor dem, was noch kommen könnte, genauso mit, wie die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm kommen wird, wie befürchtet. Manchmal vernehme ich jedoch auch einen Zynismus, der seine Untätigkeit, seinen Rückzug ins Private damit zu begründen versucht, dass man ohnehin ausgeschlossen sei, von den Entscheidungen, die gerade die Welt verändern; oder auch, dass als Tatsache postuliert wird, was in demokratischen Gesellschaften keine Tatsache ist, sondern der Veränderbarkeit obliegt – der Zeitgeist hat sich schlicht gedreht. Die Gesellschaft ist politisch nach rechts gerückt. Das sehen wir im Wahlverhalten, das höre ich aber auch von meinen Kindern, die Teenager sind und davon erzählen, dass Queerfeindlichkeit, konservative Familienbilder, Islamfeindlichkeit und die Verteidigung von Privilegien gegen Minderheiten ganz selbstverständlich auch in ihrem Umfeld wieder präsent sind.
Die Leute hätten auf dieses oder jenes keine Lust 11 mehr, heißt es auch. Die Leute wollten sich eben nicht mehr alles vorschreiben lassen. Die Welt sei nun einmal nicht Bullerbü. Es ist natürlich kein Zufall, dass ausgerechnet dieses Buch von Astrid Lindgren als Gegenentwurf zu dem behaupteten Realismus herangezogen wird, wenn es etwa darum geht, moderne Verkehrskonzepte abzulehnen, deren Zentrum nicht länger das Auto sein soll. »Ich mach mir die Welt, wiedewiedewie sie mir gefällt«, schwingt als Vorwurf der selbsternannten Realapostel mit, das Leitmotiv, der wohl berühmtesten Lindgren-Figur, Pippi Langstrumpf.
Wer jedoch einmal im echten Bullerbü, Sevedstorp, dem kleinen Dreihäuserdorf in der schwedischen Provinz Småland war, weiß, dass dieser Ort für jeglichen politischen Vergleich ungeeignet ist. Bei aller Lust an der Zuspitzung, das Bild ist schief, wenn man seinem politischen Gegner unterstellt, er wolle die Welt irrsinnigerweise zu Bullerbü machen. Drei rote Häuser irgendwo im schwedischen Nirgendwo stehen für gar nichts. In dem Bullerbü-Bild geht es in Wirklichkeit um etwas anderes. Es geht darum, dem politischen Gegner einen Realitätsverlust zu unterstellen und gesellschaftliche Verhältnisse als unverrückbare Parameter zu definieren. So ist sie nun einmal, diese Welt, findet euch damit ab. Die Leute wollen das so.
Die Romanwelt Astrid Lindgrens ist voller kindlicher Figuren, die in eine unwägbare Welt geworfen sind, in der sie nicht selten von den Erwachsenen allein gelassen werden. Auch ihrer berühmten Romanheldin Pippi geht es so. Ihre Mutter ist gestorben, der Vater vergnügt sich in der Südsee, während Pippi mit einem Koffer voller Gold auf sich allein gestellt ist. Ihre körperliche Stärke ist nicht nur eine Superkraft, sie ist eine Notwendigkeit. Sich die Welt so zu machen, wie sie ihr gefällt, ist keine Realitätsverweigerung, es ist ein überlebenswichtiges Mantra. Pippi erschafft sich eine Wirklichkeit, in der weder ihre mangelhafte Bildung noch die verweigerte Hilfe ihr etwas anhaben können. Sie gestaltet und verändert die Welt, in die sie geworfen ist, so, dass sie darin überleben kann.
Die Realitätsverweigerung findet auf anderer Seite statt. Es ist die Erwachsenenwelt um sie herum, die sich nicht verantwortlich für das Kind fühlt. Besonders deutlich wird dies in der wohl anrührendsten Episode des Pippi-Universums. Sie spielt am Weihnachtsabend. Pippi muss das Fest ganz allein gestalten, was sie mit großer Emsigkeit auch tut. Sie behängt beispielsweise einen Baum in ihrem Garten mit Geschenken für alle Kinder aus der kleinen Stadt, in der sie lebt. Dann wird es still. Die Kinder sind bei ihren Familien und feiern dort das Weihnachtsfest. Pippi jedoch sieht aus dem Fenster in den Himmel. Sie denkt an ihre Mutter und führt ein Gespräch mit ihr. Sie denkt auch an ihren Vater, der weit weg in der Südsee ist, und dann überfällt sie auf einmal die Angst, dass vielleicht niemand zu ihr kommen könnte, um die Geschenke auszupacken. Ihre Befürchtung ist glücklicherweise unbegründet.
Der Aufwand, den Pippi betreiben muss, um die Einsamkeit zu überwinden, ist jedoch enorm. Sie schafft es allein, es gibt niemanden, der ihr hilft. Nicht, weil sie die Realität verweigert, sondern weil sie diese sehr genau kennt. Sie lässt sich bloß nicht von ihr entmutigen.
Als Astrid Lindgren 1978 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde, hielt sie eine Rede, die wohl zu den wichtigsten Texten der Schriftstellerin gehört. Unter dem Titel »Niemals Gewalt« plädierte sie für die gewaltfreie Erziehung als einen Schritt zu einer friedlicheren Welt. Sie verwies dabei eindrücklich auf die Tatsache, dass in keinem Menschen bei seiner Geburt die Saat der Gewalt angelegt ist, dass diese vielmehr häufig von eben jenen gepflanzt würde, die das Kind lieben sollten. [1] Zu dieser Rede wäre es beinahe nicht gekommen. Denn die Stiftung, die den Preis verleihen wollte, bat die Autorin, die vorab eingereichte Rede nicht zu halten. Sie sei zu provokativ. Zu dieser Zeit war sowohl in der schwedischen Heimat Lindgrens als auch in Deutschland und wohl auch im Rest der Welt das Prügeln von Kindern nicht nur erzieherischer Alltag, es war auch legal.
Lindgren ließ sich von der Aufforderung, den Preis bloß schweigend entgegenzunehmen, nicht beeindrucken. Sie bestand auf die Rede, ansonsten würde sie auf den Preis verzichten.
Ihre Worte hatten Wirkung. Nicht nur, dass sie in der Frankfurter Paulskirche unter großem Beifall aufgenommen wurden, auch die Politik kam an der einmal ausgesprochenen Offensichtlichkeit nicht mehr vorbei. In Schweden löste sie eine Debatte um das Recht auf gewaltfreie Erziehung aus. 1979 wurde in dem skandinavischen Land als erstem auf der Welt das Schlagen von Kindern gesetzlich verboten. Andere Länder folgten diesem Beispiel, und auch Deutschland schaffte es schließlich im Jahr 2001, das Recht auf gewaltfreie Erziehung in Gesetzesform zu bringen.
Lindgren hatte es gewagt, einen moralischen Anspruch in einer Welt zu formulieren, deren Zeitgeist, wie sie es selbst erklärte, nach mehr Strenge, Disziplin und Härte gegenüber Kindern rief. In einer Welt, in der die gewalttätige Erziehung auch bittere Realität für die überwiegende Mehrheit der Kinder war. Die Idee der gewaltfreien Erziehung war nichts weiter als die Vorstellung einer Welt, wie sie ihr gefallen würde. Aber diese Vorstellung war so klar und richtig, dass sie zur Wirklichkeit werden konnte. Der Gedanke war so tragend, dass er sich erfüllte.
Aus diesem und vielen anderen Beispielen entsteht für mich die Frage, ob wir uns in einer sich rasant verändernden Welt das Zurücktreten von moralischen Ansprüchen und Ideen tatsächlich leisten können. Ob wir uns einschüchtern lassen sollten von den Versuchen, die Moral unter Verdacht zu stellen? Unter den Verdacht der Realitätsferne oder gar der Ideologie.
Die Verachtung der Moral ist nicht neu. Sie ist immer wieder Motor reaktionärer und auch gewalttätiger Bewegungen. Sie ist aber auch Teil der Überlegenheitsbehauptung derjenigen, die mit zynischem Schulterzucken andeuten wollen, dass sie sich keine Illusionen mehr machen: Es ist, wie es ist. Finde dich damit ab. Oder auch Teil derer, die unter dem Deckmantel des Realismus ihre Privilegien verteidigen. Warum sollten wir uns dem ergeben? Wer moralische Ansprüche daran misst, ob sie bereits Wirklichkeit sind, verkennt die Kraft dieser Ideen und auch das Potenzial unserer Fantasie. Wir haben die Möglichkeit, die Welt mit unseren Gedanken zu verändern. Nichts war einfach, wie es war. Nichts muss bleiben, wie es ist. Das macht Angst, aber darin liegt auch Hoffnung.
2. Mai 2025
Der Verfassungsschutz stuft die AfD bundesweit als rechtsextrem ein. Captain Obvious flattert mit wehendem Mantel durch die Republik. Get the fuck up again, Rocky. Go get ’em!
Dieser Essay ist ein Versuch. Ein Versuch zu verstehen, welche Welt uns droht abhanden zu kommen. Was genau wir drohen zu verlieren. Wann wir begonnen haben, es uns nehmen zu lassen. Oder haben wir es hergegeben?