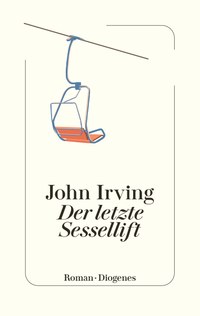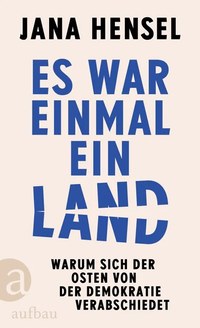Ein nicht gedrehter Film
Meine Mutter gab mir den Namen Adam, Sie wissen schon, nach wem. Sie sagte immer, ich sei ihr Ein und Alles. Ich habe ein paar Namen verändert, aber nicht meinen und auch nicht den des Hotels. Das Hotel Jerome gibt es wirklich – ein großartiges Haus. Falls Sie je nach Aspen kommen, sollten Sie dort übernachten, wenn Sie es sich leisten können. Aber wenn Ihnen dort Ähnliches widerfährt wie mir, sollten Sie ausziehen. Geben Sie nicht dem Hotel Jerome die Schuld.
Ja, es gibt dort Gespenster. Und nein, damit meine ich nicht die, von denen Sie vielleicht schon gehört haben: den nicht angemeldeten Gast in Zimmer 310, ein ertrunkener Zehnjähriger, der vor Kälte zittert, schnell wieder verschwindet und nur nasse Fußspuren hinterlässt; den liebeskranken Silberschürfer, dessen nächtliches Schluchzen man hört, wenn er durch die Flure streift; das hübsche Zimmermädchen, das in einem nahe gelegenen Tümpel durchs Eis brach und (ungeachtet der Tatsache, dass es danach an einer Lungenentzündung starb) gelegentlich erscheint, um die Betten aufzudecken. Das sind nicht die Gespenster, die ich üblicherweise sehe. Ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, aber mir sind sie kaum je begegnet. Nicht jedes Gespenst wird von allen gesehen.
Meine Gespenster sehe ich ganz deutlich – sie sind für mich ganz real. Ich habe ein paar ihrer Namen verändert, aber nichts von dem, was sie ausmacht.
Ich kann Gespenster sehen, aber nicht jeder kann das. Und die Gespenster selbst? Was ist ihnen eigentlich passiert? Ich meine, wie sind sie zu Gespenstern geworden? Nicht jeder, der stirbt, wird zum Gespenst.
Jetzt wird es kompliziert, denn natürlich ist nicht jedes Gespenst tot. In bestimmten Fällen kann man ein Gespenst und doch noch halb lebendig sein – es ist nur ein wesentlicher Teil von einem gestorben. Ich frage mich, wie viele dieser halb lebendigen Gespenster wissen, was in ihnen gestorben ist und ob es – seien sie nun tot oder lebendig – Regeln für Gespenster gibt.
»Mein Leben ist wie ein Film«, sagen manche, aber was meinen sie damit? Meinen sie etwa, ihr Leben sei zu unglaublich, um wahr zu sein? »Mein Leben ist wie ein Film« bedeutet, man hält Filme gleichzeitig für alles andere als realistisch und für mehr, als man von der Realität erwarten kann. »Mein Leben ist wie ein Film« heißt, man hält das eigene Leben für derart besonders, dass es als Filmstoff taugt; so besonders gesegnet oder verflucht.
Mein Leben ist ein Film, aber nicht aus den üblichen selbstgefälligen oder selbstmitleidigen Gründen. Mein Leben ist ein Film, weil ich Drehbuchautor bin. In erster Linie bin ich Schriftsteller, aber selbst wenn ich einen Roman schreibe, stelle ich mir alles bildlich vor – ich sehe die Geschichte ablaufen, als sei sie bereits verfilmt. Wie manche anderen Autoren auch habe ich die Titel und Plots von Romanen im Kopf, die ich zu meinen Lebzeiten nicht einmal mehr beginnen werde; wie Drehbuchautoren auf der ganzen Welt habe ich mir mehr Filme ausgedacht, als ich jemals schreiben werde; und wie viele habe ich Drehbücher geschrieben, die nie jemand verfilmen wird. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, mir nicht gedrehte Filme anzuschauen; die ganze Zeit tue ich das. Und mein Leben ist bloß ein weiterer dieser Filme.
Dein Roman wird veröffentlicht, dein Drehbuch verfilmt – diese Bücher und Filme vergisst man bald. Man liest die Verrisse wie die guten Besprechungen, gewinnt vielleicht sogar einen Oscar; nichts davon hat Bestand. Aber ein nicht gedrehter Film lässt einen niemals los; einen nicht gedrehten Film vergisst man nicht.
Erste Liebe
Von Aspen hörte ich zum ersten Mal von meiner Mutter; sie war es, die in mir den Wunsch weckte, das Hotel Jerome zu sehen. Es ist meiner Mutter zu verdanken (oder ihre Schuld), dass ich nach Aspen gefahren bin – und es ist ihr zu verdanken (oder ihre Schuld), dass ich es so lange vor mir hergeschoben habe.
Ich dachte immer, meine Mutter würde das Skifahren mehr lieben als mich. Was wir als Kinder glauben, formt uns; was uns in der Kindheit und Jugend ängstigt, kann uns später auf Abwege führen, aber ich nehme es meiner Mutter nicht übel, dass sie das Skifahren ihre erste Liebe genannt hat. Sie hat ja nicht gelogen.
Meine Mutter war eine hervorragende Skifahrerin, auch wenn sie das selbst nie gesagt hätte. In meiner Kindheit hieß es immer nur, sie habe nie einen Wettkampf gewonnen; deshalb hielt sie ihre Fahrkünste seitdem für »eher mittelprächtig«. Meine Mutter war nicht verbittert, weil es mit dem Profisport nicht geklappt hatte, und arbeitete ihr Leben lang als Skilehrerin; am liebsten unterrichtete sie kleine Kinder und Anfänger. Ich hörte von ihr nie auch nur eine einzige Klage über ihre Körpergröße – von meiner Großmutter und Tante Abigail und Tante Martha, den älteren Schwestern meiner Mutter, dafür umso häufiger.
»Geschwindigkeit hat was mit Masse zu tun«, lautete Tante Abigails abschätziges Urteil. Abigail war eine kräftige Frau, vor allem um die Hüften, und wirkte in Skihose eher schwerfällig denn sportlich.
»Deine Mom war so ein kleines Ding, Adam«, teilte mir Tante Martha voller Verachtung mit. »Als Abfahrtsläuferin muss man mehr wiegen, als sie je auf die Waage gebracht hat. Ray war eindeutig Slalomfahrerin. Sie ist so eine, die mit einer Sache genug hat.« »Sie war einfach nicht schwer genug!«, verkündete meine Großmutter in regelmäßigen Abständen; bei diesen spontanen Ausbrüchen reckte sie die geballten Fäuste gen Himmel, so als würde sie höhere Mächte dafür verantwortlich machen.
Die Brewster-Mädchen, auch meine Mutter, waren bekannt für ihre dramatischen Ausrufe, auch wenn meine Großmutter Mildred Brewster, eine geborene Bates, stets behauptete, dieses Faible
fürs Drama sei eher typisch für die Bates als für die Brewsters. Ich glaubte ihr – bei meinem Großvater Lewis Brewster zeigten sich die Anzeichen für eine dramatische Ader erst spät. Ich wusste, dass er früher Rektor der Phillips Exeter Academy gewesen war, wenn auch nur für kurze Zeit und mit bescheidenem Erfolg. Solange ich Rektor Brewster kannte – so wurde er am liebsten genannt, auch von seinen Enkelkindern –, war er schon im Ruhestand. Als ewiger Emeritus war der ehemalige Schulleiter finster und streng, fast katatonisch, offenbar dazu bestimmt, für immer zu leben. Nur wenig schien ihn zu berühren. Nur höhere Mächte würden ihn ins Grab bringen können.
Mein Großvater sprach nicht, wie er überhaupt selten etwas tat.
Ich dachte immer, Lewis Brewster sei schon als Schuldirektor im Ruhestand zur Welt gekommen. Was auch gesagt wurde, Granddaddy Lew – eine Anrede, die er hasste – reagierte höchstens (wenn überhaupt) mit einem Nicken oder Kopfschütteln. Sich auf Kinder einzulassen, die eigenen inbegriffen, schien unter seiner Würde. War er gereizt, kaute er auf seinem Schnurrbart herum.
Als meine Mutter ihren Eltern mitteilte, sie sei schwanger, war ich logischerweise noch nicht auf der Welt. Noch bevor ich die Geschichte kannte, fragte ich mich, was Rektor Brewster wohl dazu zu sagen gehabt hatte. Ich kam am 18. Dezember 1941 zur Welt – eine Woche vor Weihnachten. Wie meine ledige Mutter nicht müde wurde zu betonen, kam ich zehn Tage zu spät.
Näher bekannt
Meine Mutter war die Art von Kinogängerin, die es nicht lassen konnte, das Aussehen ihrer Bekannten mit dem von Filmstars zu vergleichen. Als der österreichische Skifahrer Toni Sailer bei den Olympischen Spielen 1956 drei Goldmedaillen gewann, sagte sie: »Toni sieht ein wenig aus wie Farley Granger in Der Fremde im Zug«, einem Hitchcock-Film, den wir gemeinsam gesehen hatten. Dass meine Mom ein Fan von Hitchcock war, wusste ich, nicht aber, ob sie mit »Toni« Sailer womöglich näher bekannt war.
»Toni ist in Aspen mal beinahe in einen offenen Minenschacht gestürzt!«, verkündete sie auf ihre exaltierte Art mit weit aufgerissenen Augen. Dann ließ sie sich ellenlang über all die Skilifte und neuen Pisten aus, die am Aspen Mountain gebaut und angelegt wurden. Die alten Minenhalden und verlassenen Gebäude würden planiert und abgerissen, sagte sie, aber noch immer gebe es hier und da offene Schächte.
Es ist auch unklar, ob meine Mutter Stein Eriksen, den norwegischen Skifahrer, kannte; ich weiß bis heute nicht, ob sie sich überhaupt je begegnet sind. Die Alpinen Skiweltmeisterschaften 1950 fanden in Aspen statt. »Stein lag nach dem ersten Lauf vorn« war noch längst nicht alles, was meine Mom über ihn zu sagen hatte. Und damit meine ich nicht nur ihre oft demonstrierte Kenntnis seiner berühmten Gegenschulter-Technik.
Nein, als wir uns zum ersten Mal Mein großer Freund Shane anschauten – 1953, ich war elf oder zwölf –, sagte meine Mutter, Stein sehe aus wie Van Heflin. »Aber Stein ist attraktiver«, vertraute sie mir an und nahm meine Hand. »Du wirst mal aussehen wie Alan Ladd«, versicherte sie mir flüsternd, denn wir saßen im Kino – im Ioka in Exeter –, und auf der Leinwand nahm die Gewalttätigkeit des Films ihren Lauf.
Ich wies sie später darauf hin, dass Alan Ladd blond sei; ganz gleich, welchem Filmstar ich ähneln würde, wenn ich erwachsen war, ich würde doch sicher meine braunen Haare behalten. »Ich meinte damit, du wirst auf dieselbe Art attraktiv sein wie Alan Ladd – gut aussehend und klein«, erwiderte meine Mom und drückte mir zur Betonung des Wortes klein die Hand.
Meine Tanten und meine Großmutter beklagten, dass meine Mutter nicht schwer genug war, um in einem Skirennen Chancen zu haben, aber ich glaube, sie selbst mochte ihre Körpergröße. Dass ich ebenfalls klein war, gefiel ihr. In jungen Jahren nahm ich mir also Alan Ladd zum Vorbild, den einsamen, aber romantischen Revolverhelden aus Shane, und ich stellte mir vor, ich könnte ein Held werden oder zumindest wie einer aussehen.
Gab es in Aspen eine wie auch immer geartete Begegnung zwischen Stein Eriksen und meiner Mom? Hat sie ihm überhaupt auch nur die Hand geschüttelt? Ich weiß, dass sie dort war; sie hat die Busfahrkarten aufgehoben, wenn auch nur für die Strecke von New York nach Denver. Sie war dort, aber sie fuhr nicht mal in die Nähe des Siegertreppchens. Zwei Österreicherinnen, Dagmar Rom und Trude Jochum-Beiser, siegten bei den Frauen. Stein Eriksen, der sich bis dato im internationalen Skizirkus noch keinen Namen gemacht hatte, wurde Dritter im Slalom der Herren. Die Amerikaner gewannen keine Medaille. Dass die Alpinen Skiweltmeisterschaften 1950 in Aspen stattfanden, lässt sich nachprüfen – meine Mutter allerdings war bei diesem Ereignis nicht zum ersten Mal dort.