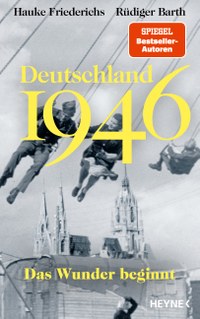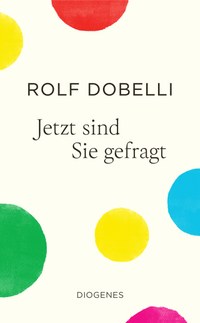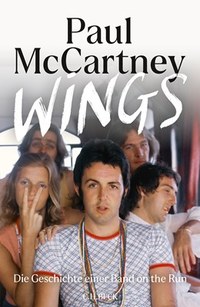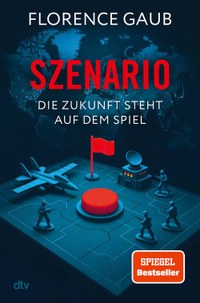In der Schwebe
Silvester 1945
Das Jahr eins nach Hitler beginnt friedlich. Trotz allem ist das wahrscheinlich das richtige Wort. Viele Deutsche verbringen die bitterkalte Nacht des Jahreswechsels in Notunterkünften. Zwar dürfen zumindest die Berliner im britischen Sektor auch wieder nach elf Uhr abends unterwegs sein, weil die Ausgangssperre zu Weihnachten aufgehoben wurde, aber zum Ausgehen überwinden sich dennoch nur wenige. Zu hart ist der Alltag. Es mangelt an Strom, Brennbarem, Trinkwasser, Essen. Den Menschen in Deutschland ist nach Wärme und Nahrung zumute, nicht nach Feiern.
Seit ein paar Monaten ist der Krieg nun vorbei. Das Leben im Frieden hört sich anders an, leiser. Keine Sirenen warnen mehr vor Bomberangriffen, keine Panzerketten walzen mehr durch die Straßen, kein Hitler, kein Goebbels schallen mehr aus den Volksempfängern, auch der ganz normale Lärm einer modernen Stadt ist versiegt.
In den Ruinen Hamburgs und Essens, Frankfurts und Münchens, Dresdens und Pforzheims, Quadratkilometer auf Quadratkilometer, herrscht an windstillen Abenden jene erstickende, betäubende Ruhe, die nur ein großes Unglück zu hinterlassen vermag.
Grabesstille.
Wenn aber Wind aufkommt, setzt dort ein Heulen und Klappern ein. Böen fahren in aufgebrochene Abwasserrohre, halb abgerissene, längst erkaltete Heizkörper schlagen im Wind hin und her, Ziegel fallen zu Boden. Eine geisterhafte Sinfonie erfüllt die Luft, und in den Kellern, die noch ein Zuhause bieten, versuchen viele Menschen nicht daran zu denken, von welchen Sorgen diese Geräusche künden.
Der Anbruch auch dieses neuen Jahres ist mit der Hoffnung verbunden, dass die Dinge besser werden. 1946 wird das erste Jahr nach der Katastrophe sein, deren Ausmaß in Zahlen kaum zu erfassen ist.
Jeder sechste Deutsche hat den Krieg nicht überlebt. Die Deutschen selbst haben Abermillionen Menschen umgebracht. Mehr als vier Millionen deutsche Soldaten sind noch in Kriegsgefangenschaft. Mehr als zehn Millionen ihrer Landsleute suchen nach Flucht und Vertreibung ein neues Zuhause. Ihr Land ist von den vier Siegermächten zerkleinert, aufgeteilt und besetzt worden. Ostpreußen, Schlesien und Pommern sind an Polen oder Russland gegangen, damit auch viel landwirtschaftliche Nutzfläche. Das Ruhrgebiet ist in weiten Teilen zerstört. Die vier Besatzungszonen wimmeln von Geflüchteten, freigekommenen ausländischen Kriegsgefangenen, ehemaligen Zwangsarbeitern, entlassenen Soldaten. Dass diese Gesellschaft bislang nicht anarchisch, dass sie nicht panisch geworden ist, ist vielleicht das erste Wunder nach dem Krieg. Ein Wunder, weil die Deutschen führungslos sind und ahnungslos, wohin sie treiben. Woran viele bis eben noch glaubten, ist zerstört. Was sie getan haben, kann nicht wiedergutgemacht werden.
Millionen individueller Neubeginne – und der eine große gemeinsame Neubeginn. Was wird daraus entstehen? Wie wird es aussehen, das neue Deutschland, als Staat, als Gesellschaft, als Idee? Wie wird es sein, das neue Leben?
Für die meisten Menschen sind das Fragen, an die sie im Alltag kaum einen Gedanken verschwenden können. Für sie geht es ums Überleben. Sie haben ihre Heimat verloren und suchen eine Bleibe. Sie haben ihre Liebsten verloren und suchen Trost. Sie haben ihre Arbeit verloren und suchen Wege, an das Nötigste zu kommen. Ob sie etwas zu gewinnen haben, das wird sich in einer Zukunft zeigen, die keiner vorhersehen kann.
Was die Menschen an Habseligkeiten entbehren können, tauschen sie auf dem Schwarzmarkt gegen Speck, Kaffee, Zucker ein. Zigaretten sind hier die Währung; wer raucht, verbrennt Geld. An Sparguthaben auf Banken kommt kaum jemand heran. Gerüchte machen die Runde, dass die Reichsmark abgewertet wird.
Gerüchte kursieren überall. Was die Sowjets mit Berlin vorhaben. Was die Franzosen für das Rheinland planen. Ob Adolf Hitler doch noch lebt. Wie viele Männer aus der Gefangenschaft zurückkommen werden. Ob es eine Rückkehr in die verlorenen Gebiete im Osten gibt. Die Kunst liegt darin, herauszufiltern, welche Gerüchte einen wahren Kern haben.
Es ist eine Zeit großer Härten. Aber auch eine Zeit der Chancen für all jene, die an Chancen glauben. Überall haben sich Frauen und Männer unter Aufsicht der Siegermächte – Amerikaner, Briten, Franzosen, Sowjets – an die Arbeit gemacht. Sie beginnen die Verwaltung zu organisieren. Zerstörte Fabriken herzurichten. Mitstreiter, Kapital, Genehmigungen zu sammeln, um Unternehmen zu gründen. Felder zu bestellen, auch auf Friedhöfen, in Parkanlagen und selbst auf der Rasenfläche vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Sie geben Zeitungen und Zeitschriften heraus. Sie drehen Filme, führen Theaterstücke auf, geben Konzerte, spielen Fußball. Sie bereiten Wahlen vor, um die Demokratie wiederzubeleben, die der Nationalsozialismus erstickt hatte.
Mit dem Kriegsende mag das Chaos gekommen sein, aber auch die Träume sind wieder zurück.
Willy Brandt, 32, träumt im Exil in Norwegen von einer Karriere in der SPD. Die Berliner Schauspielerin Hildegard Knef träumt von einer zweiten Karriere im Film, 20 Jahre alt ist sie gerade geworden, am 28. Dezember. Fritz Walter aus Kaiserslautern, 25, trainiert eine Fußballmannschaft französischer Soldaten, damit er mit seinen Männern wieder auf dem Betzenberg spielen darf. Marion Gräfin Dönhoff, 36, aus Ostpreußen geflohen auf einem Wallach, sucht einen Job, irgendwas mit Schreiben. Erich Honecker, 33, träumt von einem neuen Deutschland. Grete Schickedanz, 34, will das Unternehmen Quelle neu aufbauen. Beate Uhse, 26, ihre Familie wiederfinden. Bernhard Grzimek, 36, wird seinen Frankfurter Zoo so richtig zur Attraktion machen. Und der 69-jährige Konrad Adenauer überlegt, wie er die neuartige CDU als konservative Volkspartei etablieren kann.
Die alliierten Besatzungsoffiziere versuchen derweil herauszufinden, auf welche Deutschen sie bei dem Wiederaufbau setzen können und auf welche eher nicht. Sie nennen den Prozess »Entnazifizierung«, als hätte es sich beim Nationalsozialismus nicht um eine Ideologie, sondern um eine ansteckende Krankheit gehandelt. Für einige der namhaftesten Größen der NSDAP hat in Nürnberg der Prozess begonnen – angeklagt ist unter anderem der frühere Reichsmarschall Hermann Göring; noch in diesem Jahr sollen die Urteile gesprochen werden. Viele seiner früheren Anhänger laufen in Deutschland aber weiter frei herum, darunter Millionen Mitglieder der aufgelösten Partei. Die meisten von ihnen tun nun so, als wäre ihnen das nationalsozialistische Gedankengut schon immer suspekt gewesen.
Der, den sie als »Führer« verehrten, ist seit dem 30. April letzten Jahres tot, acht Monate liegt das nun zurück. An die Stelle der NS-Propaganda war zunächst ein Vakuum gesellschaftlicher Verständigung getreten. Jetzt verschaffen sich erste Politiker, Rundfunksender und Zeitungsredaktionen wieder Gehör. Wer wird im Land die Debatten bestimmen, die es ja unbedingt braucht, wer übernimmt politisch und gesellschaftlich Verantwortung, wer darf es, seitens der Sieger, überhaupt?
Ein Jahr steht bevor, das die Deutschen und das ganze Land auf lange Zeit prägen könnte. Was nun geschehen wird, im ersten Jahr nach dem Krieg, ist nicht zwangsläufig. Ob die Alliierten einen gemeinsamen Weg finden oder sich entzweien, ob die Wirtschaft zerstört oder aufgebaut wird, ob es friedlich bleibt oder zu Gewaltausbrüchen kommt: Alles erscheint denkbar. Alles ist möglich.
Deutschland zu Beginn des Jahres 1946, das ist ein Land zwischen Spannung und Apathie, ein Land, das dringlichst auf etwas zu warten scheint.
Ein Land in der Schwebe.