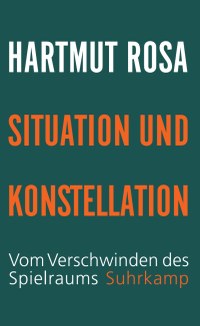Serbische Polizisten auf der Straße & Madonna im Radio
Prishtina, 1994
»Era, wir sehen dich. Geh ins Bett. Es ist spät. Und kalt. Du musst nicht immer alles mitbekommen, was wir hier so machen. Und stell die Musik leiser. Nicht alle mögen deine Madonna. Oder willst du, dass die serbischen Polizisten unsere Wohnung durchsuchen, weil sie denken, es geht uns zu gut?«, sagte Tante Jehona zu mir und schaute mich nicht mal dabei an.
Wenn sie so mit mir sprach, zuckte es überall in meinem Bauch. Nicht, dass ich Angst vor ihr hatte, aber sie fand immer wieder Wege, mir den Spaß zu verderben. Das fand ich total gemein. Eigentlich sollte sie an diesem Abend auf mich aufpassen, da meine Eltern auf eine Party gingen. Ich war nicht begeistert. Denn ich wusste, dass Tante Jehona nichts davon machen würde, was meine Eltern ihr sagten. Wie zum Beispiel mir einen Hagebutten-Tee machen, mit mir Karten spielen, mir was vorlesen und mich anschließend ins Bett bringen. Sie tat nichts davon. Sobald meine Eltern die Wohnung verließen, behandelte sie mich wie Luft. Sie rief ihre Busenfreundin Shota an, die zufällig innerhalb von zehn Minuten zu uns kam, so als ob sie den ganzen Tag nur darauf gewartet hätte. Tante Jehona kochte zwei Tassen Mokka-Kaffee, den sie schnell tranken. Dann drehten sie die Tassen um, schüttelten sie ein bisschen und warteten sitzend auf der alten orangefarbenen Couch im Wohnzimmer. Nach fünf Minuten ging es los. Tante Jehona ließ sich von Shota die Zukunft aus der Kaffeetasse vorlesen. Beide lachten laut und redeten so, als würden sie sich mit der Tasse unterhalten. Ich stand neben der Wohnzimmertür, hatte meinen blauen Schlafanzug schon an und konnte nicht glauben, was diese zwei da machten: »Shota, kannst du wirklich darin lesen?«, fragte ich.
»Ich lese aus dem Kaffeesatz«, sagte sie beiläufig.
»Na und wie soll das gehen?«, fragte ich skeptisch.
»Na, einfach den Figuren auf dem Boden nachgehen, hier ist ein Baum, sehe ich grad«, dann schaute sie Tante Jehona an und grinste.
Ich näherte mich den beiden und frage: »Darf ich auch mal gucken?«, immerhin erschien mir diese Aktion doch sehr unlogisch.
Shota zeigte mir die Tasse: »Siehst du, hier unten ist der Baum, gegenüber ist ein Kreuz, und da unten ist das Herz«, sagte sie im Ernst.
Ich hob die Augenbrauen: »Ich sehe eigentlich nur schwarz, sonst nix. Ich glaube, euch ist langweilig, deswegen macht ihr sowas«, kam aus meinem Mund.
Tante Jehona verdrehte die Augen: »So, jetzt reicht es mir mit dir – du nervst. Geh sofort ins Bett. Putz dir aber vorher die Zähne. Und keine Musik. Verstanden?«
Ich tat was sie sagte. Ging genervt ins Bad. Ich hörte nur noch von weitem, wie sie zu Shota sagte: »Meine Nichte ist so anstrengend. So klein und so eine große Klappe. Seit sie diese Madonna im Radio gehört hat, ist sie nicht mehr auszuhalten. Ich glaube, Era wird meiner Schwester noch viel Ärger machen.«
Dann lachten beide über mich.
Am liebsten hätte ich den beiden gesagt, dass sie sich ein Vorbild an Madonna nehmen könnten. Die sitzt bestimmt nicht nur so rum und lässt sich aus einer Kaffeetasse vorhersagen, ob sie eines Tages heiraten wird oder nicht. Das war nämlich der Grund, warum Tante Jehona so gerne den Kaffeesatz befragte. Sie wollte wissen, wer ihr Mann werden würde. Als ob die Kaffeetasse ihr auf so eine Frage eine Antwort geben würde.
Aber ich traute mich nicht, so mit ihr zu reden. Ich ging in mein Zimmer, machte die Musik aus, kuschelte mich unter meine rotblaue Decke und versuchte zu schlafen, während ich Madonnas Lied: »Like a Prayer« summte.
Es war Nacht und stockdunkel. Ich wollte nicht, dass die serbischen Polizisten unsere Wohnung durchsuchten.
Aber eine Sache nervt mich schon sehr lange: Tante Jehona behandelte mich wie eine Fünfjährige. Dabei bin ich schon zwölf und verstehe jede Menge.
Am nächsten Morgen saß ich in unserer kleinen, dunklen Küche und frühstückte. Ich aß Schokobrötchen, die Oma Emine für mich gebacken hatte. Alle sagten dazu llokums, nur ich nannte sie Schokobrötchen, weil Oma sie für mich mit Schokoladencreme füllte. Am Morgen schmeckten sie besser als je zuvor. Meine Mutter war dabei, ihre große grüne Stofftasche zu packen. Sie wollte, nachdem sie mich in der Schule abgesetzt hatte, noch einkaufen gehen. Sie sah um die Augen ganz schön müde aus. Wahrscheinlich ging die Party gestern lang.
Ich kaute weiter, mein Mund war voller Schokoladencreme, ich schloss die Augen, um alles in meinem Mund noch besser zu schmecken. Dabei dachte ich nach. Es gab eine Sache, die ging mir schon lange nicht mehr aus dem Kopf.
Mit geschlossenen Augen fragte ich meine Mutter: »Warum geht’s Tante Jehona so schlecht?«
»Warum hast du die Augen zu?«, kam als Gegenfrage von meiner Mama.
»Weil mir die Schokolade so besser schmeckt.«
»Ah, so ist das«, sagte meine Mutter. Ich hörte wie sie lächelte.
»Also, sag, warum geht’s Tante Jehona so schlecht?«
»Ich habe es noch nicht bemerkt, dass es ihr schlecht geht. Wie kommst du darauf, Era?«
Ich schaute sie an: »Weil sie immer genervt ist. Egal, was ich ihr sage, sie flippt total schnell aus.«
Mutter lächelte, während sie mir die Schokolade aus dem Gesicht wischte: »Tante Jehona wünscht sich einen Mann und findet keinen, der ihr gefällt. Vielleicht meinst du das. Aber das wird sich bestimmt legen. Wenn sie einen gefun- den hat, geht’s ihr bestimmt besser.«
Ich nahm ein zweites Schokobrötchen, der gute Geschmack explodierte fast in meinem Mund. Oma Emine verstand es einfach, die leckersten Schokobrötchen der Welt zu backen. Sie mischte etwas Zimt in den Teig. Die Füllung machte sie aus einer Eier-Vanille-Schokocreme. Die Brötchen wurden frittiert, anschließend in Puderzucker getunkt. Einfach perfekt. Ich aß noch den letzten Bissen, wischte mir den Mund und fragte etwas, worauf mir nicht einmal meine Mutter eine Antwort geben konnte: »Warum braucht Tante Jehona einen Mann, damit es ihr bessergeht, kann es ihr ohne Mann nicht gut gehen?«
»Das kannst du jetzt noch nicht verstehen, dafür bist du zu jung. Wenn du etwas älter bist, dann erkläre ich dir das«, sagte sie blitzschnell.
Sie nahm meinen Teller, meine Milchtasse, legte sie in die Spüle, trug ihren roten Lippenstift auf und schnappte ihre grüne Tasche: »Los Era, wir müssen, die Schule wartet.«
Als wir auf der Straße waren, auf dem Weg zur Schule, wir gingen immer zur Fuß hin, weil es nicht sehr weit von unserer Wohnung war, hörte ich Madonnas »True Blue«. Egal, wo ich ging, ich hatte immer meinen Walkman und meine Madonna-Kassette dabei. Der Walkman war ein Geschenk von meinen Eltern zum zwölften Geburtstag. Madonnas Lieder hatte mir Onkel Agim auf einer Kassette aufgenommen.
Meine Mutter hatte mir an diesem Tag eine blaue Schleife in die Haare gebunden, so dass ich mich genauso fühlte, wie in Madonnas Lied. Auf der Straße war kaum ein Mensch. Es war Herbst, der Wind sang mit den Bäumen, die rotbraunen Blätter fielen vom Himmel. Der Boden war nass, voller Löcher und Schlamm, man musste aufpassen, wo man hintrat. Der Schlamm war wie Sekundenkleber, man bekam ihn sehr schlecht von den Schuhen. Drum he- rum waren ein paar Häuser zu sehen, sonst war alles wie ausgestorben. Aus der Ferne konnte ich ein paar serbische Polizisten erkennen. Sie hielten ihre Gewehre fest, klammerten sich sogar an sie, so als ob sie vor irgendetwas Angst hatten. Aber mir war das egal. Ich alberte herum, tanzte und sang, als würde mir die ganze Stadt gehören. Als wir ihnen näherkamen, sagte meine Mutter, ich solle leise sein:
»Wir wollen die Polizisten nicht einladen, in unsere Taschen zu gucken. So verlieren wir noch mehr Zeit und du kommst zu spät in die Schule.«
Ich befolgte ihren Rat, hörte auf zu singen und machte den Walkman aus.
Die Polizisten hielten uns trotzdem an. Es waren drei. Alle drei trugen schwarzeblaue Klamotten, auf dem Kopf hatten sie Polizeihelme. Ihre Stimmen waren laut. Ihre schwarzen Schuhe voller Dreck, als wären sie tagelang durch Matsch gelaufen. Ich hatte keine Angst. Sie sprachen eine Art Geheimsprache mit meiner Mama. Sie musste ihre grüne Tasche öffnen, ihren Ausweis zeigen und ein paar Fragen beantworten. Sie war total nett zu ihnen, verzog keine Miene.
Während sie redeten, sah ich, dass die Polizisten die roten Schuhe der Mama musterten. Sie warfen sich gegenseitig Blicke zu und grinsten sich an.
Der eine Polizist, der ein bisschen weiter weg stand, wollte wissen, was auf meinem Walkman läuft.
Meine Mutter antwortete freundlich: »Madonna.«
Der Polizist schaute mich an und zwinkerte mir zu. Einer von ihnen sagte was über Madonna zu seinen Kollegen und alle lachten sehr laut. Dann sagte er noch etwas Knappes zu meiner Mutter und wir durften gehen.
»Warum kann ich kein Serbisch, Mama?«
»Weil du es nicht können musst.«
»Aber warum nicht?«
»Weil Albanisch heute erlaubt ist. Früher mussten wir Serbisch lernen.«
»Ah so«, kam es aus mir raus. »Dann habe ich ja so richtig Glück gehabt. Ich mag Serbisch eh nicht. Diese Sprache ist bescheuert.«
»Keine Sprache ist bescheuert, Era. Je mehr Sprachen der Mensch spricht, desto mehr Welten kennt er«, erklärte mir meine Mutter.
»Ich mag nur Englisch«, während ich das sagte, versuchte ich den Schlamm auf der Straße tanzend zu umgehen.
»Und was wollten die Polizisten von dir wissen, Mama?« »Wo wir hingehen und was wir heute so vorhaben.« »Hä, die sind aber doof. Wir gehen doch nur in die Schule. Warum wollen sie sowas wissen?«
»Weil das ihr Job ist und weil sie sonst nix zu tun haben«, erklärte mir Mama.
»Die haben aber eine blöde Arbeit, Mama.« Dann richtete sie meine blaue Schleife.
»Also, du und deine Schleife seht aus wie ein Weihnachtsgeschenk.«
»Aber ich bin doch ein Geschenk Mama«, sagte ich patzig zu ihr.
Danach musste sie lachen: »Und frech bist du, aber das steht dir gut«, dann gab sie mir einen Kuss auf dem Kopf.
»Wenn du willst, kannst du jetzt Madonna weiter hören, Era.«
»Okay.« Ich drückte auf den Walkman. »Welches Lied läuft?«, wollte sie wissen.
»Immer noch True Blue, konnte ich ja nicht zu Ende hören«, sagte ich laut.
»Du und deine Madonna. Zum Glück hat Onkel Agim alles aufgenommen. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen.« »Onkel Agim ist der beste Onkel der Welt«, sagte ich im Ernst.
Zum ersten Mal hörte ich Madonna im Radio singen. Da war ich in der Küche und aß Milchreis mit Erdbeermarmelade. Es war Samstag, 12 Uhr, es war September, es regnete. Da war ich elf. Als ich »Material Girl« hörte, kribbelte es überall. Nase, Hals, Bauch, Beine, Po. In mir ging ein Feuerwerk ab. Ich fing an, in der Küche herumzutanzen und herumzuspringen. Ich weiß nicht, was es war. Aber es war etwas, das mein ganzes Herz umarmte. Seitdem liebe ich Madonna. Ihre Musik ist wie eine beste Freundin, immer bei mir. Sie gibt mir Kraft und macht mich stark, egal wie gemein die Erwachsenen zu mir sind. Onkel Agim nimmt seitdem Madonnas Lieder für mich auf, damit ich keins verpasse. Er findet Madonna auch super. Und freut sich, neue Lieder zu entdecken, mit denen er mich überraschen kann. Ich glaube, Onkel Agim hat mich doll lieb.