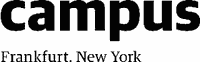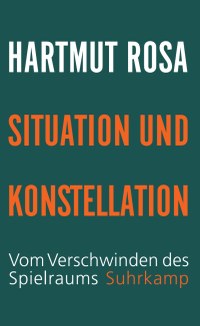Shoppen fürs Klima?
Kaufen müssen wir alle. Und dabei wissen wir sehr genau: Konsum zerstört die Umwelt, Konsum hat kein Gewissen. Für den Glitzer in unseren Lippenstiften arbeiten Kinder in indischen Minen, für unseren Ketchup bauen Zwangsarbeiter in China Tomaten an, für unsere Milch leben Kühe angebunden in engen Ställen, in denen sie sich nicht bewegen können. Unsere Waschmittel spülen jede Menge Chemikalien in die Meere, unser Hunger auf Erdbeeren und Avocados trocknet die Anbauländer aus. Die Verpackungen, die unser Konsum mit sich bringt, bilden inzwischen riesige Plastikinseln in den Meeren. Und unser Strom? Ist selten so »öko«, wie die Energieanbieter versprechen.
Die Industrie verkauft uns Umweltsünden – und wir kaufen sie. Weil wir sie selten überhaupt erkennen. Denn: Kein Hersteller, der chinesische Tomaten in seinem Ketchup verarbeitet, will, dass wir das wissen. Deswegen vertuscht er diesen ökologischen Irrsinn. Nur wie? Und wie verstecken Kosmetikhersteller Mikroplastik in ihren Tuben? Wie täuscht die Milchlobby Klimaschutz vor, obwohl Rinderhaltung einer der massivsten Treiber der menschengemachten Klimakrise ist? Dieses Buch zeigt, wie wir die Tricks der Industrie erkennen – und was wir dagegen tun können. Wie wir bewusst kaufen können, ohne dabei ständig ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Dabei bleiben wir bewusst im Spannungsfeld zwischen »Was soll es schon bringen, wenn ich festes Shampoo kaufe?« und den großen, notwendigen Veränderungen, für die Politik und Industrie verantwortlich sind. Wir wälzen die Verantwortung nicht auf die Einzelne oder den Einzelnen ab, hängen nicht dem Irrglauben an, dass individuelle Entscheidungen das Klima retten können. Aber einfach zurücklehnen? »Es gibt kein richtiges Leben im falschen«…? Sosehr wir Adorno schätzen – ein bisschen weniger falsch wäre ja schon mal ein Anfang.
Wir sehen Politik und Industrie in der Verantwortung, wissen aber auch, dass Veränderung im Großen durch Konsumveränderung im Kleinen möglich ist. Denn: Bio-Lebensmittel im Discounter gibt es nur, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher immer häufiger zu Bio gegriffen haben. Die Auswahl an veganen Ersatzprodukten ist nur so groß, weil immer mehr Menschen immer häufiger auf Fleisch verzichten. Und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz kommt nur, weil das Bewusstsein dafür gestiegen ist. Weil Umwelt- und Verbraucherschützer so genau hingeschaut haben und immer wieder so laut auf die Missstände am anderen Ende der Lieferkette aufmerksam gemacht haben. Denn wenn unsere Tests bei ÖKO-TEST eines seit Jahrzehnten zeigen, dann das: Die Industrie bewegt sich nicht freiwillig. Bewegung entsteht durch Druck – von Verbraucherschützerinnen, Umweltschützern und von jedem und jeder Einzelnen. Und von uns bei ÖKO-TEST. Es hat sich schon viel bewegt. Und es wird sich noch viel mehr verändern. Denn wir werden nicht aufhören, Produkte zu testen, Klimalügen und Greenwashing aufzudecken und die Industrie immer wieder laut zu fragen: »Gibt’s das auch in Grün?«
Wir stellen in diesem Buch die Ergebnisse vieler Tests vor. Weitere Informationen zu vielen der ausgewählten Tests finden Sie auf gibts-das-auch-in-gruen.de. Wenn Sie Ideen haben, was wir uns unbedingt einmal vornehmen sollten, wenn Sie sich über grün gewaschene Produkte ärgern, die alles andere als ökologisch sind, oder Sie uns von Ihren Erfahrungen mit wirklich grünen Produkten erzählen möchten – schreiben Sie uns unter gibts-das-auch-in-gruen@oekotest.de. Wir sind gespannt auf Ihre Nachrichten, Geschichten und Hinweise.
Was jetzt also tun? Komplett vegan leben? Klamotten nur noch gebraucht kaufen? Überhaupt kein Plastik mehr verwenden? Schreckt viele ab – uns übrigens auch. Deswegen wollen wir zeigen, wie wir in kleinen Schritten zu einem gesunden und nachhaltigen Konsum gelangen. Und wie wir im Großen Politik und Industrie dazu bewegen, die notwendigen Änderungen umzusetzen. Was bringt das? Für die Umwelt und für unsere Gesundheit? Was sagen unsere Tests dazu? Was haben wir über die Jahre herausgefunden? Und wie setzen wir es um?
1. Weit gereister Irrsinn
Wir können alles haben, immer. Erdbeeren im Dezember, Rosen im Februar und Bananen das ganze Jahr über, obwohl bei uns keine einzige Banane wächst. Gäbe es keinen globalen Handel, könnten wir überhaupt nie Bananen essen. Wir könnten keine Rosen zum Valentinstag verschenken und Erdbeeren im Dezember hätten wir auch nicht. Auf die Erdbeeren zu Weihnachten könnten wir vielleicht gut und gerne verzichten. Aber sie sind nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Denn dass Dezembererdbeeren nicht aus regionaler Produktion kommen, das leuchtet jeder Verbraucherin, jedem Verbraucher unmittelbar ein. Wir können es erkennen, weil die Händler das Herkunftsland auf der Verpackung oder dem Schild an der Obsttheke angeben müssen. Doch bei vielen anderen Produkten tappen wir im Dunkeln. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass auch saisonunabhängige hochverarbeitete Lebensmittel dreimal um die Welt gereist sein könnten, bevor sie in unserem Einkaufskorb landen. Denn die Industrie importiert längst nicht nur Dinge, die es bei uns nicht gibt.
Die Industrie importiert genauso das eher saisonunabhängige Tomatenmark aus China, Hühnerfleisch aus Brasilien und Honig aus Uruguay. In den allermeisten Fällen ist der Grund dafür ganz einfach: Das Lebensmittel in einem anderen Land zu produzieren und dann um die halbe Welt zu verschiffen, ist immer noch günstiger, als es bei uns herzustellen.
Ja, und? Ist das nicht einfach okay in einer globalisierten Welt? Internationale Arbeitsteilung eben. Profitieren davon nicht alle? Wir, weil wir (noch mehr) Tomatenmark bekommen, und China, weil China Geld damit verdient, uns Tomatenmark zu verkaufen? Ja, na ja! Also einmal ganz von dem ökologischen Irrsinn abgesehen, das Mark per Schiff um die halbe Welt zu schicken, gibt es da noch einen ganz anderen Aspekt.
Wann immer ein Lebensmittel sehr billig ist, stellt sich die Frage: »Wer bezahlt dafür, wenn nicht wir?« Und eines ist sicher: Einer zahlt. Im Falle der Tomaten sind es etwa Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, die die Tomaten auf den Feldern im chinesischen Xinjiang anbauen. Im Falle der Chicken Nuggets sind es die Hühner – und die Menschen, die in Polen oder Brasilien das Fleisch unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen zerlegen. Und im Falle der Rosen, ein Strauß für 1,99Euro im Discounter, sind es Arbeiterinnen und Arbeiter in Kenia, die bei uns längst verbotene Spritzmittel ohne Schutzkleidung sprühen. So ganz okay ist das also nicht – zumindest längst nicht immer.
Deswegen schauen wir bei ÖKO-TEST gerade bei herkunftskritischen Lebensmitteln genau hin: Woher stammen die Produkte? Wie wurden sie angebaut und von wem, unter welchen Bedingungen? Eine Herkunft, die sich überraschend häufig durch viele Lebensmitteltests zieht, ist China. Dass Technik, Spielzeug und Möbel oft aus China kommen, ist klar. Aber Weinblätter, Bio-Kidneybohnen, Bio-Erdnüsse, Honig? In unserem Test Weinblätter 2023 stammten fünf der 20 Produkte gesichert aus China, zudem wollten fünf Hersteller die Karten nicht auf den Tisch legen, was die Herkunft betrifft. Und nur ein einziges Produkt kam tatsächlich aus Griechenland, wie die netten blau-weiß gehaltenen Verpackungen der »Dolmadakia« das häufig suggerieren. Von den sechs Bio-Kidneybohnen-Marken, die wir 2021 in unserem Test Kidneybohnen überprüft haben, stammten alle (!) aus China. Bio, wohlgemerkt. Die konventionellen hingegen kamen aus den USA, Kanada, Argentinien und Italien. Gleiches galt für die Erdnüsse im selben Jahr: Vier von fünf Bio-Erdnuss-Marken bezogen ihre Nüsse aus China, die konventionellen stammten fast alle aus Argentinien. Bei den »Iglo Kräutern italienischer Art« in unserem Test Tiefkühlkräuter stammte der Knoblauch aus China, die »Freshona 8 Kräuter« von Lidl kamen zwar nicht aus China, aber aus dem Rest der Welt – Dill aus Indien, Petersilie aus Großbritannien, der »Rest« aus Frankreich und Polen. Dill aus Indien? Lidl, echt jetzt? Was ist da los?
Und der Honig? Gerade einmal drei der von uns 2022 getesteten Produkte kamen aus Deutschland. Die anderen waren Mischungen, oft mit der alles und nichts sagenden Deklaration EU/Nicht-EU – über diese Nichtaussage ärgern wir uns an späterer Stelle noch mehr. Auch bei den Leinsamen überraschte uns die Herkunft. Fünf der 20 Produkte im Test Leinsamen 2022 stammten aus Indien – auch das allesamt Bio-Produkte –, acht weitere aus Kasachstan. Aus Deutschland kam kein einziges, nur eines, immerhin, aus Österreich, ein anderes aus Frankreich.
Schauen wir uns ein paar besonders extreme Beispiele an: Tomaten aus China, Erdbeeren aus Spanien, Ägypten und Marokko, Rosen aus Kenia und Honigmischungen aus der ganzen Welt.
Tomaten aus China
Machen Sie doch mal Ihre Kühlschranktür auf. Wenn dort eine Flasche Ketchup steht, eine Tube Tomatenmark liegt oder im Tiefkühlfach eine Fertigpizza auf den Moment wartet, in dem Sie schwach werden – wissen Sie, woher die Tomaten stammen, die darin stecken? Schauen Sie sich die Produkte einmal an. Finden Sie Hinweise? Am ehesten vielleicht noch bei dem Mark – je stärker verarbeitet die Lebensmittel sind, je mehr Zutaten zusammengemischt werden, desto schwieriger ist es, die Herkunft der Rohstoffe zurückzuverfolgen. Meist steht gar nichts da, das ist auch erlaubt – die Hersteller müssen die Herkunft ihrer Rohstoffe nur unter ganz bestimmten Bedingungen nennen. Bio-Hersteller beispielsweise müssen das. Aber so eine Angabe wie »EU« oder »Nicht-EU« reicht auch dann meistens aus. Fast ein bisschen wild wird es, wenn Hersteller »EU/Nicht-EU« auf die Verpackung schreiben, als seien Jupiter oder Mond eine weitere mögliche Herkunft. Auf Ihrem Ketchup steht nichts? Auch auf der Pizza nicht? Die Wahrscheinlichkeit, dass in Ihrem Kühlschrank auch chinesische Tomaten liegen, ist gar nicht mal so klein. Und das ist nicht »nur« ein ökologisches Problem, sondern leider auch ein menschenrechtliches.
China ist der größte Produzent von Tomaten weltweit. Das Land produziert auf einer Fläche von mehr als 1 Million Hektar Tomaten, die Produktionsmenge übersteigt die Italiens etwa um das Zehnfache. Das mag jetzt überraschen, weil Tomaten ja nicht unbedingt auf dem täglichen Speiseplan der chinesischen Küche stehen. Die Chinesen bauen diese riesigen Mengen auch nicht für sich selbst an, sondern für den Export. Und diese Tomaten schicken sie zu Mark verarbeitet mit Containerschiffen in die ganze Welt – auch zu uns, auch nach Italien.
Die Ironie der Geschichte: Die Italiener klagen heute über die billige Konkurrenz Chinas – dabei waren sie es, die den Chinesen die Maschinen und das Know-how in den 1990er-Jahren gebracht haben, weil sie eben billiges Tomatenmark kaufen wollten. Und den Preis der Chinesen, den schlägt nun einmal keiner. Die Produktionskosten in China sind viel niedriger, darunter auch die Arbeitskosten. Denn wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Feldern in China bezahlt werden, dann bekommen sie einen Hungerlohn. Die Betonung liegt auf wenn, denn in der Hauptanbauregion Chinas, in Xinjiang, arbeiten auch Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter. Uigurinnen und Uiguren, die in Lagern festgehalten werden und überhaupt kein Geld für ihre Arbeit bekommen – Sklavenarbeiter. Menschenrechtsorganisationen schätzen die Zahl der inhaftierten Muslime auf über eine Million. Das macht es, sarkastisch gesprochen, natürlich relativ einfach, billig zu produzieren. Hinzu kommt: Die Umweltauflagen sind niedrig, der Schiffstransport günstig. Und tatsächlich gibt es auch ökologisch gesehen einen positiven Aspekt: Die Anbaubedingungen in Xinjiang sind klimatisch ideal – energetisch intensive und damit auch teure Gewächshäuser wie in Holland oder Deutschland sind nicht nötig. Doch das wiegt die katastrophalen menschenrechtlichen Zustände ja nicht auf.
Die USA etwa haben 2022 ein Importstopp für Tomaten und Baumwolle aus Xinjiang beschlossen, wegen menschenrechtlicher Bedenken. Bei uns und in der ganzen EU stehen weiterhin Ketchups, Grillsoßen und Co. mit Tomaten aus Xinjiang in den Supermarktregalen. In der ganzen EU? Nein, nicht in Italien. In Italien läuft das Geschäft mit den chinesischen Tomaten ganz, ganz schlecht. Denn Italien hat ein echtes Herkunftskennzeichnungsgesetz. In Italien muss auf einer Dose Tomaten stehen, dass sie aus China kommen, wenn sie aus China kommen. Und das kommt bei den Italienern nur so mittelgut an – chinesische Tomaten verkaufen sich nicht im Land der »pomodori«.
Warum Italien dann einer der größten Abnehmer von chinesischem Tomatenmark ist? Weil Italien die importierten Tomaten wieder exportiert, nachdem es die Produkte »veredelt« hat. So nennt man das fröhlich-euphemistisch in der Branche, wenn man etwa ein bisschen Salz dazu mischt und das Mark dann neu verpackt. Italienisches Fähnchen drauf, fertig sind die »pomodori italiani«. Italien exportiert 100 Prozent der aus China importierten Tomaten wieder als »italienische« Tomaten in den Rest der Welt. Bis April 2020 auch in den Rest der EU. Das geht so jetzt nicht mehr, zumindest nicht so ganz einfach.
Wie es geht, das regelt die EU-Verordnung mit dem entspannt klingenden Namen »Durchführungsverordnung (EU) 2018/775 der Kommission vom 28. Mai 2018 mit den Einzelheiten zur Anwendung von Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel hinsichtlich der Vorschriften für die Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts der primären Zutat eines Lebensmittels«. Darin steht, vereinfacht: Hersteller dürfen weiterhin mit einer bestimmten Herkunft eines Lebensmittels werben, wenn das Lebensmittel nicht aus dem beworbenen Land stammt – aber, und das ist der Unterschied zu vorher, seit 2020 muss irgendwo auf der Verpackung im Kleingedruckten stehen, dass die sogenannte Primärzutat eben nicht aus dem entsprechenden Land stammt.
In unserem Beispiel bedeutet das also: Wenn die Italiener chinesisches Tomatenmark in der EU verkaufen wollen, dürfen sie das – wenn die Verpackung nicht den Eindruck erweckt, dass die Tomaten aus Italien stammen. Und selbst das dürfen sie, also italienische Fähnchen draufmalen und »pomodori di nonna« draufschreiben. Nur muss dann irgendwo im Kleingedruckten stehen, dass die Tomaten »nicht aus Italien« stammen. Diese Nichtangabe genügt. Dass die Tomaten in dieser italienischen Verpackung aus China kommen, das muss nirgendwo stehen. Die Latte hängt also nicht hoch.
Wenn nun aber auf einer Tomatensoße steht: »100 Prozent italienische Tomaten«, ist dann alles fein? Na ja! Dann kommen die Tomaten zwar aller Wahrscheinlichkeit nach aus Italien. Aber gerade im Süden Italiens liegt leider auch einiges im Argen im Anbau. Zwar arbeiten dort keine Zwangsarbeiter auf den Feldern, aber eben viele Menschen, die illegal dort leben, die für einen Hungerlohn in der sengenden Hitze Tomaten pflücken. Von den paar Euro, die sie am Tag verdienen, müssen sie noch Geld an die »caporali« abdrücken: Schlepper, die diese Arbeitskräfte vermitteln. Der internationale Verbund von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen Oxfam hat eine Studie zu den Arbeitsbedingungen auf den süditalienischen Feldern veröffentlicht. Das krasse Ergebnis, weil, immerhin, wir reden hier von der EU: Die Arbeiterinnen und Arbeiter bekommen im Schnitt nicht einmal 4Euro für 300 (!) Kilo gepflückte Tomaten. Sie arbeiten oft zehn Stunden oder mehr ohne Pause. Und viele von ihnen leben in Gettos ohne fließend Wasser und Strom. Diese dunkle Seite des Tomatenanbaus in Süditalien, die ist immer wieder Thema in den italienischen Medien. Immer wieder schreit die Öffentlichkeit auf. Und immer wieder tut sich nichts.
In Italien gibt es, wie bei so vielem, auch im Tomatenanbau eine scharfe Trennlinie zwischen Nord und Süd. Im Norden sind die Arbeitsbedingungen vielfach okay, überhaupt geschieht viel automatisiert und es gibt viel Bio-Anbau. Wer also guten Gewissens Tomaten essen will, kann darauf achten, dass es auf der Verpackung Hinweise auf eine norditalienische Herkunft gibt.
Zugegeben, das war jetzt alles ziemlich düster. Zeit also, noch etwas düsterer zu werden. Denn die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den italienischen Feldern, die dort oft illegal leben, kommen häufig aus Afrika. Und die Tomaten, die sie dort in der sengenden Hitze für einen Hungerlohn pflücken, die werden auch in ihre Heimat geschickt. Nicht die frischen, die guten. Die landen bei uns. Aber die, die unseren Ansprüchen eben nicht genügen, werden in Afrika so billig verscherbelt, dass sie die lokalen Märkte zerstören.
Jean-Baptiste Malet, ein französischer Autor, der zwei Jahre lang für sein Buch Das Tomatenimperium die ganze Welt bereist hat, schreibt, dass der Tomatenabfall, der nach Afrika verkauft werde, in der Branche »black ink«, schwarze Tinte, heiße. So nenne man ein Konzentrat, das so alt sei, so oxidiert, dass es seine rote Farbe längst verloren hat. Wie der Name schon sagt: Es ist schwarz. Manche Hersteller würden die schwarze Tinte mischen, mit guten oder zumindest etwas besseren Tomaten. Aber das, das sei die Ausnahme. »Die gängigste Methode ist nämlich, das Zeug mit noch günstigeren Zutaten zu panschen, etwa mit Stärke und Sojabohnenfasern, und dann etwas roten Farbstoff hinzuzugeben, damit es frischer aussieht.« Der afrikanische Zoll in Tunesien oder in Algerien entdeckt immer wieder abgelaufene, vergammelte Ware. Immer wieder veröffentlicht die afrikanische Presse diese Meldungen. Und immer wieder passiert nichts.
In aller Kürze: Tomaten
- China ist der größte Produzent von Tomaten weltweit.
- Italien importiert chinesisches Tomatenmark, steckt es in italienisch aussehende Verpackungen und schickt es in den Rest der Welt – als italienisches Tomatenmark.
- Sieht eine Verpackung italienisch aus, steht dort »pomodori« und prangt darauf ein italienisches Fähnchen, kann es sein, dass die Tomaten nicht aus Italien kommen. Das muss dann aber irgendwo im Kleingedruckten stehen.
- Steht auf der Verpackung: »Tomaten 100 Prozent aus Italien«, ist alles fein? Leider nein. Auch in Süditalien sind die Arbeitsbedingungen der Pflückerinnen und Pflücker oft miserabel.
Gibt’s das auch in Grün?
Schwierig. Bei frischen Tomaten wäre es noch relativ einfach – wir könnten raten, dass Sie selbst welche anbauen, dass Sie welche im Hofladen kaufen, natürlich regional, saisonal und bio. Bei verarbeiteten Tomatenprodukten stehen wir Verbraucherinnen und Verbraucher häufig vor großen Hürden, was das Erkennen der Herkunft betrifft – und je verarbeiteter die Produkte sind, desto größer die Hürde. Beginnen wir also mit den am wenigsten verarbeiteten, den geschälten Tomaten aus der Dose oder dem Glas. Die gute Nachricht hier ist, dass diese Produkte unseren Tests nach für gewöhnlich nicht aus China kommen. Die allermeisten stammen demnach aus Italien. Nur wissen wir ja nun: Auch dort gibt es Probleme im Anbau – einen hohen Wasserverbrauch in eher trockenen Gebieten und vor allem menschenrechtliche Probleme, was die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Feldern betrifft. Hier gilt: Die Arbeitsbedingungen in Norditalien sind im Vergleich zu denen in Süditalien recht gut. Wer also guten Gewissens Tomaten essen will, kann auf Hinweise wie »100 Prozent Tomaten aus der Toskana« achten. Bei hochverarbeiteten Produkten wie Ketchups oder Soßen sind die Hürden, vor denen wir stehen, allerdings häufig zu hoch. Da haben wir meist überhaupt keine Chance zu erkennen, woher die Tomaten stammen, die in dem Produkt verarbeitet wurden. Frustrierend? Ja, aber leider legal.
— Autsch! —
- In vielen verarbeiteten Tomatenprodukten wie Ketchups, Grillsoßen oder Pizzen stecken chinesische Tomaten.
- Auf den Feldern in Xinjiang, der chinesischen Hauptanbauregion für Tomaten, arbeiten geschätzt eine Million Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter auf den Feldern – Uigurinnen und Uiguren, die in Lagern festgehalten werden.
- Tomatenabfall, der so vergammelt ist, dass er sich hier nicht mehr verkaufen lässt, landet rot eingefärbt oft in Afrika. Mit den Dumpingpreisen unseres Abfalls können die lokalen Bäuerinnen und Bauern nicht mithalten, ihre Existenzen werden dadurch zerstört.