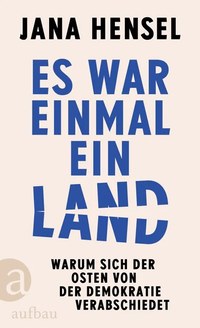BERLIN, EIN SAMSTAG im Dezember 2019, später Vormittag. Igor Levit ist müde. Sein rechter Arm schmerzt, der linke auch, es ist vielleicht nicht der beste Tag, um anzufangen.
Vor zwei Tagen ist er von einer Tour mit der Kammerphilharmonie Bremen zurückgekommen. Hamburg, Wiesbaden, Wien, Bremen, sieben Auftritte in acht Tagen, viermal das Brahms-Klavierkonzert Nr. 1, dreimal Nr. 2. In den Wochen davor spielte er an jeweils vier Abenden die erste Hälfte seines Beethoven-Sonatenzyklus in Hamburg und Luzern, an zwei Abenden vier Sonaten, an zweien fünf. Und dazwischen gab er sein Antrittskonzert als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, auf dem Programm: ein Satz aus einer Sinfonie von Gustav Mahler, danach eine Passacaglia von Ronald Stevenson, anderthalb Stunden lang. Genug Repertoire für ein ganzes Jahr. Oder für drei Pianisten.
Vielleicht wäre es besser, ein paar Tage früher zu beginnen, es wäre leicht, ihn gut aussehen zu lassen. Dann säße Igor Levit jetzt am Flügel, den Schluss des ersten Brahms-Konzerts in die Tasten donnernd, stürmisch, innig, vor Energie strotzend. Danach Applaus. Bravo-Rufe, Ovationen.
So beginnen Bücher über Pianisten.
Und nicht an einem trüben, kalten Samstag in einem Café in Berlin-Mitte, in dem nur der Platz neben dem Eingang noch frei ist.
Aber hilft ja nichts.
Levit verspätet sich, obwohl seine Wohnung nur ein paar Häuser entfernt liegt, er läuft ohne Jacke durch den eisigen Regen. Weder seine Managerin noch seine Presseagentin wissen von diesem Termin, dabei gibt es in Igor Levits Leben beinahe nichts, was nicht über ihre Schreibtische läuft.
Aber er ist nicht beruflich hier. Er hat frei, zwei Wochen, es sind die ersten freien Tage seit September, das nächste Konzert folgt am zweiten Weihnachtstag. »Kann sein, dass ich in den zwei freien Wochen feststelle, ich brauche noch zwölf.«
Er setzt die Brille ab, fährt sich durchs Gesicht.
Wie war die Tour mit den Bremern?
»Okay.«
Er fährt sich noch immer durchs Gesicht.
»Wissen Sie, Klavierkonzerte sind anstrengend. Viel anstrengender als Solo-Abende. Solo-Abende liebe ich sehr, dann habe ich zwei Stunden auf der Bühne, und diese zwei Stunden gehören mir. Kann sein, dass ich es verbocke. Aber es ist meins. Bei einem Klavierkonzert habe ich vielleicht vierzig Minuten, vielleicht auch nur zwanzig. Ich sitze da und kann nichts machen, ich hänge völlig an der Energie des Orchesters. Wenn die stimmt, wird es gut, wenn nicht, wird es schwierig, das weiß ich schon nach den ersten Takten.«
Er knetet die rechte Schulter, verzieht das Gesicht.
Was ist mit dem Arm?
»Geht.«
Jetzt gerade schmerzt der linke fast mehr als der rechte, später erzählt Levit, dass er sich am Vorabend den Musikantenknochen im linken Ellenbogen gestoßen hat, aus Versehen und mit Schwung. Der rechte Arm schmerzt seit Jahren: zu viel Brahms und Beethoven, zu viel von allem.
»Wenn ich später auf die Bühne müsste: kein Problem. Aber heute früh konnte ich kaum Zähne putzen.«
Eigentlich sind wir verabredet, um über ein anderes Thema zu sprechen.
Genauer: über eine Frage.
Levit gehört zu den besten Pianisten seiner Generation, manche sagen: zu den besten des Jahrhunderts, was ein recht undifferenziertes Urteil ist, er selbst hört es nicht gern. Eine Musikkritikerin hat ihm den Superlativ eingebrockt, er kann mit solchen Zuschreibungen wenig anfangen. Das Wort Jahrhundertpianist lässt seine Presseagentin aus allen Interviews streichen.
Zuletzt haben beinahe alle großen Zeitungen seine Gesamtaufnahme der Beethoven-Klaviersonaten besprochen. Vor wenigen Wochen ist in der ZEIT ein großes Porträt über ihn erschienen, jetzt gerade reist ihm Alex Ross, der Musikkritiker des New Yorker, für ein weiteres großes Porträt nach, auch der Stern arbeitet an einem Stück. Der Bayerische Rundfunk plant einen Beethoven-Podcast mit ihm, 32 Folgen, für jede Klaviersonate eine. Im September saß er auf der Bühne des Thalia Theaters und diskutierte mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über das Grundgesetz, er diskutierte auch schon mit dessen Vorgänger Norbert Lammert, neulich war er Gast der Talkshow Maybrit Illner zum Thema Hass im Netz. Mag sein, dass Igor Levit zu den besten Pianisten des Jahrhunderts gehört, er ist in jedem Fall der präsenteste. Und dann gibt es noch seinen Twitter-Account.
Fehlt eigentlich nur ein Buch.
Haha.
Aber im Ernst.
In beinahe allen Texten, Interviews, Podcasts geht es entweder um Igor Levit, den Pianisten, der sich politisch äußert. Oder um Igor Levit, den Twitter-Aktivisten, der im Übrigen auch Klavier spielt. Wäre es nicht an der Zeit zu erzählen, wie beides zusammenhängt, wie es begann und wohin es führt, kurz: warum Igor Levit so klingt, wie er klingt?
Levit schweigt.
Knetet seine Schulter.
Schaut aus dem Fenster in den trüben Vormittag.
»Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lange ich das noch mache. Wie lange ich das noch will.«
Wie lange er was noch will?
»Kann sein, dass es meiner Erschöpfung geschuldet ist. Aber gerade weiß ich’s wirklich nicht.«
Er knetet weiter seine Schulter.
»Mir reicht das alles nicht. Ich bin andauernd auf Reisen, spiele Konzerte und Konzerte und Konzerte, aber nach den Konzerten klopfe ich mir nicht auf die Schulter und sage: ›Guuutes Konzert! Guuuuutes Konzert!‹ Sondern ich komme von der Bühne und frage: ›What’s next?‹ Ich will sofort weiter, ich muss sofort weiter. Ich nehme mir nie Zeit, weil ich ständig Angst habe, nicht genug Zeit zu haben.«
Er lehnt seinen Kopf an die Wand und schließt die Augen. Aber nur kurz.
»Wissen Sie, im Moment ist der Einsatz auch nicht besonders hoch. Was kann schon passieren? Ich kann im nächsten Konzert die Waldsteinsonate statt in C-Dur in G-Dur spielen und in halbem Tempo – wer will mich daran hindern? Oder die Mondscheinsonate zwei Oktaven höher und richtig schnell – na und? Dann können Sie sagen, ich bin ein Arschloch. Ja und? Ich kann bei einem Konzert richtig schlecht spielen, rausfliegen, den Text vergessen. Was passiert dann? Wahrscheinlich kriege ich eine schlechte Kritik, der Veranstalter lädt mich nicht mehr ein, vielleicht werde ich sogar ausgebuht. Sterbe ich daran? Nein. Werde ich verhungern? Auch nicht. Also: Wovor fürchte ich mich?«
Er knetet weiter.
»Mir reicht das nicht. Ich will mehr. Mir reicht ja auch der Flügel nicht, ich spiele dauernd Stücke, die eigentlich zu groß sind fürs Klavier. Warten Sie, ich muss mal eben auf die Toilette.«
Er springt auf, sein Telefon lässt er auf dem Tisch liegen, seine Brille auch. Draußen beginnt es zu schneien, dünn und hässlich und unergiebig. Es ist gleich zwölf Uhr, aber noch gar nicht richtig hell.
»Lassen Sie es uns probieren«, sagt er, als er zurückkommt. Was? »Das Buch. Lassen Sie uns das machen. Ich kann nur wirklich nicht sagen, was ich in ein paar Monaten mache.«
Alles klar.
Ach so: Wollen wir uns nicht duzen?
»Klar«, sagt Igor. »Ich bin Igor.«
Dann schaut er auf sein Telefon und sagt zum Abschied: »So, ich lege mich jetzt wieder ins Bett.«
#
DIE REISE SELBST beginnt schon früher.
Mittwoch, 18. September 2019. Igor betritt die Bühne im Großen Saal der Elbphilharmonie. Auf dem Programm: drei Beethoven-Sonaten und noch eine vierte, Nr. 21 in C-Dur, Opus 53, die Waldsteinsonate. Igor nennt sie: »Das beglückendste Stück Klaviermusik, das ich kenne.«
Über dem Saal liegt Dämmerung, Igor sitzt im Kegel dreier Scheinwerfer, die senkrecht auf ihn herunter strahlen. Von Roger Willemsen stammt der Satz, das Glück sei selten ein reiner C-Dur-Akkord. Die Waldsteinsonate gehört zu den Ausnahmen, sie beginnt mit vierzehn C-Dur-Akkorden, genauer, vierzehnmal dem gleichen Akkord, Allegro con brio, sie fühlen sich an wie ein wohliger Schauer, wie die Unruhe zu Beginn, wie Bauchkribbeln vor dem Start. Wie reines Glück.
Bei vielen anderen Pianisten klingt die Waldsteinsonate wie ein Hürdenlauf, bei dem es nur darum geht, allen Anweisungen möglichst genau zu folgen und dabei nicht zu stolpern. Man kann die Regeln durch die Musik hindurch hören. Igor hingegen lässt die Musik frei. Er stürzt sich in einem so halsbrecherischen Tempo in den ersten Satz, dass man fürchtet, es könnte ihn aus der Kurve tragen. Der Satz ist auskomponierte Geschwindigkeit, Herzklopfen, Vibration. So viele Noten, so viele einzelne Töne in einem einzigen Sonatensatz sind selten. Man kann das Tempo spüren. Ein einziges Mal nur erlaubt Beethoven der Musik, langsamer zu werden. Wenn man ihn fragt, warum so schnell, sagt Igor unumwunden: Weil ich es kann. Und weil Beethoven es verlangt.
Im zweiten Satz bleibt die Musik stehen, die Leichtigkeit hat sich in Schwermut verwandelt. Igor zerlegt die Akkorde so, dass alle Klänge bewegungslos wie Säulen im Raum stehen, die Musik klingt, als hätte nicht Beethoven sie geschrieben, sondern der sehr alte Franz Liszt, jeder Ton kommt direkt aus der Ewigkeit, eine Melodie, die den Ehrgeiz hätte, irgendwohin zu streben, gibt es lange nicht. Die Töne sind Zustand, nichts bewegt sich. Alles ist, was es ist.
Die Musik klingt dreidimensional. Nicht, weil sie aus verschiedenen Richtungen käme, das Werk selbst ist dreidimensional. Die Harmonien erschaffen Flächen und Pfeiler, Räume und Türen hin zum nächsten Raum, es gibt Lichtquellen und Dunkelheit, es gibt Farbe und Temperatur – und dann kommt in den Raum eine Stimme.
Igor gehört nicht zu den Musikern, die hinter das Werk zurücktreten. Er sagt: Ich spiele, ich mache die Regeln. Nicht nur hat er keine Scheu davor, Ich zu sagen – er sagt, es gehe nicht anders.
Es wird allerdings noch eine Weile dauern, bis er herausfindet, wen er meint, wenn er Ich sagt.
Und dann geht, mitten in der Nacht, die Sonne auf, aus dem Nebel des zweiten Satzes lässt Igor eine Melodie aufsteigen und jagt sie durch die Klangtradition verschiedener Epochen, auch jener nach Beethoven, hier klingen Liszt und Rachmaninow, Debussy und Glass, bald bekommt die Musik auch einen Beat, darf man das so spielen? Warum denn nicht, sagt Igor, ohne ihn wäre das Stück jetzt sowieso nicht da. Das Finale beginnt klein, wird größer und ist am Ende kosmisch, aus einer Melodie entspringt eine Welt, am Ende mündet alles in reine Euphorie.
Igor, auf dem Podium der Elbphilharmonie, verbeugt sich.
Spielt eine Zugabe.
Keine Ahnung mehr, welches Stück.
Auf dem Nachhauseweg hallt die Musik nach, das ist oft so nach Konzerten, diesmal aber scheint jeder Ton einen kleinen Abdruck hinterlassen zu haben und die Gesamtheit der Töne einen großen.
Was, bitte, war das denn?
Aus wessen Leben hat Igor hier erzählt: aus seinem? Oder aus denen seiner Zuhörer?
Woher kommen die Farben, die Nuancen, die Kraft?
Warum klingt die Waldsteinsonate, dieses gut zweihundert Jahre alte Stück Musik, so oft einfach nur bewältigt, durchgespielt, meinetwegen: gekonnt? Und heute so natürlich, nein, selbstverständlich, als ginge das alles gar nicht anders, als hätte nicht Ludwig van Beethoven das alles irgendwann notiert, sondern als wäre es immer schon da gewesen und gerade zum ersten Mal hörbar geworden.
Ist das vielleicht schon das ganze Geheimnis? Klingt Igor deshalb so interessant, wie er klingt, weil er nicht einfach nur ein Stück Musik spielt, sondern dabei – mit vollem Einsatz und vollem Risiko – sich selbst mit auf die Bühne bringt?
Denn eindeutig, hier geht es nicht um C-Dur, Viervierteltakt, Allegro con brio, Hauptthema, Nebenthema. Hier geht es um viel mehr. Klänge es nicht so platt und hochtrabend, könnte man sagen: um alles.
Und wenn schon der Abglanz des Lebens in der Musik so spannend ist: Wie muss dann erst das Leben selbst sein?
Oder steckt alle Spannung, alle Kraft in der Musik, und der Rest ist öde und leer?
Was bliebe, wenn man jemandem, der so Klavier spielt, das Klavierspielen nimmt? Ginge das überhaupt?
Wie hält es jemand, der so spielt, mit sich selbst aus?
#
DAS ALSO IST die Geschichte. Igor Levit, 32, nicht ausgelastet damit, Jahrhundertpianist zu sein, und zugleich völlig erschöpft davon. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, und über Monate auch erst einmal auf der Suche nach der Frage selbst: Wer bin ich, und was soll ich tun.
Und jetzt?
Für gewöhnlich bestehen Biografien aus einer lückenlosen Erzählung von Lebensereignissen, die den Eindruck erweckt, das beschriebene Leben sei eine Folge von Kausalitäten, die sich im Moment des Erlebens schon so logisch und schlüssig anfühlen wie im Rückblick. Es ist der Versuch, den Dingen Sinn zu geben, manches bekommt seinen Sinn erst im Zusammenhang.
Aber das Leben besteht nicht nur aus Ereignissen, sondern auch aus Gefühlen, Ahnungen, Dringlichkeit, Überdruss, Unsicherheit, aus Glück und Pech. Und vor allem aus mehr Fragen als Antworten.
Ein solches Buch besteht auch nie allein aus der absoluten, dafür aber immer aus der persönlichen Wahrheit. Aus Geschichten, die immer weitererzählt werden und mit jedem Erzählen besser geworden sind, bei denen sich die Erzähler kaum über Zeit und Ort einigen können, sicher sind sie sich nur darüber, dass alles haargenau so passiert ist.
Eine Möglichkeit wäre, am Anfang zu beginnen, am besten sogar noch früher. Dann müsste man erzählen, wie Elena Levit, Igors Mutter, im Spätwinter 1987 Morgen für Morgen zum Konservatorium in Gorki läuft und Abend für Abend zurück nach Hause, in die winzige Wohnung in einer der Plattenbausiedlungen, und wie sie dabei immer wieder mit Igor in ihrem Bauch spricht, obwohl sie sich noch gar nicht sicher ist, dass das Kind, mit dem sie schwanger ist, ein Junge wird.
Und man müsste erzählen, wie sie vor Igors Geburt im Traum in einem Konzert sitzt, auf der Bühne spielt ihr Sohn das Klavierkonzert Nr. 2, Opus 18 in c-Moll von Sergei Rachmaninow. Und 15 Jahre später, beim Maria-Callas-Wettbewerb in Athen, sitzt Elena Levit tatsächlich in einem Konzertsaal und hört auf dem Podium ihren Sohn das Klavierkonzert Nr. 2, Opus 18 in c-Moll von Rachmaninow spielen.
Solche Geschichten. Aber hilft das weiter?
Muss man, um zu verstehen, warum ein Pianist spielt, wie er spielt, denkt, wie er denkt, und fühlt, wie er fühlt, vor dem ersten Ton anfangen? Zumal dann, wenn er selbst sich an diesen ersten Ton gar nicht erinnern kann?
In vielen anderen Fällen mag das so sein, bei Igor nicht. Igor Levit ist nur aus der unmittelbaren Gegenwart heraus zu verstehen.
Außerdem gibt es mit der Vergangenheit noch ein ganz anderes Problem – aber dazu später.
Also beschließen wir, für das Buch ein kleines Stück Gegenwart in Augenschein zu nehmen. An jenem Tag im Dezember deutet sehr vieles darauf hin, dass das kommende Jahr eine geeignete Zeitspanne sein würde. Weil sie schon weitgehend verplant und gut überschaubar ist.
Igors Konzerttermine sind für das ganze Jahr disponiert, es ist das Jahr, in dem sich der Geburtstag Ludwig van Beethovens zum 250. Mal jährt. Igor gehört zu den gefragtesten Beethoven-Interpreten auf dem Markt, es ist sehr viel los. Anfang Februar soll er eine Ausgabe des ZDF-Kulturmagazins Aspekte moderieren, am 10. März, seinem 33. Geburtstag, gibt er ein Konzert mit zwei Beethoven-Klavierkonzerten in der Elbphilharmonie. Im Mai spielt er eine Tour durch die USA, mit dem Solo-Debüt in der New Yorker Carnegie Hall. Im August dann: drei Wochen Salzburger Festspiele, mit den Beethoven-Sonaten.
So weit erst mal.
Wir verabreden uns für Salzburg, drei Wochen erscheinen uns als ein guter Rahmen für die Gespräche zum Buch. Genug Zeit, um in die Tiefe zu gehen. Was bis dahin passiert, würden wir sehen.
Wir wussten es nicht besser.
Die meisten Dinge, von denen dieses Buch handelt, sind an jenem Tag im Dezember noch nicht im Entferntesten absehbar. Aber das macht nichts.
Wenn man einen Witz erzählt, ist es wichtig, dass man beim ersten Satz schon den letzten kennt. Dieses Buch ist kein Witz.