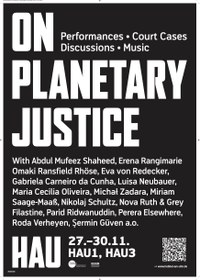Wie lässt sich Gerechtigkeit und Verantwortung für die Klimakrise wirksam einfordern? Im mehrstündigen Format des Public Hearings kommen Umweltkläger*innen aus aller Welt zusammen – von der Schweiz über Peru bis hin zu den Pazifischen Inseln. Sie alle haben den Protest von der Straße in den Gerichtssaal getragen, um Regierungen und Unternehmen zu verklagen, deren Handeln die Klimakrise verschärft und Grundrechte oder internationale Verpflichtungen verletzt.
Das Public Hearing spielt mit den Abläufen und Ritualen des Gerichtssaals, um einen Raum zwischen politischer und performativer Versammlung zu schaffen, in welchem Kläger*innen und ihre Vertreter*innen, Expert*innen und Anwält*innen zusammenkommen. Im Zentrum stehen internationale Gutachten und Gerichtsverfahren, anhand derer sie eine drastische Senkung von Emissionen mit juristischen Mitteln einfordern. Die Klagen richten sich einerseits an Regierungen, die zu einer ambitionierten Klimapolitik verpflichtet werden sollen. Einige wegweisende Urteile für den Schutz der Menschenrechte und zukünftiger Generationen wurden bereits erzielt. Doch auch Energie- und Rohstoffkonzerne werden für Überschwemmungen, Extremwetterereignisse oder den Anstieg des Meeresspiegels zur Verantwortung gezogen. Insgesamt zeigen die vorgestellten Fälle, wie juristische Strategien, transnationale Solidarität und zivilgesellschaftliches Engagement zusammenwirken, um neue Formen planetarischer Gerechtigkeit einzufordern. Planetarische Gerechtigkeit orientiert sich an respektvollen Beziehungen innerhalb und zwischen Gemeinschaften und Gesellschaften, verfolgt ein Gleichgewicht zwischen Spezies und Ökosystemen und richtet den Blick auf das Lokale.
Ablauf des Public Hearings
12:00–14:00 Uhr: Testimony / Zeug*innenschaft
Im ersten Teil des Public Hearings werden lokale Auswirkungen der Klimakatastrophe auf die Kläger*innen und ihre Communities vorgestellt und kontextualisiert. Mit welchen Umweltkatastrophen sind sie konfrontiert? Wie werden diese in einem rechtlichen Rahmen verhandelt? Welche Rechte werden verletzt, auf Grundlage welcher Gesetze wird geklagt – und welche Erfahrungen machen die Kläger*innen im Laufe ihrer Verfahren? Anhand von unterschiedlichen Fällen aus Pakistan, Indonesien, Peru, Deutschland, der Schweiz und Bangladesch erhält das Publikum Einblicke in die Hintergründe und Inhalte, den Verlauf und die Strategien von Klimaklagen.
14:00–14:45 Pause
14:45–16:30 Uhr: Examination / Untersuchung
Der zweite Teil des Public Hearings untersucht in einer vertiefenden Debatte die Potenziale und die Grenzen von Klimaklagen im Kampf um planetarische Gerechtigkeit. Dabei steht die Frage im Raum, inwiefern sie ein wirksames Mittel sein können, um der systematischen Untätigkeit von Staaten und den Profitinteressen fossiler Konzerne entgegenzutreten. Gemeinsam werden die Errungenschaften und Herausforderungen dieser oft langwierigen Prozesse reflektiert. Im Fokus stehen Strategien, Effektivität, Community-Bezüge, die Einbindung in klimabewegte Kontexte, ihre mediale Repräsentation, die Rolle von Kampagnen, Entwicklungen in der Rechtsprechung sowie Fragen von Teilhabe und Ausschluss.
16:30–17:00 Pause
17:00–17:15 Uhr: Collective Plea / Kollektives Plädoyer
Wie können wir trotz unterschiedlicher Betroffenheit vom Klimakollaps kollektiv handeln? Den Abschluss des Public Hearings bildet die Formulierung einer gemeinsamen Vision und Forderung: In einem kollektiven Plädoyer werden Visionen, Forderungen und Perspektiven für eine gerechte Zukunft formuliert. Was wollen wir erreichen – und was braucht es, um dorthin zu gelangen?
17:15–18:00 Uhr: Networking
Alle Anwesenden sind eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und neue Allianzen zu bilden. In offener Atmosphäre entsteht ein Raum für vertiefende Fragen, spontane Begegnungen und gemeinsame Ideen.
Die Klima-Klagen und ihre Vertretungen
Abdul Mufeez Shaheed berichtet vom Weg der Organisation Pacific Islands Students Fighting Climate Change zum Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom Juli 2025, in dem sie auf Grundlage des Völkerrechts die Verpflichtung aller Staaten feststellen, ihre Emissionen drastisch zu senken.
Clara Gonzales (ECCHR) spricht über ein im Oktober 2025 angelaufenes Verfahren von über 30 Pakistanischen Bauern gegen die Konzerne RWE und Heidelberg Materials, welches vom ECCHR und Medico begleitet wird. Im Zentrum stehen massive Monsun-Fluten im Jahr 2022, die große Teile Pakistans verwüstet haben und größtenteils auf den Klimawandel zurückzuführen sind.
Luisa Neubauer, Mitgründerin von Fridays for Future, repräsentiert die 2021 gewonnene Verfassungsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland, die daraufhin das Klimaschutzgesetz anpassen musste. Zusätzlich spricht sie zur aktuell laufenden, sogenannten Zukunftsklage, welche die unzureichende Anpassung des Klimaschutzgesetzes nach der ersten Klage fokussiert.
Parid Ridwanuddin repräsentiert die Pujianto-Klage gegen den Schweizer Zementkonzern Holcim, deren Vorverhandlungen am 3. September 2025 stattfanden. Vier indonesische Fischer*innen klagen gegen den „Carbon Major“ Holcim und fordern deren finanzielle Beteiligung an Klimaschutzmaßnahmen gegen eine Überschwemmung kleiner indonesischer Inseln.
Rosmarie Wydler-Wälti und Oda Müller von den KlimaSeniorinnen präsentieren ihre Klage gegen die Schweizer Regierung. Im Gefolge der Klage urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im April 2024, dass die Schweiz die Menschenrechte der älteren Frauen verletzt, weil das Land nicht das Nötige gegen die fortschreitende Klimaerwärmung tut. Aktuell verfolgen die KlimaSeniorinnen die Implementierung des Urteils.
Saúl Luciano Lliuya und Caroline Schroeder (German Watch) berichten vom Lliuya-Fall, in dem die Energie-Firma RWE verklagt und aufgefordert wurde, sich an notwendigen Klimaschutzmaßnahmen Lliuyas und seines Dorfes in den Anden/Peru zu beteiligen. Yi Yi Prue vertritt ihre Verfassungsklage gegen die deutsche Bundesregierung, die sie gemeinsam mit indigenen Vertreter*innen ihrer Gemeinschaft der Marma sowie Kläger*innen aus Nepal anstrengte und die 2021 gewonnen wurde. Im Zentrum stehen Landrutsche und übermäßige Monsunregenfälle, die durch Entwaldung und den Klimawandel ausgelöst werden.
Die Expertin Lea Frerichs ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Mercator-Stiftungsprofessur für Soziologie an der Universität Hamburg, wo sie zu sozialen Dynamiken der ökologischen Transformation forscht. Ihr Schwerpunkt liegt auf der rechtlichen Mobilisierung im Kontext von Klimaklagen und Protestbewegungen, mit besonderem Interesse an der Wirkungsforschung. Sie ist Mitautorin des jährlichen Klimawende-Ausblicks und Mitglied im Center for Sustainable Society Research (CSS), der Deutschen Gesellschaft für Soziologie sowie der International Sociological Association.
Die Vorsitzenden Dr. Miriam Saage-Maaß ist Juristin und Legal Director beim European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin. Sie arbeitet an strategischen Gerichtsverfahren gegen Unternehmen, die für Ausbeutung und Arbeitsrechtsverletzungen in globalen Lieferketten – etwa in Bangladesch und Pakistan – verantwortlich sind. Darüber hinaus leitet sie strafrechtliche Verfahren gegen Unternehmensführungen, die an internationalen Verbrechen wie Waffenexporten in Kriegsgebiete beteiligt sind. Miriam Saage-Maaß gilt international als Expertin für Unternehmensverantwortung und Menschenrechte. Sie verantwortet diverse strategische Klimaklagen des ECCHR.
Svenja Beller ist freie Journalistin, Autorin und Moderatorin. Sie lebt in Hamburg und Lissabon und schreibt unter anderem für das Süddeutsche Zeitung Magazin, Die Zeit, The Guardian und Der Freitag, wofür sie seit 2018 die umweltpolitische Kolumne „Forst und Wüste“ verfasst. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Journalistenpreis, dem Hansel-Mieth-Preis und dem Deutschen Preis für Klimajournalismus.
Yolanda Rother ist Mitbegründerin von The Impact Company, einem Beratungsunternehmen für Diversity und Inklusion und Vorstandsmitglied der Stiftung Zukunft Berlin. Sie moderiert und referiert zu Themen rund um die digitale Gesellschaft, Politik, Diversity und Nachhaltigkeit. Die Berlinerin ist Absolventin (Master of Public Policy) der Hertie School of Governance und hat in Brasilien, Frankreich und den Vereinigten Staaten gelebt.