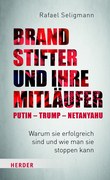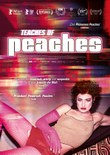Der letzte geldpolitische Kraftakt seiner Amtszeit hat dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, einiges an Kritik eingebracht. Zinserhöhungen sind in weite Ferne gerückt, und damit auch die lang ersehnte Rückkehr von Zinsen aufs Sparbuch. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann äußerte sich noch relativ verhalten: Die EZB sei mit dieser Mehrheitsentscheidung „über das Ziel hinausgeschossen“. Der Ökonom Hans-Werner Sinn hingegen warf Draghi eine Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA vor; die Süddeutsche urteilte, Draghi habe sich „verrannt“, und die Bild verunglimpfte ihn als „Graf Draghila“, der „unsere Konten“ leersauge.
Tatsächlich ist auch die jüngste geldpolitische Lockerung eine angemessene Reaktion auf die schwächere Weltkonjunktur und die konjunkturelle Abkühlung im Euroraum. Die Federal Reserve hat die Zinsen in den vergangenen Monaten sogar zweimal gesenkt, obwohl die US-Wirtschaft konjunkturell deutlich besser dasteht.
Für den Euroraum kommt die Abschwächung zu einer Zeit, da die EZB noch mit den Folgen der zweiten Krise zu kämpfen hat, die hier nahtlos an die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 anschloss: Vertrauenskrise, wirtschaftlicher Einbruch und Austeritätspolitik hatten zur Folge, dass die EZB es seit Jahren nicht schafft, ihr Inflationsziel von knapp 2 Prozent zu erreichen. Zwar gelang es 2015, durch den negativen Einlagenzins und massive Wertpapierkäufe die Gefahr der Deflation zu bannen, aber seither verharrt die Kerninflation hartnäckig nahe 1 Prozent.
Die EZB kann das Ausgabeverhalten der privaten Haushalte und Unternehmen nur indirekt über das Zinsniveau beeinflussen. Bei hoher Unsicherheit und bereits sehr niedrigem Zinsniveau sind direkte Investitionen des Staates wirksamer. Das leuchtet nicht nur theoretisch ein, sondern wurde in den vergangenen Jahren auch durch zahlreiche empirische Studien belegt. Staatliche Investitionen hätten neben der kurzfristig stabilisierenden Wirkung auch langfristig positive Effekte, wenn dadurch der Strukturwandel hin zur Klimaneutralität und die Modernisierung der Infrastruktur vorangetrieben würden.
Auf dem Höhepunkt der Krise verkündete EZB-Präsident Draghi, die EZB werde alles tun, um den Euro zu retten, „and believe me, it will be enough“. Damit verhinderte er den Zusammenbruch des Euroraums und fordert seither zu Recht auch einen Beitrag der Fiskalpolitik zur Stabilisierung. Die Hauptverantwortung für die lange anhaltende Nullzinsphase liegt tatsächlich nicht bei der EZB, sondern bei der Fiskalpolitik, und speziell jener Deutschlands. Der deutsche Staat hat in guter Absicht eine Schuldenbremse eingeführt und erzielt seit 2013 Budgetüberschüsse. Das aber hat zur Folge, dass in Deutschland gegenwärtig alle Sektoren – private Haushalte, Unternehmen und der Staat – mehr sparen als ausgeben.
Defizitexportweltmeister
Zugleich exportiert Deutschland sein Nachfragedefizit ins Ausland und trägt mit einem Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 7,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2018) zu den aktuellen Handelskonflikten bei. Die EZB kann dieses Problem nicht lösen, da Zinssenkungen zwangsläufig den Euro schwächen. Es liegt in der Hand der Bundesregierung, mittels staatlicher Investitionen die Bedingungen für ein Ende der Niedrigzinspolitik zu schaffen und zugleich den Handelskonflikt zu entschärfen.
Der Euroraum insgesamt benötigt ein Budget, mit dem fiskalische Impulse gesetzt werden. Ebenso wichtig ist aber, dass der Schaden repariert wird, der durch die Einführung von staatlichen Schuldenschnitten als wirtschaftspolitischem Instrument angerichtet wurde. Will die EU auf der Weltbühne eine Rolle spielen, so muss das auch der Euro tun. Das setzt voraus, dass die Staatsanleihen im Euroraum als sichere Wertpapiere angesehen werden. Mehrere Vorschläge für diese Reparatur liegen auf dem Tisch.
Der Euroraum als Kernstück der EU ist mehr als nur eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft. Im Interesse aller, die im Euroraum arbeiten, investieren, konsumieren, sparen oder gerade heranwachsen, ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihre Hausaufgaben macht.