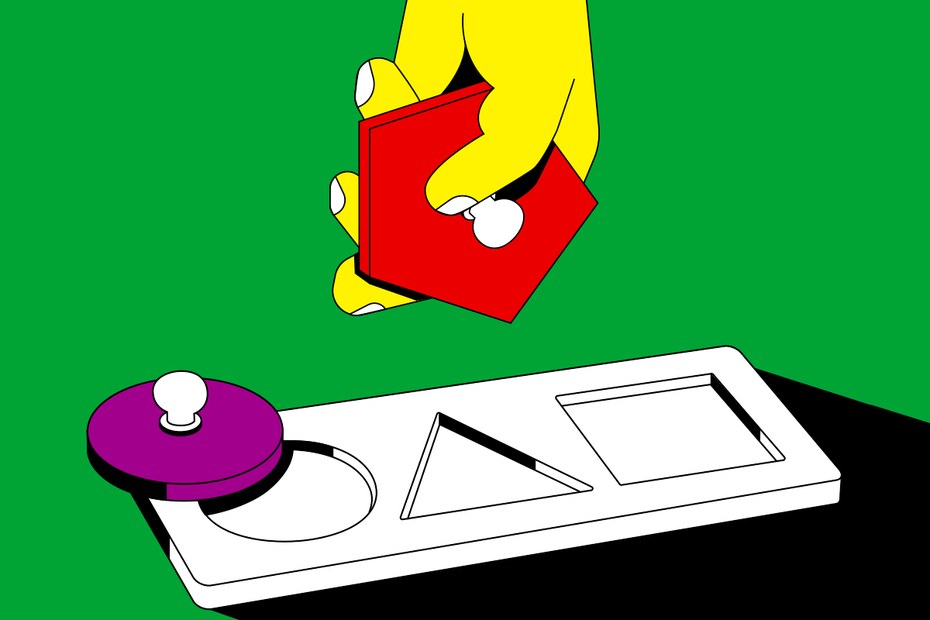Was bringt uns die Perspektive der Intersektionalität? Die Juristin Kimberlé Crenshaw verwendete den Begriff Ende der 1970er, um die besondere Diskriminierungserfahrung von Schwarzen Frauen zu erklären. Der Begriff entstand aus der Not: Crenshaw beschäftigte sich damals mit einem schwierigen Fall. Schwarze Frauen hatten General Motors angezeigt, weil die Firma sie bis dato praktisch kaum eingestellt und in Krisenzeiten als erstes entlassen hatte. Aus juristischer Perspektive war dieser Kampf chancenlos, da bislang nur eine binäre Diskriminierungsvorstellung zur Beurteilung herangezogen wurde: General Motors hatte sowohl Frauen als auch Schwarze angestellt und berücksichtigte daher Minderheiten. Wo lag also das Problem? Es zeigte sich, dass alle angestellten Fr
Frauen weiß waren und die Gruppe der Schwarzen Angestellten ausschließlich männlich. Die Schwarzen Frauen traten nun öffentlich als zusätzliche Minderheit auf, die diskriminiert wurde, und stellten das bisherige Rechtsverständnis der Jurist*innen vor eine neue Herausforderung. Crenshaw gab dieser Situation einen Namen und machte sie begrifflich. In der Folge schwappte die neue Herausforderung in die akademische Welt, die sich zuvor aus einer binären Logik heraus mit der Forschung zu Sexismus und Rassismus beschäftigt hatte.Das daraus resultierende Unbehagen kann auch als Zeichen der Effektivität der intersektionalen Perspektive betrachtet werden. Es bedeutet, dass einige Menschen ihre Fragen durch Berichte ihrer speziellen Erfahrungen an die Öffentlichkeit tragen und die bequeme Logik der Privilegierten stören können. Der Artikel „Verschwindende Körper“ von Sara Rukaj (der Freitag 31/2020) ist ein Beispiel für das Unbehagen speziell in der weißen Vernunft. Rukaj drückt in einer anderen Sprache ungefähr folgendes aus: Bei Queerfeminismus und Intersektionalismus handelt es sich um eine akademische Mafia, mit dem Alltag der Frauen haben sie wenig zu tun und vernichten sogar mit zweifelhaften Methoden eine der letzten Bastionen der sozialgeschichtlichen Geschlechterforschung in Deutschland. Sie vernachlässigen wichtige Themen beziehungsweise interessieren sich nur dafür, wenn sie selbst betroffen sind. Und es kommt noch schlimmer: Sie lassen das weibliche Subjekt abhanden kommen, sogar Körper verschwinden. Der Text breitet ein Bild einer geistigen Pandemie aus, das nahezu an Verschwörungsmythen erinnert.Lassen die Intersektionalisten tatsächlich Körper verschwinden? Kann es sein, dass nicht die Körper verschwinden, sondern die bequeme Logik der herrschenden Vernunft? Man versteht die Welt nicht mehr, man muss sich ständig mit neuen Begriffen und Bezeichnungen auseinandersetzen. Früher gab es in der allgemeinen Geschlechterlogik nur „Mann oder Frau“.Komplexe IdentitätenCrenshaws Begriff der Intersektionalität stellte nicht nur bei Jurist*innen, sondern und insbesondere bei weißen Feministinnen und männlichen Schwarzen Antirassisten Unbehagen her. Sie hatten so viel für eine Sache gekämpft und mussten sich nun anhören, sie könnten vielleicht selbst Rassistin oder Sexist sein. Das ist keine akademische Theorie, sondern alltägliche Realität: Es gibt antirassistische Männer, die sexistisch sind. Es gibt Feministinnen, die rassistisch sind. Es gibt sogar Homosexuelle, die Vorsitzende rassistischer Parteien sind. Ein Mensch hat nicht nur eine einzige Identitätslinie, sondern besteht aus mehreren Identitätskonstellationen. Und viele davon, insbesondere die privilegierten Identitätsachsen bleiben für den*die Träger*in selbst unsichtbar: Während Minderheiten an ihre Position täglich erinnert werden, sind sich die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft selten ihrer Mehrheitsposition bewusst.Anscheinend produziert die Idee einer komplexen Identitätskonstellation Unbehagen. Laut Rukaj erleben Queerfeminismus und Intersektionalität als dritte Frauenbewegung eine Renaissance „in Gestalt eines statt Gleichheit und Freiheit nur mehr Vielfalt proklamierenden Identitätsparadigmas“. Diese Beschreibung erinnert mich an die Kritik der Liberalen an den Sozialist*innen. Liberale proklamierten, die Sozialist*innen beschäftigten sich nur mit Gleichheit und vernachlässigten die Freiheit. Das ist ein Trick, der oft funktioniert. Sozialist*innen sind natürlich nicht gegen die Freiheit, sie sagen, dass Freiheit nur durch Gleichheit erreicht werden kann. Ein Freiheitsideal ohne soziale Gleichheit ist keine echte Freiheit. Was für Kapitalist*innen Freiheit ist, kann für die Arbeiterklasse Unfreiheit sein. Im 19. Jahrhundert waren Kapitalist*innen in Europa so frei, dass sie Kinder ungehindert den ganzen Tag arbeiten lassen konnten. Arbeiter*innen-Bewegungen reduzierten zwar solche „Freiheiten“ der Kapitalist*innen, erhöhten aber zugleich die Freiheiten der Kinder und Eltern.In ihrem Text deutet Rukaj an, Intersektionalität interessiere sich nicht für Gleichheit und Freiheit. Statt dessen lege sie den Fokus „nur“ auf mehr Vielfalt. Doch ähnlich wie bei der sozialistischen Idee von Gleichheit geht es hier hauptsächlich nicht um eine Zerstörung, sondern um die Erweiterung des Freiheitsbegriffs. Wer entscheidet, was Freiheit und Gleichheit ist? Bisher haben das zum größten Teil Menschen definiert, die mehr Macht und Ressourcen haben. Die Erfahrungen von Menschen in kolonisierten Ländern, von Frauen, von Homosexuellen und so weiter sind weniger begrifflich geworden und damit kein Teil der Vernunft im Sinne eines kollektiven Wissensvorrats geworden. Je mehr die Erfahrungen der Benachteiligten Teil der kollektiven Vernunft werden, desto eher entsteht Unbehagen bei den traditionellen Vernunftsträger*innen. Sie müssen sehen, dass ihre universelle Freiheitsvorstellung ein Pseudo-Universalismus ist, weil sie nur aus einer bestimmten Perspektive wahrgenommen und formuliert wird. Eine echte universelle Freiheitsvorstellung beginnt mit der Akzeptanz der Grenzen des eigenen Wahrnehmungshorizonts.In einem anderen Satz sieht man ähnliche pseudo-universalistische Freiheitsvorstellungen bei Rukaj: „Heute gilt [Alice] Schwarzer dem Queerfeminismus als rassistisch, während der Intersektionalismus statt im Namen von Freiheit und Gleichheit im Dienst der Minderheiten auftritt und so erst recht die Festschreibung von Ungleichheit betreibt.“ Dabei bleibt vieles unbeantwortet: Warum muss man Freiheit den Minderheitsrechten gegenüberstellen? Wie kann eine Freiheit und Gleichheit ohne Minderheitsrechte möglich sein? Wer braucht eigentlich Freiheit und Gleichheit am meisten: Kapitalist*innen oder die Arbeiterklasse? Männer oder Frauen? Heterosexuelle oder Homosexuelle? Die Mehrheitsgesellschaft oder Migrant*innen?Sie reden von FreiheitIn einer tieferen Bedeutungsschicht lässt sich im zitierten Satz von Rukaj ein (unbewusster) rassistischer Paternalismus feststellen. Wenn Rukaj über Intersektionalismus spricht, hat sie anscheinend ein Bild von hauptsächlich weißen deutschen Professorinnen, die mit dieser Theorie arbeiten, vor Augen. Der Vorstellungshorizont bezieht sich fast ausschließlich auf heroische Akte weißer Feministinnen: Entweder treten sie im Namen von Freiheit und Gleichheit oder im Dienst der Minderheiten auf. Sie vergisst aber dabei – bewusst oder unbewusst –, dass der Entstehungszusammenhang des Begriffs „Intersektionalität“ Arbeitskampf und wissenschaftliche Arbeit von Schwarzen Frauen war. Dieser heroische Akt des „im Dienst der Minderheiten Auftretens“ kann bei Crenshaw als Schwarzer Frau nicht funktionieren. Minderheiten brauchen in erster Linie keine heroischen Akte, sondern es muss ihnen zugehört werden. Die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Spivak fragte: „Can the subaltern speak?“. Subalterne und Minderheiten können reden so viel sie wollen; solange ihnen die Mehrheit nicht zuhört, werden ihre Aussagen oder Begriffe nicht Teil der kollektiven Vernunft. Vielleicht sollte Spivaks Frage auch anders herum formuliert werden: „Can the master listen?“ Sicher nicht, wenn die Herrschenden stets im Namen von Freiheit und Gleichheit reden, sich dabei als Freiheitskämpfer*innen fühlen und Erfahrungen der Minderheiten eher mit Unbehagen aufnehmen.Placeholder authorbio-1