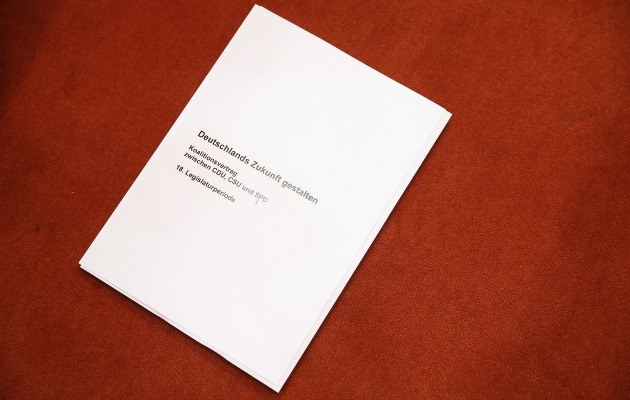Zu viel Demokratie soll nun auf einmal verfassungswidrig sein. Wenn die SPD ihre Mitglieder über einen Koalitionsvertrag abstimmen lässt, seien die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten nicht mehr frei in ihrer Entscheidung und das widerspreche dem Grundgesetz. Diese Meinung hat durch den Fernseh-Streit zwischen ZDF-Moderatorin Marietta Slomka und SPD-Chef Sigmar Gabriel ungeahnte Aufmerksamkeit erfahren. Dabei ignoriert die Argumentation schlicht die Realität. Den vollkommen unabhängigen Politiker gibt es nicht. Und das ist gut so.
Stattdessen gibt es den Fraktionszwang, der zwar nirgends im Gesetz verankert ist, aber trotzdem fast immer brav befolgt wird. Und es gibt Parteitagsbeschlüsse, an die sich die Abgeordneten auch meist halten. Ist das vereinbar mit
otzdem fast immer brav befolgt wird. Und es gibt Parteitagsbeschlüsse, an die sich die Abgeordneten auch meist halten. Ist das vereinbar mit dem Grundgesetz? Dort heißt es im Artikel 38, die Parlamentarier „sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“.Man kann es sich leicht machen und ganz formal argumentieren: Weder die SPD-Mitgliederbefragung noch irgendwelche Fraktions- oder Parteibeschlüsse sind für die Abgeordneten verbindlich. Auch ein Koalitionsvertrag ist bloß eine Absichtserklärung, rechtlich nicht zu beanstanden. In Wirklichkeit jedoch kann man schon eine Bindungswirkung feststellen. Daher lohnt sich eine Diskussion: Ist ein mehr oder weniger imperatives Mandat wirklich so schädlich für die Demokratie?Bürger zweiter Klasse?Ein Argument gegen die Befragung der SPD-Basis lautet: Die Nicht-Parteimitglieder würden zu Bürgern zweiter Klasse. Sie könnten nur einmal, nämlich bei der Bundestagswahl, abstimmen; die SPD-Mitglieder hingegen zweimal. In der Tat haben Sozialdemokraten mit Parteibuch nun mehr Stimmgewicht. Nur: Das trifft auf die Vorstandsmitglieder von CDU und CSU genauso zu. Die entscheiden nämlich auch über den Koalitionsvertrag – in kleiner Runde.Inzwischen hat sich CSU-Chef Horst Seehofer zu Wort gemeldet und das SPD-Verfahren verteidigt. Man kann ihm unterstellen, dass es ihm dabei nur darum geht, die Koalition unter Dach und Fach zu bringen. Trotzdem hat er Recht: „Wenn ein Mitgliederentscheid verfassungsrechtlich fragwürdig ist, dann sind's unsere Veranstaltungen gleich doppelt und dreifach.“Wo ist der Unterschied zum Parteivorstand?Die Diskussion ins Rollen gebracht hat der Leipziger Verfassungsrechtler Christoph Degenhart. Seine Argumentation läuft im Kern darauf hinaus, dass der Basisentscheid „eine stärkere mandatierende Wirkung als Entscheidungen von Parteigremien“ habe. Das ist aber Quatsch. Wenn die Basis ablehnt, gibt’s keinen Koalitionsvertrag. Wenn der Parteivorstand ablehnt: auch nicht.Der Unterschied liegt eher darin, dass sich die Basis nicht so gut kontrollieren, ihre Wahl kaum voraussagen lässt. Ein Parteivorstand hingegen, der den Vertrag mit ausgehandelt hat, wird hinterher wohl kaum dagegen stimmen. Vielleicht ist das der Grund für das Misstrauen gegenüber der Mitgliederbefragung?Die Probleme der RätedemokratieDie Diskussion über die Rechtmäßigkeit krankt auch daran, dass das Stichwort „imperatives Mandat“ einen Abwehrreflex auslöst. Als das Grundgesetz geschrieben wurde, sollte mit der Formulierung im Paragrafen 38 eine sozialistische Rätedemokratie verhindert werden. Das ist auch richtig, aber heute geht es um etwas ganz anderes: um mehr Demokratie im parlamentarischen System.Die Rätedemokratie hat zwei große Probleme. Zum einen werden Minderheiten unterrepräsentiert, weil sie nur auf der untersten Hierarchie-Ebene mitreden dürfen, beispielsweise in den Betrieben. Dort werden ausschließlich Vertreter gewählt, die die Mehrheitsmeinung vertreten. Auf jeder höheren Ebene kommen dann abweichende Positionen nicht mehr vor.Zum anderen ist die praktische Umsetzung schwierig. Ein imperatives Mandat kann nur grobe Leitlinien vorgeben. Wenn der gewählte Vertreter eines Betriebs hingegen bei jeder einzelnen Abstimmung an das Votum der Belegschaft gebunden wäre, könnte man mit dem gleichen Aufwand gleich die Basis direkt über alles abstimmen lassen. Das wäre keine Rätedemokratie, sondern Basisdemokratie.Die Partei, die ParteiBeim SPD-Mitgliederentscheid jedoch geht es um die Frage, ob Abgeordnete vollkommen unabhängig von ihrer Partei entscheiden sollten. Im Moment beachten die Politiker in der Regel die Parteibeschlüsse, denn sie wollen wiedergewählt werden und brauchen dazu einen Listenplatz oder die Aufstellung als Direktkandidat. Auch wenn dieses System die Parlamentarier einschränkt: Es ist sinnvoll für die Demokratie.Letztlich wählen die Bürger mit ihrer Zweitstimme nicht die einzelnen Abgeordneten, auch keine Koalition oder ein Regierungsprogramm – sondern sie wählen eine Partei. Sie vertrauen darauf, dass diese Partei die richtigen Leute aufgestellt hat, die richtige Koalition eingeht und das beste bei einem Regierungsprogramm rausholt. Die Bürger müssen darauf vertrauen, denn bislang haben sie keine Möglichkeiten, während oder nach der Wahl darauf Einfluss zu nahmen.Die Bürger können auch besser einer Partei vertrauen als einem durch Wahlergebnis und Listenproporz bunt zusammengewürfelten Haufen an Abgeordneten. Eine Partei verändert sich nur sehr langsam, sie ist berechenbar. Eine Bundestagsfraktion ist das nicht.Zudem kann ein Bürger in eine Partei eintreten und auch zwischen den Wahlen mitbestimmen. Ohne imperatives Mandat wäre das nicht möglich.Mehr WahlmöglichkeitenDie Parteien sind auch deswegen wichtig, weil der Bürger sie erkennt. Das Abstimmungsverhalten von rund 600 Abgeordneten kann sich niemand merken, das von fünf Parteien schon. Das ist auch ein wichtiges Argument für den Fraktionszwang. Für die Abgeordneten mag es angenehmer sein, immer ganz individuell abzustimmen. Beim Bürger aber bleibt am Ende nur ein großes Chaos.Man kann und sollte darüber nachdenken, ob die Bürger bei der Wahl künftig nicht nur eine Partei wählen, sondern auch die Reihenfolge der Politiker auf einer Parteienliste mitbestimmen dürfen. In anderen Ländern ist das schon üblich. Wenn Deutschland diese Praxis übernimmt, dann könnte es auch gerechtfertigt sein, die Einflussnahme von Fraktion und Partei auf einzelne Politiker zu beschränken. Solange der Bürger aber nur Parteien wählt, sollten diese auch die Politik bestimmen.