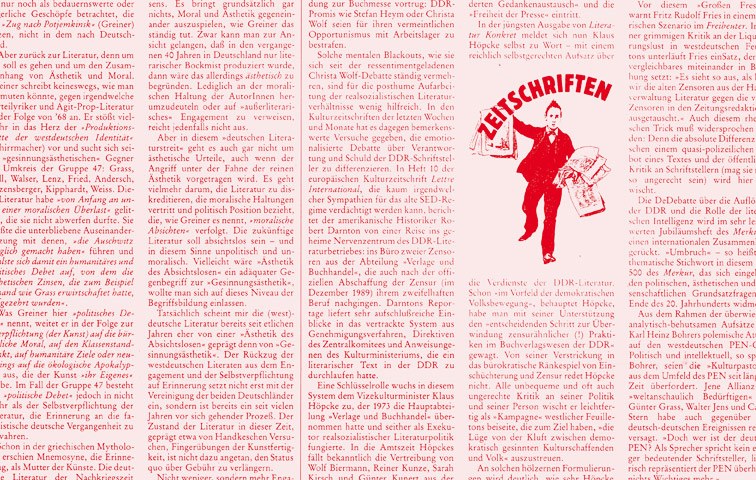Am 3. Oktober 1990 ist nicht nur das Ende der DDR offiziell besiegelt, sondern auch ein heikles Kapitel deutscher Literaturgeschichte abgeschlossen worden: Die Literatur der DDR, von vielen geschmäht als „propagandistischer Hokuspokus“ (Hans Joachim Schädlich), wurde offiziell beerdigt. Manche Kommentare zum Ende des zweiten deutschen Staates erweckten den Eindruck, neben den politischen seien auch die literarischen Erzeugnisse aus vierzig Jahren DDR über Nacht zu Makulatur geworden. Die Betroffenen selbst, die Schriftsteller aus Ost- und Westdeutschland, liegen untereinander im Dauer-Clinch. Man geizt in diesem erbitterten Streit nicht mit gegenseitigen Diffamierungen. Das reicht bis zur erschreckenden Forderung, die ein aus der alten DDR exilierter Lyriker in e
n einer Rundfunksendung zur Buchmesse vortrug: DDR-Promis wie Stefan Heym oder Christa Wolf seien für ihren vermeintlichen Opportunismus mit Arbeitslager zu bestrafen. Solche mentalen Blackouts, wie sie sich seit der ressentimentgeladenen Christa Wolf-Debatte ständig vermehren, sind für die posthume Aufarbeitung der realsozialistischen Literaturverhältnisse wenig hilfreich. In den Kulturzeitschriften der letzten Wochen und Monate hat es dagegen bemerkenswerte Versuche gegeben, die emotionalisierte Debatte über Verantwortung und Schuld der DDR-Schriftsteller zu differenzieren. In Heft 10 der europäischen Kulturzeitschrift Lettre International, die kaum irgendwelcher Sympathien für das alte SED-Regime verdächtigt werden kann, berichtet der amerikanische Historiker Robert Darnton von einer Reise ins geheime Nervenzentrum des DDR-Literaturbetriebes: ins Büro zweier Zensoren aus der Abteilung „Verlage und Buchhandel“, die auch nach der offiziellen Abschaffung der Zensur (im Dezember 1989) ihrem zweifelhaften Beruf nachgingen. Darntons Reportage liefert sehr aufschlussreiche Einblicke in das vertrackte System aus Genehmigungsverfahren, Direktiven des Zentralkomitees und Anweisungen des Kulturministeriums, die ein literarischer Text in der DDR zu durchlaufen hatte.Eine Schlüsselrolle wuchs in diesem System dem Vizekulturminister Klaus Höpcke zu, der 1973 die Hauptabteilung „Verlage und Buchhandel“ übernommen hatte und seither als Exekutor realsozialistischer Literaturpolitik fungierte. In die Amtszeit Höpckes fällt bekanntlich die Vertreibung von Wolf Biermann, Reiner Kunze, Sarah Kirsch und Günter Kunert aus der DDR. Dass Höpcke dennoch nicht den Typus des willfährigen Erfüllungsgehilfen stalinistischer Macht verkörpert, als den ihn seine Gegner darzustellen belieben, erhellt auch Darntons Lettre-Artikel. Nach wie vor, schreibt Darnton, genieße Höpcke bei ostdeutschen Autoren und Verlegern hohes Ansehen: Man sehe in ihm „eine Art Held“, der nicht nur skandalträchtige Bücher gegen unbelehrbare Funktionäre durchgesetzt, sondern auch – lange vor der Wende – eine Resolution gegen die Verhaftung Vaclav Havels unterstützt habe.Auch der Ostberliner Essayist Friedrich Dieckmann versucht in Heft 45 des Freibeuters der ambivalenten Rolle Höpckes gerecht zu werden. Einerseits habe sich Höpcke stets als treuer „Vollzugsbeamter der Direktiven des Politbüros“ exponiert, andererseits „bot er (auf Schriftstellerversammlungen) den Anblick einer professionellen Intelligenz, die in der Amtsrolle nicht ohne weiteres aufging“. Mit der PEN-Mitgliedschaft Höpckes berührt Dieckmann einen neuralgischen Punkt realsozialistischer Literaturverhältnisse. Es sei absurd, so Dieckmann, wenn ein Literaturbeamter, der für die Genehmigung wie das Verbot von Büchern zuständig ist, gleichzeitig in einen angesehenen Autorenverband aufgenommen werde, der bedingungslos für „ungehinderten Gedankenaustausch“ und die „Freiheit der Presse“ eintritt.In der jüngsten Ausgabe von Literatur Konkret meldet sich nun Klaus Höpcke selbst zu Wort - mit einem reichlich selbstgerechten Aufsatz über die Verdienste der DDR-Literatur. Schon „im Vorfeld der demokratischen Volksbewegung“, behauptet Höpcke, habe man mit seiner Unterstützung den „entscheidenden Schritt zur Überwindung zensurähnlicher (!) Praktiken im Buchverlagswesen der DDR“ gewagt. Von seiner Verstrickung in das bürokratische Ränkespiel von Einschüchterung und Zensur redet Höpcke nicht. Alle unbequeme und oft auch ungerechte Kritik an seiner Politik und seiner Person wischt er leichtfertig als „Kampagne“ westlicher Feuilletons beiseite, die zum Ziel haben, „die Lüge von der Kluft zwischen demokratisch gesinnten Kulturschaffenden und Volk“ auszustreuen.An solchen hölzernen Formulierungen wird deutlich, wie sehr Höpcke noch den alten stereotypen Denkmustern und Funktionärsphrasen verhaftet geblieben ist. Trotzig wiederholt er am Ende seines Artikels die vertrauten Glaubenssätze vom segensreichen Einfluss des Sozialismus auf die Literatur: „Ohne den Versuch des Sozialismus im östlichen Teil Deutschlands hätte es das Werk einer solchen deutschen Autorengemeinde teils überhaupt nicht, teils so nicht gegeben... Das macht einen Teil ihres geistigen Reichtums aus, ihrer Interessantheit auch morgen und übermorgen.“ Dass dieser „Versuch des Sozialismus“ auch die Unterdrückung und nicht selten die Vertreibung des „geistigen Reichtums“ aus den Landesgrenzen zu verantworten hatte, fällt in Höpckes Betrachtung unter den Tisch. Nein, es ist beileibe nicht alles „Kampagne“, was da an polemischen Argumenten in die Debatte geworfen wurde, sondern notwendig schmerzhafte Kritik. Gerade die selbstkritische Befragung nach eigener Schuld und Verantwortung gehört zu den ersten Aufgaben der Schriftsteller, die lange ihre Hoffnungen in den real existierenden Sozialismus investiert haben. Es geht darum, wie der Dresdner Lyriker Heinz Czechowski in der Zeitschrift Der Literatur-Bote (Heft 19) schreibt, „den eigenen Anteil an der Verdunkelung der Wahrheit zu markieren“. Für diese „Trauerarbeit“ werden jedoch keine inquisitorischen Literatur-Tribunale benötigt, die nach richterlicher Lust und Laune mal Christa Wolf und Stefann Heym, mal Klaus Höpcke zur Unperson erklären.Vor diesem „Großen Fressen“ warnt Fritz Rudolf Fries in einem satirischen Szenario im Freibeuter. In seiner grimmigen Kritik an der Liquidierungslust in westdeutschen Feuilletons unterläuft Fries ein Satz, der Unvergleichbares miteinander in Beziehung setzt: „Es sieht so aus, als hätten wir die alten Zensoren aus der Hauptverwaltung Literatur gegen die vielen Zensoren in den Zeitungsredaktionen ausgetauscht.“ Auch diesem rhetorischen Trick muss widersprochen werden: Denn die absolute Differenz zwischen einem quasi-polizeilichen Verbot eines Textes und der öffentlichen Kritik an Schriftstellern (mag sie noch so ungerecht sein) wird hier verwischt.Die Debatte über die Auflösung der DDR und die Rolle der literarischen Intelligenz wird im sehr lesenswerten Jubiläumsheft des Merkur in einen internationalen Zusammenhang gerückt. „Umbruch“ – so heißt das thematische Stichwort in diesem Heft 500 des Merkur, das sich eingehend den politischen, ästhetischen und wissenschaftlichen Grundsatzfragen am Ende des 20. Jahrhunderts widmet.Aus dem Rahmen der überwiegend analytisch-behutsamen Aufsätze fällt Karl Heinz Bohrers polemische Attacke auf den westdeutschen PEN-Club. Politisch und intellektuell, so spottet Bohrer, seien die „Kulturpastoren“ aus dem Umfeld des PEN seit längerer Zeit überfordert. Jene Allianz der „weltanschaulich Bedürftigen“ um Günter Grass, Walter Jens und Carola Stern habe auch gegenüber den deutsch-deutschen Ereignissen restlos versagt. „Doch wer ist der deutsche PEN? Als Sprecher spricht kein einziger bedeutender Schriftsteller, literarisch repräsentiert der PEN überhaupt nichts Wichtiges mehr.“Ziemlich tödliche Donnerworte. Wer riskiert den Widerspruch?Placeholder infobox-1