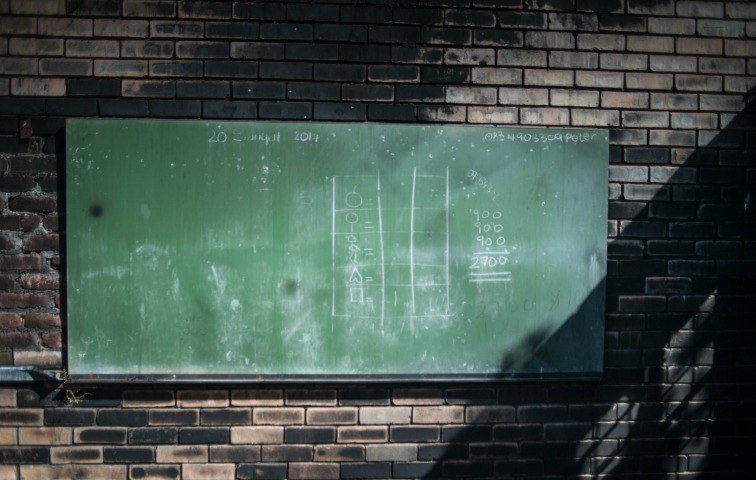Nur weil Maike Schubert auf ihre Schüler hörte, machte ihre Schule einen großen Schritt Richtung Zukunft. Im September 2014 forderte die Schülervertretung: „Schluss mit dem Smartphone-Verbot.“ Handys waren in der Freiherr-vom-Stein-Gesamtschule in Neumünster bis dahin nicht erlaubt. Am selben Abend änderte die Schulleiterin die Stopp-Smartphone-Regel – eine Entscheidung mit Folgen. Heute sind Smartphones und Tablets fester Bestandteil des Unterrichts. „Selbst die skeptischen Lehrer arbeiten jetzt mit dem digitalen Angebot“, sagt Maike Schubert.
Obwohl der Alltag der deutschen Schüler längst digitalisiert ist, findet der Unterricht in den Klassenzimmern oft noch analog statt. Arbeitsblätter statt Websites, Frontalunte
tter statt Websites, Frontalunterricht statt Lernvideos – bei vielen Lehrern ist die Digitalisierung sehr weit weg. Mit Methoden von gestern wollen sie Kinder von heute auf die Welt von morgen vorbereiten. Wie könnten die Pädagogen umlernen?„Die meisten Lehrer wollen ihren Unterricht digitaler gestalten“, ist Simone Fleischmann überzeugt, „aber es fehlt an technischer Unterstützung.“ Fleischmann ist Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands, der sich seit Längerem mit Digitalisierung an Schulen auseinandersetzt. Die fünf Milliarden Euro, die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka für technische Infrastruktur und Endgeräte zur Verfügung stellen will, sind für Fleischmann nur ein Anfang. „WLAN und Tablets alleine schaffen keine Veränderung – wir brauchen eine Gesamtstrategie.“ Lehrer müssen aus einem breiten Angebot an Fortbildungen wählen können, es braucht Experten von außen, die die Pädagogen unterstützen.Mehr Schatten als BegeisterungÄhnlich sieht das Felix Schaumburg, Lehrer an einer Wuppertaler Gesamtschule. Die Lehrer sind der Schlüssel für das Lernen mit digitalen Geräten und Plattformen. „Aber über die klassische Lehrerfortbildung schaffen wir das nicht.“ Schaumburg weiß, wie solche Fortbildungen funktionieren. Es kommt von außen jemand und informiert die Lehrer als Allwissender über die neuen Möglichkeiten. Aber die Lehrer einer Schule übernähmen die neuen Möglichkeiten erst, wenn einer ihrer eigenen Kollegen sich auf Tablets, Blogs und Lern-Apps eingelassen hat. „Der Typ Leuchtturm, der den anderen mit schicken Geräten vormacht, wie Lernen 2.0 geht, strahlt oft viel zu hell“, sagt Schaumburg. „Er produziert mehr Schatten und Scham als Begeisterung.“ Die Schlüsselpersonen sind für Schaumburg die ersten Nachahmer. Diese Lehrer importieren Tablets in ihren Unterricht – und entwickeln Projekte und didaktische Konzepte. Etwa indem sie mit ihren Schülern E-Books mit Filmen und Tönen herstellen.Die Freiherr-vom-Stein-Schule in Neumünster hat sich für einen radikalen Wandel entschieden. Die Schulleitung hat die klassische Lernsituation aufgehoben und Lerngruppen eingeführt. Der Lehrer ist dort ein Lernbegleiter, die Schüler lernen in Eigenverantwortung. Wie aber geht man mit Lehrern um, die keine Lust haben, ihren Unterricht so radikal zu ändern? „Ich glaube, wenn die Schulen ein digitales Konzept haben – dann ziehen auch die Lehrer mit“, sagt Simone Fleischmann. Schulleiter müssten es schaffen, ihre Lehrer zu begeistern. Klappt das nicht, müsse die Lehrkraft vielleicht über einen Schulwechsel nachdenken. „Hat ein Lehrer keine Lust, dann helfen auch keine Fortbildungen“, sagt Fleischmann. Auch Schulleiterin Maike Schubert hält nichts von verpflichtenden Fortbildungen: „In Zukunft müssen Lehrer zu Selbstlernern werden. Sie müssen sich selbst darum kümmern, bei der Digitalisierung Schritt zu halten.“Felix Schaumburg aus Wuppertal mag das Wort Fortbildung gar nicht mehr benutzen. Es gehe ja nicht nur darum, dass Lehrer die digitale Technologie bedienen können. Für ihn steht eine neue Haltung im Mittelpunkt. Die Möglichkeiten des Netzes machen die Schüler zu Produzenten. Das heißt, der Wissensspeicher Schulbuch tritt in den Hintergrund und die Rolle des Lehrers ändert sich. „Wer so etwas beeinflussen will, muss tief in die Lehr- und Lernphilosophie der Lehrpersonen einwirken – und er muss zugleich die Organisation Schule umbauen. Fortbildung zum Lehrer 2.0 ist in Wahrheit Coaching und Schulentwicklung.“ Das bedeutet: Der Fortbildner ist ein externer Moderator, der über längere Zeit die Schule begleitet. Er führt in die Technik ein, aber bringt vor allem methodische und didaktische Konzepte mit.Die neuen Lehrmittel verändern die Stellung des Lehrers, findet Simone Fleischmann. Jugendliche finden sich oft leichter in der digitalen Welt zurecht als die Erwachsenen. Das führt zu Kontrollverlust. „Es gibt nichts Schlimmeres als einen verunsicherten Lehrer.“ Fleischmann glaubt daher, dass der Unterricht sich ändern muss. Frontalunterricht und ein Lehrer als einzige Wissensquelle – das ist nicht mehr zeitgemäß.In Neumünster leitete kein Geldregen den digitalen Wandel ein, sondern engagierte Lehrer. Anstatt die Geräte zu verteufeln, nutzten sie die Technik. Als auch Schüler begannen, mit ihren Smartphones im Internet zu recherchieren und sich Lernvideos anzuschauen, riss das die anderen Lehrer mit. Als sie merkten, dass ihre Schüler mit den Geräten nicht nur spielten, griffen auch sie auf die technischen Möglichkeiten zurück – ein Nachahmeeffekt setzte ein. Um alle Lehrer auf den gleichen Stand zu bringen, machte die Schulleitung daraufhin Fortbildungen und richtete Trainingsgruppen ein. Sie lud Experten zum Thema Datenschutz ein und organisierte Workshops, in denen die Lehrer digitale Methoden ausprobieren konnten. Heute geben sich die Kollegen in kleinen Lehrerteams untereinander ihr Wissen weiter.