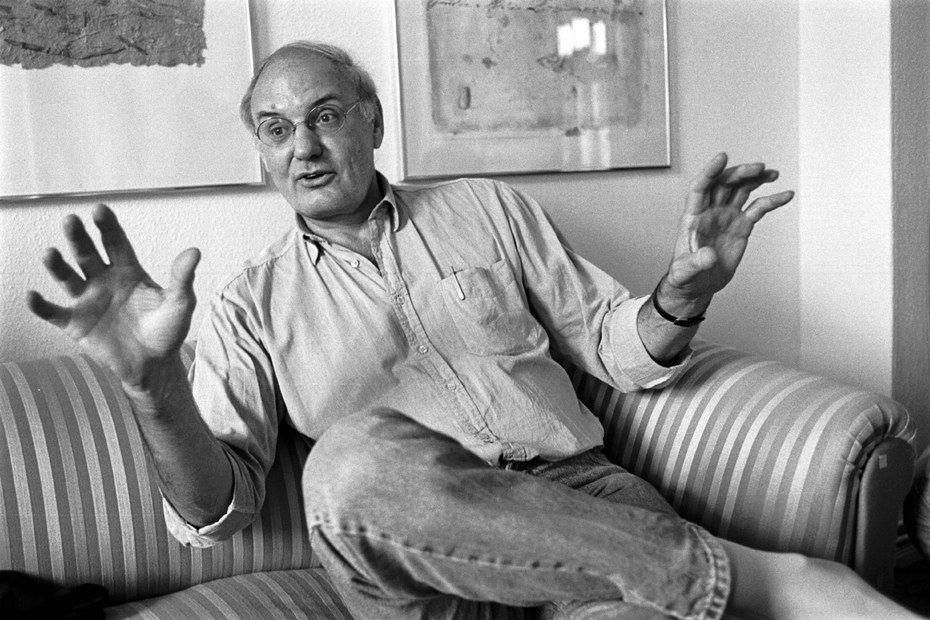Elmar war kein „Altmarxist“: Dieser Begriff konnte nur einem offenbar besonders ahnungslosem FAZ-Schreiber in den Kopf kommen, der in seiner neoliberalen Verblendung jegliche Beschäftigung mit Marx und mit dem Marxismus schon als solche für „alt“ im Sinne von überholt und erledigt hält. Elmar wusste zwar durchaus auch traditionelle Marxisten wie Eugen Vargas oder Ernest Mandel zu würdigen – den ersteren hat er neu herausgegeben, für die Berufung des letzteren nach Westberlin hat er gegen das von Innenminister Hans-Dietrich Genscher verhängte Einreiseverbot mit gestritten. Aber er war eben auch einer der Wortführer der sorgfältigen Neulektüre von Marx, welche diesen seit den 1960er Jahren – nicht nur in We
n – nicht nur in Westberlin und in Westdeutschland, sondern weltweit – aus seiner Vereinnahmung als Parteiideologe durch die (sich immer tiefer spaltenden und historisch marginalisierende) „kommunistische Weltbewegung“ befreit und Marx dadurch als radikalen, kritischen Theoretiker wieder virulent gemacht hat. Im Gegensatz zu den Verstrickungen auch noch Ernest Mandels in eine Historisierung der Marxschen Theorie, durch die diese gleichsam ins 19. Jahrhundert eingesperrt und für die gegenwärtigen Formen der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise im sog. „Spätkapitalismus“ letztlich nicht mehr relevant betrachtet wurde, gehörte Elmar zu denjenigen, welche Marxens unvollendet gebliebene Kritik der politischen Ökonomie auch theoretisch für die Gegenwart ernst nahmen – und sie daher daraufhin abklopften, wie sie weiterzuführen und zu erweitern ist.Ein Marxist neuer ArtInsbesondere den von den traditionellen Marxismen sozialdemokratischer oder kommunistischer Observanz vernachlässigten oder sogar als „bürgerlich“ diffamierten Themen der Bedeutung von Bildung und Ausbildung für die Reproduktion der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, der eigenständigen Bedeutung des Weltmarktes für die Reproduktion dieser Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in den konkreten historischen Gesellschaftsformationen und ihrer einzelnen Staaten, der ökologischen Dimensionen der Akkumulation und Reproduktion des Kapitals hat er bahnbrechende Untersuchungen gewidmet. Dabei war sein Markenzeichen die Verknüpfung einer eigenständig, kritisch und völlig undogmatisch rezipierten Marxschen Theorie mit den weltweit (vor allem im angelsächsischen Raum) geführten empirischen und historischen Debatten. Damit gehört er zu denjenigen, welche den aus der Studentenbewegung entstandenen „Westberliner Marxismus“ weltweit zu einer ernst zu nehmenden und ernst genommenen Größe gemacht hat. Sicherlich ist auf den von ihm oft geradezu neu eröffneten Forschungsgebieten inzwischen die Debatte vielfältig weitergangen – etwa aufgrund der realen Entfaltung der ökologischen Krisen oder aufgrund der erst jetzt verwirklichten Zugänglichkeit der einschlägigen Forschungen von Marx im Rahmen der MEGA. Aber seine Ausgangsintuitionen zur Thematisierung dieser Felder der wissenschaftlichen Untersuchung bleiben doch immer noch relevant und inspirierend für wirklich gegenwärtige Forschungen.Er war aber auch kein bloßer „Marxianer“, den das „unvollendete Projekt“ der Kritik der politischen Ökonomie intellektuell faszinierte und zu einer Wiederaufnahme der vielfältig abgebrochenen und unterdrückten Theoriearbeit motivierte. Sondern tatsächlich ein Marxist neuer Art, der sich mit Kämpfen um Befreiung umfassend solidarisierte und mit den entsprechenden sozialen Bewegungen – einschließlich der sich erneuernden Gewerkschaften – und den neuartigen parteipolitischen Formationen zusammenarbeitete, welche dadurch zumindest ein Jahrzehnt lang möglich schienen. Und eben seine theoretische Arbeit – ohne sie dafür zu verbiegen oder weniger anspruchsvoll auszuarbeiten – in diese Kämpfe der eigenen Zeit immer wieder einzubringen. Von der Neubegründung des Bundes demokratischer Wissenschaftler über die Zeiten, in denen die Westberliner „Alternative Liste“ und die westdeutschen „Grünen“ den Mehltau des pro-kapitalistischen Nachkriegskonsenses durchbrachen, brachte er sich – und die von ihm mitgeschaffenenen Arbeitszusammenhänge wie die Zeitschrift Probleme des Klassenkampfs (Prokla) – immer wieder produktiv ein.In seiner politischen Praxis – mit der er vor allem an der Freien Universität Berlin und am Otto-Suhr-Institut eine ganze Weile entscheidend dazu beigetragen hat, dass ein zeitgenössischer, erneuerter Marxismus einen entscheidenden Anteil an der Ausbildung einer neuen Generation von Intellektuellen gehabt hat – verband er immer wieder von Neuem einen realitätstüchtigen Pragmatismus mit der nötigen Radikalität. Gerade weil er selber konsequent an der Offenheit der kritischen Argumentation festhielt und allen Dogmatisierungstendenzen argumentativ entgegenarbeitete, konnte er auch wissenschaftspolitisch dazu beitragen, dass es in Westberlin nicht bloß Ende der 1960er Jahre einen „kurzen Sommer der Anarchie“ gegeben hat, sondern einen langen Marsch durch einen entsprechenden Kampf innerhalb der Hochschulen, der einen radikal erneuerten Marxismus noch einmal zu einer wirklich zeitgenössischen Kraft gemacht hat, welche eine ganze Generation von Studierenden hat prägen können.Bekanntlich hat sich dann auch im wiedervereinigten Berlin ein Prozess durchgesetzt, durch den der produktive Westberliner Marxismus, wie ihn Elmar besonders exemplarisch vertreten hat, marginalisiert und geradezu von den Hochschulen vertrieben worden ist – mit der Freien Universität Berlin und dem Otto-Suhr-Institut vorneweg. Jetzt liegt es in den Händen der nächsten Generation, sich nicht länger mit den intellektuellen „Bettelsuppen“ abspeisen zu lassen, wie sie seit dieser Vertreibung den Uni-Alltag bestimmen. Die Erinnerung an Elmar kann und sollte hier als ein wichtiger Anstoß dienen.