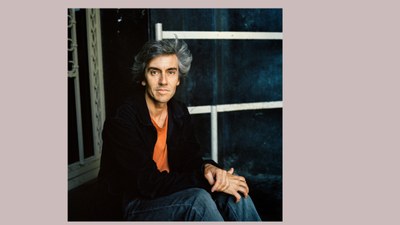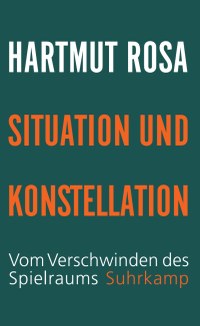Leseprobe
An dem Morgen hilft sie ihrem Vater im Hof beim Holzspalten. Es hat die ganze Nacht geschneit, der Boden ist weiß, ihre Schritte hinterlassen matschige Flecken. Seit einer Stunde reicht sie ihm ein Holzstück nach dem anderen, hebt jedes Mal den Keil aus dem Schnee auf, um ihn aufs nächste Stück zu platzieren, Oberkörper vorgebeugt, Arm in Erwartung des Hammerschlags angespannt. Schließlich gibt das letzte Scheit nach, das Holz kracht, die beiden Hälften trennen sich, fallen auseinandergerissen in den Schnee, das Mark erstrahlt im Licht. Der Vater stellt den Spalthammer an die Wand und geht, der Stallknecht wartet bei den Kühen auf ihn, seit zwei Tagen findet er an ihren Fersen Klauenfäule.
Sie bleibt allein zurück, schichtet die letzten Scheite auf in der Stille, die nur von dem hellen Laut der Holzstücke durchbrochen wird, wenn sie sie auf den Stapel legt. Ringsum schweigen die Mauern, der Schornstein raucht, der ganze Hof liegt im Schnee wie ein warmes Tier.
Sie fragt sich, wo der Franzose ist, den ihre Familie seit zwei Wochen beherbergt. Sie fragt sich, ob er bemerkt hat, dass sie allein ist, ob er weiß, dass die Mutter seit dem Morgen in der Stadt, der Vater für mindestens zwei Stunden unten im Stall ist. Dass bis zum Mittagessen bestimmt niemand kommen wird.
Sie beobachtet das Haus, versucht zu erraten, wo er ist. Lauert auf ein Zeichen an den Fenstern, auf die Bewegung eines Fensterladens, eines Vorhangs, eines Schattens. Sie fragt sich, ob er vorhat, an diesem Morgen in die Garnison hinunterzugehen oder, wie er es manchmal tut, bis zum Abend auf dem Hof zu bleiben, in seine Bücher vertieft, die er nur für einen kurzen Spaziergang beiseitelegt, immer den gleichen, immer um die gleiche Zeit am frühen Nachmittag, den Pfad hinab, der zum See führt, während sie ihm dann jedes Mal bedauernd nachblickt und die Arbeit, die ihre Hände gerade verrichten, als sinnlos empfindet, das Wäscheaufhängen, das Kaninchenfüttern – sie möchte ebenfalls zum See hinuntergehen, wie er vor der Aussicht stehen bleiben, mit ihm diesen See betrachten, auf den sie seit ihrer Geburt hinausschaut, weit wie ein Meer, am anderen Ufer begrenzt von den Schweizer und österreichischen Bergen.
Und plötzlich sieht sie ihn, er ist da, ganz in der Nähe, und sieht sie an. Vielleicht steht er schon seit einer Weile dort am Küchenfenster. Sie zuckt zusammen. Sie lächelt. Sie macht ihm ein Zeichen. Eine Handbewegung, die bedeutet: Komm. Ein unmissverständliches Zeichen, noch ehe sie es wollte, das nichts anderes bedeuten kann. Dann dreht sie sich um und geht quer über den Hof zur Scheune, erreicht das schwere Holztor, öffnet es nur einen Spalt weit, gleitet in die Dunkelheit hinein. Lehnt sich an die dicke Mauer. Wartet. Wartet im kräftigen Geruch von gelagertem Stroh, Wollschweiß, Dünger, Werkzeug, Maschinen, die durch die Jauche gefahren sind. Fühlt ihren Puls schlagen. Ihr Blut in den Schläfen pochen.
Sie hört die knirschenden Schritte im Schnee, die Schritte des Franzosen, der sich nähert, der in zehn Sekunden da sein wird, sie sieht ihn vor sich, wie er über den verschneiten Hof geht, die Hände in diesem Mantel, den sie für ihn gesäubert hat, ohne ihn wieder geschmeidig zu bekommen, als hätten Frost und Schlamm ihn unwiderruflich verhärtet, diesen Mantel, von dem er sich nie trennt, mit dem er im Krieg war.
Sie hört die Angeln quietschen, sieht das Tor kaum merklich wieder aufgehen, die Gestalt des Mannes im schmalen Lichtstrahl hereinschlüpfen, erst einmal eine Weile in der Dunkelheit stehen bleiben, ohne etwas zu sehen, hört ihn mit zögernder Stimme ihren Vornamen rufen.
Sie löst sich von der Wand, stellt sich im Schatten sehr aufrecht vor ihn. Sie lächelt. Sie ist stolz, sich getraut zu haben. Sie hört den Franzosen ihren Namen flüstern, er spricht ihn ungeschickt aus. Sie lacht darüber, dass er so schlecht Deutsch spricht, dass er, der seit zwei Wochen bei ihrer Familie lebt, nie etwas versteht. Sie schaut ihn an, wie er friert, mit seiner feuchten Nase, seinen blassen Wangen, seinen eisigen Händen. Seinem Körper, der nicht dafür geschaffen ist, nicht für den Krieg und nicht für diese Kälte. Ganz anders als die Körper der Soldaten, die in den letzten Monaten immer wieder unter betrunkenem Gejohle in den Hof einfielen, drei oder vier Hühner schlachteten, diese halb roh verschlangen und sie dabei von Weitem anstierten, schmutzige Worte im Mund und lüsternes Feixen in den Augen. Um dann so schnell wie möglich wieder abzuziehen, mit dem Schrecken von Männern auf der Flucht, mit der Brutalität von Lebenden, deren Ende nahe ist und die das wissen. Die in ihrer Verzweiflung darüber, verloren zu sein, alles um sich herum beneiden, was leben wird, und am liebsten jedes Wesen, dessen Herz weiterschlagen wird, umbringen, verletzen, beschädigen würden, um es für seine unverschämte Gesundheit bezahlen zu lassen.
In sechs Jahren Krieg hat sie eine Menge Soldaten vorüberziehen sehen. Deutsche. Franzosen. Sieger. Besiegte. Gefangene. Zwangsarbeiter, die zum Pflügen oder Ernten eingesetzt wurden. Verräter an ihrem Land, die ungeniert unter den Mördern ihres Volkes herumparadierten, Ehrenzeichen gut sichtbar auf der Brust, ohne jeden Stolz, ohne jede Scham. Sie hat die Sieger von gestern nach der Niederlage zurückkommen sehen, flüchtend, verstört, kaum wiederzuerkennen, in viel geringerer Zahl, voller Grimm.
Aber dieser Franzose hier gehört einer unbekannten Art an. Er hat einen langen, schmalen Körper, ein zartes Gesicht, eine fast mädchenhafte Art. Er lebt seit zwei Wochen bei ihr und ihren Eltern, ohne je eine Spur von Grobheit an den Tag zu legen, er isst mit der Familie, behandelt sie freundlich, hat neulich unter den Bäumen am See sogar mit ihr getanzt, zu der vom Kiosk aufsteigenden Musik des Festes, das die Franzosen veranstalteten, um das Ende des Krieges zu feiern, die Wiederkehr des Lebens, wenn man das Leben nennen konnte. Die Franzosen hatten an nichts gespart, an allen Ästen der Linden und Weiden über dem Wasser hingen Lampions, das ganze Ufer leuchtete in der Nacht – in all diesem Glanz und Prunk im Herzen der ausgebluteten Stadt lag eine unerträgliche Arroganz, und doch tat die Musik gut, tat der Alkohol gut, alle hatten sich allmählich gehen lassen. Der Franzose war gekommen und hatte sie zum Tanzen aufgefordert, und man hatte ringsum die Stirn gerunzelt, als man sah, dass sie annahm, dass sie aufstand und einfach in seinen Armen herumzuwirbeln begann, dass beide glücklich waren zu tanzen, dass sie gut aussahen, sie hatte schon so lange nicht mehr getanzt, in den Armen eines Mannes, der ihr gefiel, auf die Musik einer Kapelle, die für sie spielte, in den Gliedern und im ganzen Körper die Wärme von mehreren heruntergestürzten Gläsern Schaumwein.
Das war drei Tage her, und am nächsten Morgen hatten mehrere Freundinnen es sich nicht nehmen lassen, ihr ins Gesicht zu sagen, was sie dachten, sag mal, du wirst doch wohl nicht mit einem Franzosen herumschlafen, du wirst doch nicht zur Hure werden, uns Schande machen, während eine andere Freundin ihr im Gegenteil gesagt hatte, liebe, worauf wartest du, liebe, sie hatte sie sich vorgenommen und wie einen Apfelbaum geschüttelt, wach auf Herzchen hast du gesehen wie die Welt ringsum aussieht, hast du gesehen in welchem Zustand die Stadt ist, in welchem Elend wir alle stecken, so eine Gelegenheit wirst du dir doch hoffentlich nicht entgehen lassen. Immer wieder hatte sie ihr vorgesagt, liebe und pfeif darauf, was du zu hören bekommen wirst, was die Eifersüchtigen denken werden, diese Megären diese Neiderinnen, die nur davon träumen, an deiner Stelle zu sein, dieser Mann gefällt dir also liebe ihn.
Und jetzt küsst sie den Franzosen, presst sich an ihn. Sie küsst ihn weiter, kostet seine inbrünstigen, glühenden, köstlichen, vor lauter Inbrunst fast komischen Küsse, die Küsse eines Liebhabers, dem das alles gefällt, die Lust, die Liebe, Liebe machen, das spürt man instinktiv. Sie fühlt seine Arme, die sie umfassen, seine Hände, die unter das Umschlagtuch wandern, das sie sich über die Schultern geworfen hat, die sie drücken, sie ungeduldig an sich pressen, die schon nach ihren Hüften, ihrem Hintern greifen, unter ihre Kleider gleiten. Sie löst sich einen Moment von ihm, schnappt sich aus einem Regal eine alte Decke, entfaltet sie, breitet sie über das Stroh. Komm, sagt sie ihm. Komm, und wenigstens dieses deutsche Wort versteht der Franzose, und sie legen sich beide hin, küssen sich, streicheln sich, streicheln sich gierig, sind nackt, schmiegen sich aneinander, um sich zu wärmen, so gut es geht. Sie sind jung, doch das hindert sie nicht daran, genau zu wissen, was zu tun ist, wie ihre Körper sich bewegen müssen, um einander Lust zu schenken und selbst Lust zu empfinden. In ihrer Erinnerung geht alles von allein, alles ist einfach, sie erinnert sich, dass ihr das aufgefallen ist: Wie leicht alles ist, und warm, und schön. Das und die Geschmeidigkeit ihrer ineinander verschlungenen Glieder. Die Zartheit ihrer Haut. Die Feuchtigkeit ihrer Geschlechter. Die Energie ihrer Muskeln. Die Fülle all dieses Lebens, das in ihren Adern pocht und so stark durch ihren Körper strömt, das frohlockt, das seit Monaten nichts anderes ersehnte, als zu frohlocken.