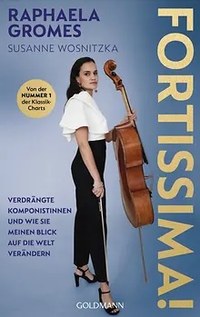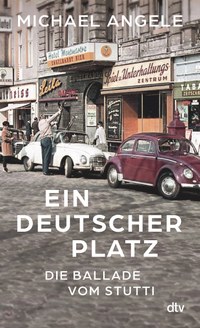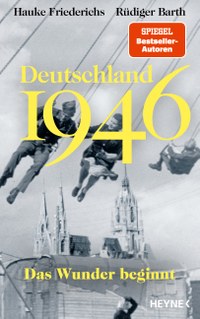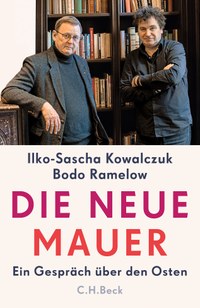Präludium
Wie es sich anfühlt, in einer Musikerfamilie aufzuwachsen? Ganz normal, natürlich! Das dachte ich zumindest immer. Ich dachte auch lange, dass es ganz normal ist, dass jeder ein Klavier zu Hause hat. In meiner Kindheit fragte ich Freunde erstmal verwirrt nach ihrem Flügel, wenn ich im Wohnzimmer keinen entdecken konnte. Mittlerweile weiß ich, dass es »normal« sowieso nicht gibt, meine Kindheit aber alles andere als gewöhnlich war.
Mein Alltag war klar durchstrukturiert, es gab seit meinem fünften Lebensjahr feste Zeiten, in denen ich erst Klavier-, dann Cellounterricht bei meiner Mutter hatte. Meist unterbrochen von Pausen für die Hausaufgaben, doch der feste Zeitplan verunmöglichte nahezu alle anderen Freizeitaktivitäten. Klar, ich konnte mit meinem Cousin spielen – zwei Einzelkinder, die wie Geschwister im selben Haus nördlich von München aufwuchsen. Manchmal, wenn ich auch nach dem Abendessen noch Unterricht und wirklich keine Lust mehr auf Cello-Üben hatte, hat mich mein Cousin gerettet: Er kam leichenblass zur Tür herein und erklärte, dass er wegen seiner schlimmen Kopfschmerzen unbedingt sofort Ruhe bräuchte – sein Bett war direkt unter unserem Musikzimmer. Meine Mutter denkt vermutlich bis heute, dass er wie sie selbst unter schwerer Migräne litt. Dabei wollte er mich meistens nur vom abendlichen Unterricht befreien. Ein besonderer Dank an dieser Stelle!
Aber natürlich gebührt vor allem meiner Mutter großer Dank: Wenn ich aufgrund ihrer Strenge nicht jeden Tag fraglos Cello geübt hätte, wäre ich jetzt nicht so selbstverständlich mit meinem Instrument verbunden und könnte darauf wie mit eigener Stimme singen. Besonders wertvoll war außerdem, dass mir meine Mutter als Cellistin und Lehrerin von Anfang an eine gute Technik beigebracht hat. Ich konnte mir also beim Üben keine Fehler eintrainieren, die ich später wieder mühsam hätte umlernen müssen.
Als ich auf einem Meisterkurs beim legendären David Geringasein besonders schwieriges Cellokonzert von Julius Klengelmit Tonleitern und Dreiklängen in allen möglichen und unmöglichen Lagen spielte, sagte der Großmeister zu mir: »Woher kannst du das denn so mühelos?«
»Von meiner Mutter«, antwortete ich.
»Dann musst du ihr jeden Tag danken.«
Ich danke ihr also, auch wenn es keine rosige Kindheit war. Viele dieser Erfahrungen teile ich vermutlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der klassischen Musik. Es gab kaum Freundinnen, die diesen verrückten Zeitplan akzeptierten und nicht beleidigt waren, wenn ich mich nicht spontan mit ihnen treffen, auf ihre Geburtstagsfeiern kommen oder einfach nach der Schule noch herumtoben und abends ins Kino gehen konnte. Genau genommen gab es in den ersten Jahren überhaupt nur eine Freundin, die das alles unbeirrt mitmachte: Olivia. Sie setzte sich ins Musikzimmer und wartete stoisch ab, bis ich fertig geübt hatte und wir endlich spielen konnten. Im Grunde war sie mein erstes Publikum: Damit sie sich beim Zuhören meines Cellounterrichts nicht allzu sehr langweilte, durfte ich in Olivias Anwesenheit ein Stück nach dem anderen spielen. Ich hoffte natürlich immer, dass ihr meine Musik gefiel und probierte aus, womit ich sie am besten unterhalten konnte.
Normalerweise musste ich erstmal endlos Tonleitern und Etüden mit Metronom »hochziehen«, wie meine Mutter es nannte – also stufenweise schneller üben – bevor es dann zum Ende des Unterrichts ein »richtiges« Stück als Belohnung gab.
Die meisten Kinder in meiner Schule hatten weniger Verständnis für mein Anderssein. »Cello-Nerd« oder »Cello-Streberin« wurde ich da genannt. In der fünften Klasse eröffnete mir eine Mitschülerin bei einem Klassenausflug, dass mein Kleiderstil total uncool und peinlich sei. Damals trug ich meistens – wie meine Mutter – altmodische Kleidchen oder bunte Röcke mit Blusen. Zum Glück erbarmte sich ein nettes Mädchen namens Maja meiner und fuhr mit mir nach München, um mit mir meine erste Jeans und ein paar T-Shirts bei H&M einzukaufen. Dieselbe Maja nahm mich auch ein paar Tage bei sich auf, nachdem während eines Streits mit meiner Mutter so sehr die Fetzen geflogen waren, dass ein Stuhl und ein Cellobogen zu Bruch gingen und ich mich schutzsuchend in der Toilette einsperrte – deren Tür kurz darauf ebenfalls einem Wutanfall zum Opfer fiel. Mein Vater kam später vorbei, um mit schuldbewusster Miene den Türrahmen zu leimen. Er hatte sich schon einige Jahre zuvor von meiner Mutter getrennt und mich vorübergehend meinem Schicksal überlassen.
Spätestens nach diesem Vorfall wurde uns bewusst, dass ich mir einen anderen Lehrer suchen musste. War der Unterricht in meiner Kindheit noch das reine Vergnügen gewesen, so artete er in der Pubertät zu regelmäßigen Machtkämpfen aus. Da ich schon seit Jahren den Traum gehegt hatte, Berufscellistin zu werden, und spätestens seit meinem ersten Auftritt mit Orchester mit dem Gulda-Cellokonzert den Bühnen-Flow lieben gelernt hatte, wollte ich unbedingt einen Platz als Jungstudentin an einer Musikhochschule ergattern. Diese Möglichkeit wird für hochbegabte Jugendliche angeboten, damit sie parallel zur Schule ihr Instrument studieren können. Ich fuhr also mit 14 Jahren allein quer durch Deutschland auf Meisterkurse bei verschiedenen Professoren, um einen für mich passenden Lehrer zu finden. Noch spannender als die musikalischen Impulse fand ich, was abends passierte: Es gab Ausflüge zur Shisha-Bar, Wodka mit Orangensaft wurde mir als gutes alkoholisches Einsteigergetränk verabreicht, wir hörten alles außer Klassik und redeten über alles außer Musik. Eine spanische Cellistin brachte mir Salsa bei, ein ungarischer Cellist wirbelte mich beim Tanzen so durch die Luft, dass ich das Gefühl hatte, zu fliegen, und in den besten (litauischen) Cellisten eines Kurses verliebte ich mich unsterblich … So entschied ich, dass ich dort studieren wollte, wo ich ihn wiedersehen würde: an der Musikhochschule in Leipzig bei Peter Bruns, wo ich kurz darauf tatsächlich mein Jungstudium begann.
Bis zu meinem Abitur pendelte ich also mit der Bahn zwischen München und Leipzig. Dank der großzügigen Unterstützung meiner Lehrer am Camerloher-Gymnasium Freising bekam ich jederzeit eine Schulbefreiung, wenn ich Cellounterricht hatte. In meinem Abiturjahr durfte ich sogar während der Schulzeit drei Wochen lang auf Tournee nach Südafrika fahren. Nach und nach lernte ich die »reale« Welt kennen, eine Welt außerhalb des einseitig elitären Kunstverständnisses, mit dem ich aufgewachsen war und in dem meine Mutter alles außer Klassik als »Quatschmusik« bezeichnet hatte.
Zu Hause war ich umringt gewesen von Musik und Büchern, von den großen Genies Bach, Beethoven und Brahms. Eine unangefochtene, heilige Welt, in der ich aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam. An den Wochenenden war jeder Abend mit Konzerten und Opernbesuchen gefüllt, in den Ferien ging es in die großen Städte Europas, in die bekanntesten Kathedralen und Museen: Louvre, Vatikan, Kunsthistorisches Museum Wien. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit zugebracht habe, die Gemälde Raffaels, Rembrandts und Renoirs zu bewundern. Und irgendwann nicht mehr zu bewundern, sondern mich unfassbar zu langweilen. Ich begann, in den Museen selbst zu malen, Postkarten zu schreiben und schließlich zu lesen, bis meine Mutter endlich weiterzog – meist in das nächste Museum oder die nächste Kirche.
Was ich damals noch nicht hinterfragt habe: All diese Genies waren Männer. Alle Werke, die wir in Museen bestaunten und in Konzerten hörten: selbstverständlich von genialen Männern geschaffen. Zwar bestand mein Lieblingsspiel – das Memory Berühmte Frauen – aus 33 Porträts von Sappho bis Sylvia Plath. Und natürlich wurden darin auch Komponistinnen wie Hildegard von Bingen und Clara Schumann und Malerinnen wie Artemisia Gentileschi und Paula Modersohn-Becker vorgestellt. Allerdings spielten sie in den Konzertsälen und Museen, die ich besucht hatte, keine Rolle, so wichtig konnten diese Frauen also doch nicht gewesen sein – dachte ich mir.
Nur eine Biografie stand in unseren Regalen im Musikzimmer, die tatsächlich von einer Frau erzählte: die von Sofia Gubaidulina(1931–2025). Sie war die Lieblingskomponistin meines Vaters, der die Entwicklung der zeitgenössischen Musik leidenschaftlich verfolgte und mir immer wieder begeistert Aufnahmen mit Werken dieser russischen Komponistin vorspielte. Die tiefe Religiosität ihrer Werke, durchdrungen von christlich-orthodoxem Mystizismus, und ihre kompromisslose Suche nach einer transzendenten Klangsprache berührten mich zutiefst. Als 2003 ihre erste Biografie erschien, kaufte sie mein Vater sofort, und ich verschlang sie fasziniert. »In mir begegnen sich Ost und West«, schrieb die Komponistin darin über sich selbst, und ihr Lebensweg sowie ihre Musik sind erstaunlich.[i] Noch heute ist es ein Traum von mir, ihre Cellokonzerte und den Sonnengesang im Konzert aufzuführen. Dass sie aber die erste wichtige Komponistin aller Zeiten sei, wie ich naiv annahm und wie es auch die Werbetexte ihrer Biografie nahelegen – weit gefehlt.
Im Musikstudium lernte ich einiges – über Komponistinnen war aber so gut wie nichts dabei. Weder bei meinem Jungstudium in Leipzig noch später beim regulären Cellostudium in München und Wien spielte ich je ein einziges Stück einer Frau. Im Studium wurde das Standardrepertoire erarbeitet, und dazu gehörte nun mal kein Werk einer Komponistin.
Aber geht es nicht einzig und allein um gute Musik? Heute ist mir völlig unverständlich, wie Komponistinnen, die zu ihren Lebzeiten über Landesgrenzen hinaus bekannt waren und gefeiert wurden, nach ihrem Tod völlig in Vergessenheit geraten konnten. Nach Jahrhunderten des Schweigens und Verschweigens wurden und werden sie nach und nach wiederentdeckt. Umso erstaunlicher ist, dass die Werke dieser Frauen heute trotz rund 50 Jahren fundierter Forschung im klassischen Musikleben kaum angekommen sind.
In meinem Studium wurden die Leistungen von Frauen nur gestreift: In der damaligen Lehre spielten sie nur als Mütter, Schwestern, Ehefrauen oder Musen wichtiger Männer eine Rolle. Clara Schumannwar eine der wenigen Frauen, deren Name gelegentlich erwähnt wurde. Dabei stand sie jedoch meist als Wunderkind und bedeutendste Pianistin ihrer Zeit im Fokus. Häufig sprach man von ihrer Zerrissenheit zwischen ihrem strengen und dominanten Vater Friedrich Wieckund ihrem genialen Ehemann Robert Schumann – sowie später von ihrer Liebe zu Johannes Brahms. Dass sie selbst fantastische Werke komponiert hat, wurde kaum thematisiert. In Biografien von Robert Schumann wird gerne betont, wie sehr er seine Frau zum Komponieren ermutigt haben soll, wie sehr er sie über alles geliebt und verehrt hat. Tatsächlich gibt es so wunderschöne Zitate wie: »Du vervollständigst mich als Componisten, wie ich dich.«[ii] Die beiden veröffentlichten den Liederzyklus Liebesfrühling op. 37 als Gemeinschaftskomposition. Robert Schumann äußerte den Wunsch: »Die Nachwelt soll uns ganz wie ein Herz und eine Seele betrachten und nicht erfahren, was von dir, was von mir ist.«[iii] Stammen vielleicht etliche Passagen seiner Werke eigentlich aus der Feder seiner Frau?
Beim Lesen des Briefwechsels zwischen Robertund Clarafallen jedoch auch weniger schmeichelhafte Sätze ins Auge: »Versprichst du mir das, dir keine unnützen Sorgen mehr zu machen, und mir zu vertrauen und folgsam zu sein, da nun einmal die Männer über den Frauen stehen.«[iv] Selbst ihre Konzerttätigkeit sollte sie seiner Ansicht nach zugunsten der Ehe einstellen: »Ich wähle mir an dir die Herzlichkeit und Häuslichkeit zur Braut, du mein liebes Hausweib Clara.«[v] Und: »Das Weib steht doch noch höher als die Künstlerin, und erreiche ich nur das, dass du gar nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun hättest, so wäre mein innigster Wunsch erreicht.«[vi] Dennoch musste Clara Schumann später oft kurzfristig auf Konzertreise gehen: um das Jahreseinkommen der Familie einzuspielen, wenn ihr Mann aufgrund psychischer Krisen gerade mal wieder arbeitsunfähig war.
Hier drängt sich doch die Frage auf, ob die Geschichte nicht anders gewesen sein könnte, als oft erzählt – und ob der ehrgeizige Vater Wieck, der die Ehe der beiden vehement ablehnte und gerichtlich zu verhindern suchte, eigentlich nur seine erfolgreiche Tochter vor einer Verbindung mit einem psychisch labilen, narzisstischen Neurotiker schützen wollte? Immerhin war Clara Schumann zwischen 1841 und 1854 zehnmal schwanger, und Robert war nicht bereit, sich an der Erziehung der Kinder zu beteiligen: »Clara kennt aber selbst ihren Hauptberuf als Mutter, dass ich glaube, sie ist glücklich in den Verhältnissen, wie sie sich nun einmal nicht ändern lassen.«[vii] Die da unter anderem waren, dass Clara nicht üben durfte, während er komponierte. Und sich auch sonst ganz seinem Arbeitsrhythmus anpassen musste, sodass sie selbst kaum Zeit mehr zum Komponieren fand: »Kinder haben und einen immer phantasierenden Mann und komponieren geht nicht zusammen«, schrieb Robert.[viii]
Sicher, Robert Schumannwar nicht so radikal wie Gustav Mahler – der von seiner Verlobten Alma Schindlerals Bedingung für die Hochzeit verlangte, dass sie das Komponieren vollständig aufgab. Falls Ihnen der Fall Gustav Mahler/Alma Schindler nichts sagt – hier ein kurzer Einblick in das Frauenbild des berühmten Komponisten: »Wäre es dir von nun an möglich, meine Musik als die Deine zu sehen? Die Rolle des Komponisten, die Welt des Arbeiters fällt mir zu, – Deine ist die der liebenden Gefährtin und verständnisvollen Partnerin … Du musst dich mir bedingungslos hingeben, Dein zukünftiges Leben in jeder Einzelheit ganz nach meinen Bedürfnissen ausrichten und dafür nichts begehren außer meiner Liebe.«[ix] So Gustav Mahler 1901 an seine Verlobte, die sich dennoch auf die Ehe einließ. Als Mahler 1910 die Lieder seiner Frau in einer Mappe fand, drängte er sie dazu, wieder zu komponieren. Alma ließ sich aber wegen ihres mangelnden Selbstbewusstseins nicht mehr davon überzeugen.[x]
2019 – zum 200. Geburtstag von Clara Schumann – erschienen viele neue Biografien über sie und Alben mit ihrer wundervollen Musik. Auch auf einigen Konzertprogrammen waren ihre Werke zu finden. In jenem Jahr stieg der Prozentsatz der aufgeführten Musik von Komponistinnen in Deutschland auf 4,5 Prozent – ja, Sie lesen richtig: stieg auf 4,5 Prozent.[xi] Clara Schumann ist die mittlerweile wohl bekannteste klassische Komponistin unserer Zeit.
Ein paar Jahre zuvor hörte ich im Autoradio ein fesselndes Klaviertrio und rätselte lange, von wem es wohl komponiert worden war. Ich schwankte zwischen Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann. Oder nein, war sie nicht doch noch viel romantischer, diese überwältigend schöne, berührende Melodie? Etwa von Chopin? Weber? Nein, es war doch anders. Einfach ein eigener Stil, eine ganz eigene, intime und persönliche Sprache. Es musste ein unbekannter Zeitgenosse sein. Ich überlegte hin und her, wälzte Namen von weniger bekannten Komponisten in meinem Kopf – warum um Himmels willen kannte ich den Urheber dieses Klaviertrios nicht? Eine Schande! Nie im Leben wäre ich darauf gekommen, dass es das Werk einer Frau sein könnte, und als ich schließlich hörte, dass es von Clara Schumannstammte, war ich beschämt, dass ich mich vorher nicht intensiver mit ihren Kompositionen beschäftigt hatte.
Clara Schumann selbst schrieb über ihr Klaviertrio: »Es geht doch nichts über das Vergnügen, etwas selbst komponiert zu haben und dann zu hören … Natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an der Kraft und hie und da an der Erfindung fehlt.«[xii] Sie selbst wagte nicht zu hoffen, dass sie eine wahre Begabung zum Komponieren haben könnte, zu sehr glaubte sie an die gängigen Theorien und heute noch bekannten Aussprüche der wichtigen Philosophen ihrer Zeit: »Das Weib gebiert Menschen, der Mann das Kunstwerk.«[xiii] (Johann Wilhelm Ritter) Oder: »Die Weiber im Ganzen genommen, haben durchaus kein Genie. Ihre Werke werden kalt und niedlich sein, wie sie selbst sind.«[xiv] (Arthur Schopenhauer).
Diese Vorurteile sind immer noch in unserer Gesellschaft verwurzelt, wenn auch abgeschwächt und häufig unbewusst: »Das gesamte Œuvre von Fanny Henselsollte eingestampft werden!« Mir dreht sich immer noch der Magen um, wenn ich an diese bodenlose Unverschämtheit denke, die einer meiner Musikprofessoren während des Studiums von sich gegeben hat. Offensichtlich hatte er sich nie mit dem Werk der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy beschäftigt, sonst hätte er diese Behauptung nicht aufstellen können.
Wie weit das Patriarchat das Schaffen und Wirken von Frauen eingeschränkt hat, ist ein Hauptthema dieses Buchs – und auch, welch abgrundtief diskriminierende Gründe sich Philosophen und Musikwissenschaftler im 19.Jahrhundert überlegt haben, weshalb Frauen auf keinen Fall kreative und schöpferische Kräfte in sich hätten.
Doch es gibt viele Gründe, die auch heute noch regelmäßig unter Fachleuten genannt werden, warum es bis zur Moderne gar keine guten Komponistinnen gegeben haben könnte: Zum einen, weil Frauen lange nicht studieren durften und somit nicht adäquat ausgebildet waren. Ein reguläres Hochschulstudium war für sie in den USA seit 1833 möglich, in Frankreich seit 1863, England seit 1869, Schweden seit 1873 – und in Deutschland war die badische Landesregierung die erste, die Frauen offiziell zur Immatrikulation zuließ, und zwar erst im Jahr 1900! 1906 folgte Sachsen und 1908 Preußen.[xv] Zum anderen, weil musikalische Exzellenz das Ergebnis intensiven und langjährigen Übens sei. So wird auf die »10000-Stunden-Regel« verwiesen, die besagt, dass etwa 10000 Stunden gezielter Übung notwendig sind, um in einem Bereich Meisterschaft zu erlangen. Und Frauen hätten neben ihrer Tätigkeit als Mutter und Ehefrau ja keine Möglichkeit gehabt, diese enorme Zeitmenge aufzuwenden, um zu wirklicher künstlerischer Blüte zu gelangen. Einige Komponistinnen beschlossen daher sogar, zugunsten ihrer musikalischen Karriere nicht zu heiraten und keine Kinder zu bekommen, um genügend Zeit zum Komponieren zu haben.
Darüber hinaus würde ein Komponist durch die Resonanz der Außenwelt lernen und könne erst mit Kritik und Erfahrung wachsen. Wenn Frauen ein Studium, Zeit für die nötige Übung und Reaktionen auf öffentliche Aufführungen verwehrt wurden – wo sollten sie dann die nötigen Erfahrungen machen und daran wachsen? Tatsächlich wirkte sich die fehlende Würdigung der Leistungen von Frauen, die seltenen Aufführungen und die mangelnde objektive Kritik an ihren Werken auf die Kreativität vieler Komponistinnen lähmend aus: »Man verliert am Ende selbst mit der Lust an solchen Sachen das Urteil darüber, wenn sich nie ein fremdes Urteil, ein fremdes Wohlwollen entgegenstellt«, schrieb beispielsweise Fanny Henselüber ihr Schicksal als Komponistin.[xvi]
Dennoch existiert heute eine Vielzahl an genialen Werken von Komponistinnen. Ungeachtet aller Diskriminierung und der unvorstellbaren Umstände gab es einige Frauen – schon weit vor Sofia Gubaidulina –, die sich einen Studienplatz erkämpften und Privatunterricht von berühmten Komponisten erhielten, und etliche, deren Werke regelmäßig öffentlich aufgeführt und von Publikum und Presse rezipiert wurden.
Die Werke dieser Komponistinnen sollen wieder – oder endlich! – ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Wir sind es diesen Frauen schuldig, dass sie eine Renaissance erleben und wir sie genauso ernst nehmen wie ihre Kollegen. Denn »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« (Grundgesetz). Sie sind daher gleich berechtigt, mit ihren Leistungen, ihrer Kunst, ihrem Können und ihrer Kraft ebenso gesehen und gehört zu werden.
Das alles wusste und reflektierte ich während meines Studiums aber noch nicht. Zwar regte sich in mir ein starkes Unbehagen, als eine Professorin an meiner Hochschule ausführte, Frauen hätten einfach kein Genie, und deshalb seien ihre Werke es nicht wert, gespielt zu werden. Doch ich machte mich nicht auf die Suche nach einem Gegenbeweis. Zu groß war der Einfluss meiner Erziehung, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht hinterfragte, zu groß die Begeisterung für all die Musik von Männern, mit deren Werken ich aufgewachsen war und die ich über alles liebte. Und vor allem war ich selbst zu klein: Wer war ich, dieses gewachsene System, das bewährte Repertoire, den gefestigten Kanon infrage zu stellen? Ich musste ja erst beweisen, dass ich überhaupt einen Platz in der Musikwelt verdiente, dass ich selbst eine ernst zu nehmende Persönlichkeit war, dass ich das Cello beherrschte und mit meiner Musik berühren konnte. Ich musste mich also dem Wettbewerb aussetzen und mich behaupten. Und bei Wettbewerben wird nun einmal das Standardrepertoire gefordert: Konzerte von Haydn, Schumann, Elgar, Dvořák, Tschaikowsky und Schostakowitsch zu beherrschen, ist obligatorisch. Und Sonaten von Beethoven, Mendelssohn, Brahms und Rachmaninow. Deshalb ist es heute übrigens oft schwer, eine Dirigentin zu finden, die gerne Komponistinnen dirigiert. Die meisten Dirigentinnen wollen, ja, müssen sich erst selbst beweisen. Und das traditionell mit den bekanntesten und beliebtesten Werken der Sinfonik, und nicht mit Experimenten. Wer nicht bekannt ist, kann seine Stimme auch nicht für Unbekanntes einsetzen.
[i]Michael Kurtz: Sofia Gubaidulina. Eine Biographie. Stuttgart 2001.
[ii]Brief vom 10.Juli 1839, in: Thomas Synofzik und Michael Heinemann (Hg.): Schumann Briefedition III. Verlage im Ausland 1832 bis 1853. Köln 2014, S. 139.
[iii]Brief von Robert Schumann an Clara Schumann vom 22.Juni 1839, in: Jugendbriefe von Robert Schumann, hrsg. von Clara Schumann. Bremen 2013, S. 301.
[iv]Zit. n. Nancy B. Reich: Clara Schuman. Romantik als Schicksal. Eine Biographie. Reinbek 1997, S. 113.
[v]Brief vom Januar 1840 (ohne Datum), zit. n. Karl H. Wörner: Robert Schumann. München 1987, S. 170.
[vi]Zit. n. Nancy B. Reich: Clara Schuman, a.a.O., S. 110.
[vii]Zit. n. Danielle Roster: »Allein mit meiner Musik«. Komponistinnen in der europäischen Musikgeschichte vom Mittelalter bis ins frühe 20.Jahrhundert. Echternach 1995, S. 142.
[viii]Ebda.
[ix]Brief von Gustav Mahler 1901, zit. n. ebda., S. 189f.
[x]Melanie Unseld: »Alma Mahler«, in: Beatrix Borchard, Nina Noeske und Silke Wenzel (Hg.): Musikvermittlung und Genderforschung (MUGI); https://mugi.hfmt-hamburg.de/receive/mugi_person_00000515 (zuletzt abgerufen am 12.Mai 2025).
[xi]Susanne Wosnitzka: »Festrede/Zornrede – 30 Jahre musica femina münchen e.V.«; https://susanne-wosnitzka.de/festrede-zornrede-30-jahre-musica-femina-muenchen-e-v/2018/05/04/ (zuletzt abgerufen am 5.August 2024).
[xii]Clara Schumann: Tagebucheintrag vom 2.Oktober 1846, zit. n. Beatrix Borchard: Clara Schumann. Ihr Leben. Eine biographische Montage. Hildesheim/Zürich/New York 2015, S. 202.
[xiii]Johann Wilhelm Ritter: Fragmente aus dem Nachlass eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur. Heidelberg 1810, §495 (1803); www.projekt-gutenberg.org/ritter/jungpsys/chap012.html (zuletzt abgerufen am 31.März 2025).
[xiv]Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, in: Wolfgang v. Lohneysen (Hg.): Sämtliche Werke in 5 Bänden. Bd.2. Frankfurt am Main 1993, 4. Aufl., S. 506.
[xv]Ute Gerhard: Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789. München 2020, S. 71.
[xvi]Zit. n. Danielle Roster: »Allein mit meiner Musik«, a.a.O., S. 232.