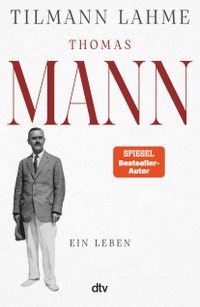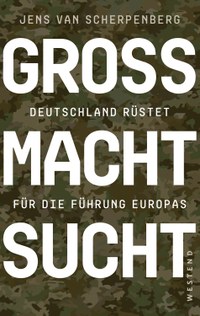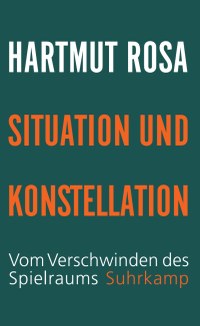Vorspiel, 1903
Er muss einen Tropfen eigenes Blut in die Tinte geben, wenn er schreibt, das weiß Thomas Mann längst. Für seine Schreibversuche, in denen es anders war, geniert der 27-Jährige sich mittlerweile. In seiner ersten veröffentlichten Erzählung Gefallen hat er einen Text des bewunderten Bruders variiert, wie überhaupt fast alles an Eindruck und Einfluss über Heinrich Mann kam in den frühen Jahren.
Ein junger Mann verliebt sich in ein einfaches Mädchen, bei Heinrich eine arme Angestellte, bei ihm eine Schauspielerin. Beide Frauen brauchen Geld. Beide werden sie deswegen »fallen«, sich für Geld jemand anderem hingeben. Die Liebesgeschichten enden in Enttäuschung.
Bei Heinrich Mann ist Kritik an der sozialen und gesellschaftlichen Lage der Frauen spürbar, auch Selbstkritik an der männlichen Rolle des wohlhabenden Bürgersohnes, der diese Lage ausnutzt; das letzte Wort hat die gefallene, aber selbstbewusste Frau. Bei Thomas Mann hingegen vibriert ein gewaltiges Schreibtalent in einem Text, dessen Thema ihn erkennbar nicht interessiert: Die Frauenemanzipation wird durch die belächelte Figur, die sie vertritt, zum Herrenwitz der Erzählung, die Verliebtheit des jungen Mannes wirkt schwülstig, die Frauenfigur bleibt klischeehaft und blass.
Das ist neun Jahre her. Mittlerweile hat Thomas Mann seinen Weg gefunden, sich literarisch auszudrücken. Was ihn wirklich bewegt, verbirgt er in seinen Erzählungen hinter »diskreten Formen und Masken«, um sie dem Publikum zu präsentieren. Ökonomisch ist das kein Erfolg. Der Novellenband Der kleine Herr Friedemann verkauft sich schlecht. All diese Geschichten von Außenseitern, die an Liebe und Leben scheitern, sind den Lesern zu hart und zu kalt.
Ob das mit dem neuen Novellenband Tristan besser wird, der gerade im März 1903 erschienen ist? Hermann Hesse, als Autor noch nicht weiter bekannt, veröffentlicht eine Buchkritik. Er schätzt sehr, was Thomas Mann schreibt, und fühlt auch eine gewisse Verwandtschaft; dieser Blick von außen, wie sein eigener, ist schärfer und schmerzlicher, als wenn man in der Mitte steht und dazugehört. Nur eine der Erzählungen lässt »dauernd unbefriedigt«, meint Hesse. Darin tritt ein betrogener Ehemann seiner bösen Frau zuliebe bei einem Fest in Frauenkleidern und mit Perücke auf. Er singt als »Luischen« ein Lied, wird zum Gespött und bricht schließlich tot auf der Bühne zusammen. Was ist dieses »Luischen« nur für eine »sonderbare und häßliche Geschichte«, wie Thomas Mann sie selbst nennt?
Die 12. Auflage der Psychopathia sexualis von Richard von Krafft-Ebing ist 1903 erschienen, die letzte Ausgabe des Buches, die der Arzt und Sexualwissenschaftler noch selbst überarbeitet hat. Als Buch wird er sie nicht mehr sehen, im Dezember 1902 ist er gestorben. Sein Buch analysiert das Sexleben des Menschen, und vor allem analysiert es all das, was als krankhaft angesehen wird: sexuelle Handlungen aller Art, die nicht der Fortpflanzung dienen, also »wider natürliche«, »pathologische Erscheinungen«.
Mit dem Blick des Arztes, der sich über einen besonders interessanten Krankheitsfall beugt, behandelt Krafft-Ebing die Homosexualität, diese »Perversion«, sogar besonders ausführlich. Von Auflage zu Auflage hat er immer neue Fallbeispiele und autobiografische Zuschriften dieser »Stiefkinder der Natur« aufgenommen. Thomas Mann kennt das Buch genau. Ob ihn je eine Lektüre so erschüttert hat?
Ebenfalls im Novellenband Tristan erscheint 1903 Tonio Kröger. Fast alles, was Thomas Mann schreibt, hat eigenes Erleben oder zumindest selbst Beobachtetes als Kern. Sein erster Roman ist eine literarische Verwandlung der eigenen Lübecker Herkunft, Kindheit und Familiengeschichte. Und doch ist Tonio Kröger die erste wirklich radikal autobiografisch grundierte Erzählung. Näher könne man ihm persönlich nicht kommen, als wenn man diese Erzählung lese, schreibt er einem Kollegen, der seine persönliche Unzugänglichkeit moniert hat.
Die Hauptfigur ist ein Schriftsteller, der sich nach dem Leben sehnt, nach Liebe und Zugehörigkeit, der sich in die Blonden und Blauäugigen, die Einfachen und Nichtintellektuellen verliebt, in Pubertätsjahren in einen Jungen, der aber als Künstler ausgeschlossen ist von den »Wonnen der Gewöhnlichkeit«. Dieser Tonio Kröger reist in seine nordische Heimat und nach Dänemark und findet schließlich einen Weg, Leben und Kunst zu versöhnen; zumindest ein wenig: indem er den Gegensatz überwinden und seine kalte Welt des Künstlers wärmen und erhöhen will durch die Liebe zu den »hellen Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und Gewöhnlichen«.
Liebe trotz Distanz, kann das gut gehen? Und überhaupt: Ist das nur ein literarisches Gedankenspiel oder ein Vorsatz zum Handeln? Im wahren Leben ist Thomas Mann im Februar 1903 nach Berlin gereist. Er liest aus Tonio Kröger und freut sich über seinen beginnenden Erfolg als Schriftsteller. Und dann küsst er dort ein Mädchen. Aber ist er nicht in Paul Ehrenberg verliebt, den Studenten und Maler, der einfließt in die Figur des Hans Hansen, so schmerzlich geliebt von Tonio Kröger? Aus Berlin schreibt Thomas Mann einen Brief heim nach München an Paul (und an dessen Bruder). Vom Berliner Trubel schreibt er und »bin auch dabei!«. Das Mädchen und den Kuss erwähnt er nicht. Seinen Brief unterzeichnet er mit »Tonio Kröger«.
Liebe, Sehnsucht und literarische Anspielungen sind wohl vergeblich beim realen Werben um den Blonden und Blauäugigen, wie er mittlerweile ahnt. Wenige Monate nach dem Brief aus Berlin nimmt Thomas Mann noch einmal Anlauf und schickt Paul Ehrenberg ein Foto von sich. Auf die Rückseite hat er ein Gedicht geschrieben:
Hier ist ein Mensch, höchst mangelhaft:
Voll groß und kleiner Leidenschaft,
Ehrgeizig, eitel, liebegierig,
Verletzlich, eifersüchtig, schwierig,
Unfriedsam, maßlos, ohne Halt,
Bald überstolz und elend bald,
Naiv und fünf mal durchgesiebt,
Weltflüchtig und doch weltverliebt,
Sehnsüchtig, schwach, ein Rohr im Wind,
Halb seherisch, halb blöd und blind,
Ein Kind, ein Narr, ein Dichter schier,
Schmerzlich verstrickt in Will’ und Wahn,
Doch mit dem Vorzug, daß er Dir
Von ganzem Herzen zugethan!
Eine Annäherung in selbstironischer Verkleidung. Was Paul Ehrenberg davon hält? Nur wenige Wochen nach dem neuen Anlauf, Paul zu umwerben, beobachtet Thomas Mann auf einem Gartenfest in München eine junge Frau. Seinem engsten Jugendfreund Otto Grautoff berichtet er von diesem Erlebnis und malt sich und ihm ein »Zaubermärchen« aus. Wie seltsam, meint er, dass Otto schon wieder Zeuge und Mitwisser ist, genau wie damals, als er sich auf dem Schulhof in Lübeck in den Mitschüler Willri verliebte. Was aus seinem Zaubermärchen wird, steht in den Sternen. Otto soll jedenfalls nicht über die Sache reden und schon gar nicht Alfred Kerr gegenüber, dem berühmten Theater- und Literaturkritiker. Offenbar weiß er, dass Kerr sich bereits vergeblich um die junge Katia bemüht hat, die ihm auf dem Gartenfest ins Auge gefallen ist.
Gar kein Glück in der Liebe? In der Literatur jedenfalls nicht. Auch nicht im Roman Buddenbrooks, zwei Jahre zuvor erschienen. Verfall und Unglück beherrschen auch diese Familiengeschichte, von der sich längst herumgesprochen hat, dass sie viel mit der eigenen Familie des Autors zu tun hat. Aber die Figuren sind lebendig und trotz ironischer Distanz mit Sympathie geschildert, ein fesselnder, brillanter Roman; und alle lieben Tony, dabei hat sie am meisten Pech in der Liebe. Buchhändlerisch ein stockender Beginn: Über tausend Seiten auf zwei Buchbände verteilt, das fand hier und da Anerkennung in der Kritik, aber kaum Käufer. Nun bringt Samuel Fischer die Familiengeschichte auf Dünndruckpapier in einem Band und damit preisgünstig heraus – und der Erfolg ist da. Kurz nach Weihnachten 1903 kommt bereits die 15. bis 18. Auflage in den Buchhandel.
Das Jahr 1903 ist ein Entscheidungsjahr. Am 5. Dezember schreibt Thomas Mann seinem Bruder einen Brief, es geht um dessen neuen Roman Die Jagd nach Liebe. Siebzehn handschriftliche Seiten lang erklärt er, wie schrecklich er dieses Buch findet, und nicht nur das Buch, eigentlich alles, was er macht und schreibt. Heinrich Mann reibt sich die Augen, als er den Vorwurf »Wirkungssucht« liest und dass er vom Ehrgeiz getrieben sei, dem Buddenbrooks-Erfolg etwas Eigenes entgegenzusetzen.