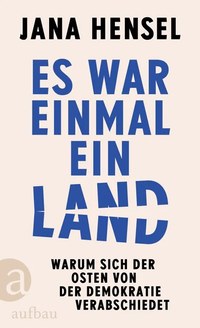Über dieses Buch
Dieses Buch bezieht Position: für eine demokratische, soziale, solidarische Gesellschaft und für einen nüchternen Blick auf die Wirklichkeit. Es wendet sich damit gegen jenen politischen Zeitgeist, der sich nach wie vor am besten mit dem Schlagwort des »Neoliberalismus« fassen lässt. Dahinter steht ein Denken, das sich seit Mitte der 1970er Jahren immer weiter durchsetzte, das in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren schier alternativlos erschien und das noch heute (nicht nur) die Politik dominiert. Auch wenn dieser Neoliberalismus verschiedene – teils widersprüchliche – Strömungen kennt, so teilen seine Anhängerinnen und Anhänger doch mindestens zweierlei: erstens eine marktextremistische Grundhaltung, der zufolge Markt, Konkurrenz und Privateigentum dem höchsten Wohle dienlich seien; zweitens die Überzeugung, dass dem Staat in der Durchsetzung von Markt, Konkurrenz und Privateigentum eine zentrale Rolle zukomme, er sich ansonsten aber aus dem wirtschaftlichen Geschehen herauszuhalten habe.
Märkte sind für den Neoliberalismus also nichts einfach Gegebenes. Sie werden gemacht. Gesellschaften als Markt-Gesellschaften zu gestalten, ist sein bewusstes Ziel. Und das weit über Wirtschaft im eigentlichen Sinne hinaus: Unter Schlagworten wie etwa »Selbstverantwortung«, »Freiheit«, »Leistung«, »Anreiz« oder »Wettbewerb« sollen Marktprinzipien in immer mehr Bereichen von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft wirken. Dafür werden Schutzvorkehrungen an den Arbeitsmärkten geschleift, die soziale Sicherung um- und abgebaut, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen privatisiert, Regulierungen von Märkten und Unternehmen um- und abgebaut, staatliche Handlungsmöglichkeiten beschränkt, Steuern gesenkt und nicht zuletzt bestimmte Begriffe und Vorstellungen in den Köpfen verankert. Und es werden Feindbilder geschaffen: das vom teuren Hängematten-Wohlfahrtsstaat etwa, von halsstarrigen Gewerkschaften, von selbstsüchtigen Politikerinnen, von faulen Armen und wirklichkeitsfremden Sozialromantikern.
Wer Politik in Medien und Öffentlichkeit wahrnimmt, kommt nicht umhin, sie zu hören: Die Argumente, warum neoliberale Politik sinnvoll und richtig sei; warum diese und jene Maßnahme absolut zwingend so und nicht anders umgesetzt werden müsse. Und zumindest wer politisch interessiert ist, kommt nicht umhin, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dieses Buch will dabei unterstützen: beim Verstehen und beim politischen Argumentieren und Streiten für eine demokratischere, sozialere und solidarischere Gesellschaft.
***
Wir formulieren in den nachfolgenden Kapiteln auf der Grundlage von Zitaten aus Presse und Verbandspublikationen 101 neoliberale Märchen – also falsche oder irreführende, in jedem Fall aber verbreitete Behauptungen und Annahmen. Sie decken ein breites Spektrum verschiedenster Politik- und Gesellschaftsbereiche ab. Wir zeigen jeweils, was diese (kursiv gedruckten) Märchen zu Märchen macht. Wir zeigen, weshalb das dahinterstehende Denken gefährlich ist. Und wir zeigen, wie eine andere Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aussehen kann.
02: »Flexiblere Arbeitsmärkte führen zu mehr Arbeitsplätzen!«
Es war einmal eine Stiftung, die sich mit der Unterstützung neoliberalen Gedankenguts schon immer ganz besonders hervortat. So auch 2014, als jene Bertelsmann-Stiftung einen Bericht zur deutschen Arbeitsmarktpolitik veröffentlichte, in dem es unter anderem hieß: »Durch die stärkere Verbreitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse und von Niedriglohnjobs ist der deutsche Arbeitsmarkt insgesamt flexibler und damit aufnahmefähiger geworden.«
Dieses Loblied zielte auf die so genannte Agenda 2010, ein politisches Programm, das von der früheren rot-grünen Bundesregierung Mitte der 2000er Jahre umgesetzt wurde. SPD und Grüne wollten den Arbeitsmarkt für Unternehmen angenehmer machen: Leistungen für Erwerbslose beispielsweise haben sie gekürzt und mit Strafen bei »Fehlverhalten« unterlegt, den Kündigungsschutz geschwächt, den Niedriglohnsektor ausgeweitet, atypische Beschäftigung erleichtert. Arbeit sollte billiger und flexibler werden. Hierdurch entstünden neue Jobs, hieß es; der Arbeitsmarkt werde »aufnahmefähiger«.
Die Wirklichkeit sah freilich anders aus. Zwar stieg die Zahl der Erwerbstätigen und der abhängig Beschäftigten in den Jahren nach der Agenda 2010 an. Allerdings war ein nennenswerter Teil dieser Entwicklung schlicht darauf zurückzuführen, dass Arbeit auf mehr Köpfe verteilt wurde. Die Zahl der abhängig Beschäftigten ist in Deutschland zwischen 2005 und 2017 um 14,5 Prozent angestiegen, die Zahl der gearbeiteten Stunden aber nur um 8,5 Prozent.
Und selbst dieser verhaltene Anstieg der Arbeitsstunden war keineswegs auf die Arbeitsmarkt-Flexibilisierung zurückzuführen. Vielmehr wuchsen die Reallöhne in Deutschland damals nach langer Zeit wieder. Der Aufschwung und die positive Beschäftigungsentwicklung seit etwa 2012 waren also ganz wesentlich von der Binnennachfrage getragen. Diese positiven Folgen steigender Löhne widersprachen den Annahmen der Agenda 2010: Ihr zufolge sollten ja niedrigere Arbeits- und Lohnkosten zur Schaffung von Arbeit führen, nicht höhere.
Hinzu kommt, dass Deutschland seit der Agenda 2010 seinen Exportüberschuss stark ausgeweitet hatte. Damit exportierte es seine Arbeitslosigkeit in andere Länder. Eine solche Politik ist weder vernünftig noch nachhaltig, sondern bildet die Saat zukünftiger Krisen. In den 2000er Jahren trug sie wesentlich zur so genannten Eurokrise bei.
Berücksichtigt man all dies, dann bleibt vom angeblichen Beschäftigungswunder der Agenda 2010 nichts übrig. Aber auch losgelöst von diesem viel diskutierten deutschen Beispiel kann die These von der beschäftigungsfördernden Wirkung flexibler Arbeitsmärkte nicht überzeugen. Der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Philipp Heimberger zeigte 2020, dass die internationale Forschungsliteratur einen Zusammenhang zwischen hoher Arbeitslosigkeit und hohen Arbeitsschutz-Bestimmungen nicht nachweisen kann. Der deutsch-niederländische Ökonom Alfred Kleinknecht belegte 2013, dass die Arbeitslosigkeit in Ländern mit höherer Flexibilität des Arbeitsmarkts durchschnittlich höher ist als in anderen Ländern.
Kleinknecht und der italienische Wirtschaftswissenschaftler Paolo Pini wiesen 2013 auf einen weiteren Zusammenhang hin: Eine höhere Flexibilität des Arbeitsmarkts führt zu einer geringeren gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität. Überraschen kann das nicht. Denn wenn Arbeit billig und flexibel ist, reduzieren Unternehmen ihre Investitionen in Maschinen und Weiterbildung. Die kosten schließlich Geld, das man sich sparen kann, wenn man Beschäftigte billig und flexibel einstellt und feuert. Für Beschäftigte wiederum ist es in flexiblen Arbeitsmärkten vorteilhafter, Innovationen zurückzuhalten. Diese könnten schließlich ihren Job kosten. Und auch Loyalität und Vertrauen bleiben in unverbindlicheren Arbeitsverhältnissen unterentwickelt, was zu ineffektiver und unmenschlicher Überwachung führt.
Eine Arbeitsmarktpolitik, die auf billig und flexibel setzt, führt also mittel- und langfristig zu geringerer Produktivität, weniger Innovationen und damit zu einem geringeren Wohlstand. Statt immer wieder das Märchen von den segensreichen Arbeitsmarkt-Flexibilisierungen zu singen, wäre daher eine stärkere Regulierung des Arbeitsmarktes angezeigt – mit dem Ziel, die Löhne und die Sicherheit der Arbeitsplätze zu erhöhen. Dies würde den privaten Konsum stabilisieren und Innovationen voranbringen: Binnennachfrage statt Billigarbeit also, Aufschwung statt Agenda.
14: »Gewerkschaften sind schädliche Kartelle!«
Es war einmal ein Oberpriester neoliberaler Wirtschaftswissenschaft, dem zahlreiche Jünger in Politik, Journalismus und Wissenschaft huldigten. Es war die Hoch-Zeit des Neoliberalismus, als besagter Hans-Werner Sinn seine Anhänger mit deftiger Dresche für die Gewerkschaften in Ekstase versetzte. In einem Interview mit Focus Money sagte er im Juli 2004: »Die Gewerkschaften sind ein Kartell derjenigen, die Arbeit haben. Und wie jedes Kartell dient es dazu, überhöhte Preise durchzusetzen. Würden sich die Löhne frei nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage bilden, gäbe es keine Arbeitslosigkeit.«
Hier kehrt eine neoliberale Argumentation wieder, die sich auch in anderen Zusammenhängen findet: Märkte seien effizient, deshalb sollten sich Preise frei bilden. Tun sie dies, so stelle sich ein »Gleichgewichtspreis« ein, der »den Markt räumt«. Jede Nachfrage finde dann ihr Angebot und jedes Angebot seine Nachfrage. Dies gelte auch für den Arbeitsmarkt, wo Löhne Preise für »Arbeit« (für Arbeitskraft) seien. Werden diese Preise politisch »überhöht«, so ergebe sich ein größeres Angebot an Arbeit, während die Nachfrage zurückgehe. Beschäftigte und Arbeitslose böten dann mehr Arbeitskraft an, als die Unternehmen benötigten. Es entstehe Arbeitslosigkeit, weil ein Teil der Beschäftigten zu den überhöhten Löhnen keine Beschäftigung finde. Und genau dies sei die Schuld der Gewerkschaften: Sie erzwängen mit Streiks und Tarifverträgen ein höheres Lohnniveau, als sich am Markt sonst bilden würde.
Das Problem an diesem Argument: Arbeitskraft ist keine Ware wie jede andere. Und folglich funktioniert auch der Arbeitsmarkt nicht so, wie sich die Neoliberalen das vorstellen. Dafür gibt es mindestens drei Gründe: Erstens sind diejenigen, die die »Ware« Arbeitskraft verkaufen (müssen), existentiell darauf angewiesen, von diesem Verkauf leben zu können. Wenn sie durch Erwerbstätigkeit nicht genug Geld einnehmen, dann werden sie sich einen zweiten Job suchen. Oder einen dritten. Oder sie weiten ihre Arbeitszeit aus. Ein niedriger »Preis« (Lohn) führt folglich nicht zu einem kleineren, sondern zu einem größeren Angebot an Arbeitskraft. (Spiegelbildlich ermöglicht ein hoher Lohn, weniger zu arbeiten, was zu einem geringeren Angebot an Arbeitskraft führen kann.) Das unterscheidet die »Ware« Arbeitskraft von anderen Waren: Das Angebot an Kartoffeln und Haarschnitten geht zurück, wenn der Preis dafür sinkt – das Angebot an Arbeitskraft aber nimmt zu. Die Ökonomie nennt das ein inverses Angebotsverhalten. Dieses kann einen Teufelskreis auslösen: Ein größeres Angebot an Arbeitskraft senkt die Löhne, was zu einem noch größeren Angebot an Arbeitskraft führt, was die Löhne noch mehr senkt. Diese Spirale nach unten lässt sich nur stoppen, wenn Entgelte einheitlich festgelegt werden. Das leisten in erster Linie Gewerkschaften und Tarifverträge.
Hinzu kommt zweitens: Nur wenn innerhalb einer Branche alle Unternehmen die gleichen Löhne bezahlen, konzentriert sich der Wettbewerb zwischen ihnen auf die Qualität der Produkte und die Effizienz der Produktion. Ein Wettbewerb um die niedrigsten Löhne oder die schlechtesten Arbeitsbedingungen hingegen ist gesellschaftlich und wirtschaftlich schädlich.
Der dritte Grund dafür, dass der Arbeitsmarkt ein besonderer Markt und Gewerkschaften keine schädlichen Kartelle sind, ist folgender: Löhne sind nicht nur Kosten, die die Nachfrage der Unternehmen senken, sondern sie sind immer zugleich Einkommen, die indirekt die Nachfrage der Unternehmen erhöhen. Das tun sie, weil die Beschäftigten einen Großteil ihrer Einkommen wieder ausgeben. Sie kaufen Produkte, die die Unternehmen produzieren. Und sie kaufen mehr Produkte, wenn die Löhne steigen. Wenn die Unternehmen auf diese Weise aber ihre Absätze und Umsätze steigern können, so werden sie investieren und entsprechend Menschen einstellen. Und zwar nicht trotz, sondern wegen steigender Löhne.
Kurzum: Eine Volkswirtschaft ist ein Kreislauf. Was A ausgibt, nimmt B ein. Wer die richtigen politischen Schlussfolgerungen ziehen möchte, muss alle Dimensionen dieses Kreislaufs berücksichtigen – anstatt eindimensional und neoliberal ein Zerrbild von Löhnen, Tarifverträgen und Gewerkschaften zu zeichnen.
46: »Exportüberschüsse sind das Ergebnis guter Wirtschaftspolitik!«
Es war einmal ein sozialdemokratischer Kanzlerkandidat, der im Wahlkampf die soziale Gerechtigkeit zu seiner Kernbotschaft erkor. Damit weckte jener Martin Schulz erfolgreich Hoffnungen auf Abkehr der SPD vom Neoliberalismus. Dass er diese Hoffnungen enttäuschen würde, machte er gleichwohl früh klar. Im Mai 2017 legte er in einer wirtschaftspolitischen »Grundsatzrede« bei der Industrie- und Handelskammer Berlin ein Bekenntnis zur deutschen Exportorientierung ab: »Die Kritik an unseren hohen Handelsbilanzüberschüssen halte ich für falsch. Wir müssen uns nicht dafür schämen, erfolgreich zu sein. Unsere Exporte sind das Ergebnis der guten Arbeit, die hier im Lande geleistet wird. Wir sind erfolgreich und wir werden es bleiben.«
Gerade in Deutschland, das seit Jahrzehnten mehr exportiert, als es importiert, gelten Handelsbilanz- bzw. Exportüberschüsse als Ausweis guter Wirtschaftspolitik. Wieder und wieder feierte das Land seine »Export-Weltmeisterschaften«, fast als ginge es um Fußball. Tatsächlich aber gibt es dafür keine überzeugenden Gründe.
Wenn ein Land einen Exportüberschuss aufweist, es also mehr Güter und Dienstleistungen exportiert, als es importiert, dann müssen andere Länder zwingend mehr importieren, als sie exportieren. (In beiden Fällen spricht man von Außenhandels-Ungleichgewichten.) Schließlich ist der Export des einen Landes stets der Import eines anderen. Auf den ersten Blick mögen solche Exportüberschüsse vorteilhaft erscheinen: Die dahinterstehende Beschäftigung ist faktisch ein Export der eigenen Arbeitslosigkeit. Außerdem müssen sich die Importüberschuss-Länder verschulden, um ihren Importüberschuss zu finanzieren – das Exportüberschuss-Land baut ihnen gegenüber entsprechende Forderungen auf. Es wird zum Gläubiger. Diese Verschuldung der Importüberschuss-Länder kann überwiegend privat sein, wie in den 2000er Jahren in Spanien, oder sie kann größtenteils öffentlich sein, wie in Griechenland in den Jahren vor Ausbruch der Eurokrise. Bei genauerer Betrachtung erweist sich diese vermeintliche Vorteilhaftigkeit aber als Trugschluss: Dauerhafte Exportüberschüsse (und die daraus resultierende Verschuldung) destabilisieren die Weltwirtschaft und die globalen Handelsbeziehungen. Sie machen die Überschussländer übermäßig stark von der Weltkonjunktur abhängig. Sie befördern Krisen, die in die Vernichtung der Forderungen von Überschussländern gegenüber dem Ausland münden können. Vor allem aber werden Exportüberschüsse im Inland teuer erkauft – durch Lohnverzicht, unzureichende Staatsausgaben, Sozialabbau und mehr soziale Ungleichheit.
Tatsächlich beruhen die deutschen Exportüberschüsse nicht auf »guter« oder »erfolgreicher« Arbeit, wie Schulz & Co. behaupten, sondern auf einer unzureichenden Binnennachfrage. Ein Land mit einem starken Wachstum der Binnennachfrage wird im Regelfall auch seine Importe ausweiten. Die Binnennachfrage setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Investitionen der Unternehmen, staatliche Ausgaben und privater Konsum. Wenn etwa der private Konsum aufgrund einer guten Lohnentwicklung boomt, dann stärkt dies die Binnennachfrage. Ein guter Teil davon kommt Auslandswaren zugute und erhöht deshalb die Importe.
Deutschland wies allerdings seit den 1990er Jahren eine extrem schwache Binnennachfrage auf. Dies gilt für alle drei Komponenten: Der Konsum war gehemmt aufgrund einer schwachen Lohnentwicklung und der Zunahme unsicherer Arbeit, die staatliche Nachfrage aufgrund einer gebremsten Entwicklung der Staatsausgaben und der öffentlichen Investitionen. Auch die Unternehmensinvestitionen entwickelten sich schwach – nicht trotz, sondern wegen einer massiven Umverteilung zu Gunsten der Profite.
Eine im Verhältnis zum Ausland schwache Lohnentwicklung dämpft dabei nicht nur die Konsumnachfrage und damit die Nachfrage nach importierten Konsumgütern. Sie verbessert vielmehr auch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Im Inland produzierte Güter und Dienstleistungen werden im Verhältnis zu denen des Auslands billiger. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt in einer Währungsunion (wie dem Euroraum), in der es keine währungspolitischen Möglichkeiten mehr gibt, dem entgegenzuwirken. Der hohe deutsche Exportüberschuss ist folglich Ergebnis einer Strategie, die auf eine hohe Auslandsnachfrage nach deutschen Produkten zielt und die zugleich die Binnennachfrage und damit die Nachfrage nach Importen ausbremst.
Eine solche Strategie ist mit sozialer Gerechtigkeit nicht in Einklang zu bringen. Denn sie geht vor allem auf Kosten der abhängig Beschäftigten und sozial Benachteiligten: Die schwache Binnennachfrage beruht auf politischen Maßnahmen, die auf niedrigere Löhne, unsichere Arbeit, Sozialabbau, eine Schwächung der Gewerkschaften und auf Umverteilung von unten nach oben zielen. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass Exporte (in begrenztem Umfang) auch mit Qualität und Service zu tun haben können: Mit »guter« oder »erfolgreicher« Arbeit oder mit guter Wirtschaftspolitik hat all das nichts zu tun.
73: »Einkommensteuern belasten die Leistungsträger!«
Es war einmal ein junger Finanz-Staatssekretär der CDU, dessen Gespür für gefällige Wahlkampf-Parolen ebenso groß war wie seine Karrierehoffnungen. Sein Name war Jens Spahn, und im Juni 2017 sagte er der Deutschen Handwerks-Zeitung: »Wir wollen möglichst viele Leistungsträger entlasten. Und damit meine ich nicht Millionäre mit Jacht und Villa. Ich meine die Mittelschicht – Angestellte und Selbstständige.« Die Handwerksbosse werden es mit Befriedigung gelesen haben.
Wer in der Zukunft entlasten will, der unterstellt, dass in der Gegenwart (zu) viel belastet wird. In diesem Sinne will sich Spahn steuerpolitisch für »Leistungsträger« in die Bresche werfen. Das ist ein neoliberaler Dauerbrenner, vor allem in Wahlkampfzeiten – aus gutem Grund: Die Rede von der »Entlastung der Leistungsträger« dürfte auf breite Zustimmung stoßen. Dies umso mehr, als »Leistungsträger« in diesem Zitat ja sogar die »Mittelschicht« umfassen soll, der sich viele Menschen zurechnen.
Und doch dient diese Parole letztlich dazu, steuerliche Umverteilung von unten nach oben zu rechtfertigen (und zugleich unkenntlich zu machen). Sie macht dies aus mindestens zwei Gründen: Erstens bezahlt der ärmere Teil der Bevölkerung gar keine Einkommensteuer. Die Einkommen dieser Menschen sind schlicht zu niedrig. Viele von ihnen gehen allerdings sehr wohl einer Arbeit nach; oft genug werden ja gerade besonders belastende und anstrengende Tätigkeiten schlecht bezahlt. Viele Menschen mit geringem Einkommen können, ja müssen also durchaus als »Leistungsträger« im Sinne der (auf Erwerbsarbeit verkürzten) Definition von Jens Spahn gelten. Von einer Senkung der Einkommensteuer oder anderer Steuern hätten sie aber nichts.
Ganz im Gegenteil: Verschlechtern oder verteuern sich aufgrund geringerer Steuereinnahmen bestimmte öffentliche Leistungen, so trifft dies die Ärmsten mehr als Reiche. Denn vor allem erstere sind auf preiswerte und gute öffentliche Dienste (wie etwa verlässliche Kitas, Schulen, Jugendzentren und öffentliche Verkehre) sowie intakte Infrastrukturen angewiesen. Auch trifft es die Ärmsten besonders, wenn Einkommensteuer-Senkungen etwa durch höhere Umsatzsteuern gegenfinanziert werden, wie Neoliberale es gerne fordern.
Hinzu kommt zweitens: Am Ende wird bei jeder Entlastung des mittleren Einkommensbereichs eine mindestens genauso hohe, wenn nicht noch höhere Entlastung der Spitzenverdienenden herauskommen. Der Grund dafür ist die progressive Gestaltung der Einkommensteuer, wie sie fast alle Staaten haben. Wer ein höheres Einkommen bezieht, kann und soll mehr zum Gemeinwesen beitragen. Deshalb sind die Steuerzahlungen auf hohe Einkommen in der Regel höher als auf kleine und mittlere. In vielen Ländern (auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz) wird dies dadurch gewährleistet, dass die Steuersätze für hohe Einkommens-Teile höher sind als für untere und mittlere Einkommens-Teile. Auf die ersten beispielsweise 50.000 Euro bezahlt ein Millionär dann (unter ansonsten gleichen Voraussetzungen) die gleichen Steuern wie jemand, dessen Einkommen diese 50.000 Euro nicht überschreitet. Erst auf die darüber hinausgehenden Einkommensbestandteile bezahlt der Millionär einen höheren Steuersatz.
Die Konsequenz dessen ist, dass eine Entlastung mittlerer Einkommensbestandteile zu einer Entlastung nicht nur der mittleren, sondern auch der hohen Einkommen führt. Im Klartext: Nicht nur Spahns »Angestellte und Selbständige« freuen sich über Steuersenkungen, sondern auch und gerade Großunternehmerinnen und Top-Manager.
Dieser unschöne Effekt lässt sich vermeiden. Dazu ist es notwendig, nicht einfach nur die Steuersätze auf untere und mittlere Einkommens-Bestandteile zu senken, sondern zugleich die Steuersätze auf hohe Einkommens-Bestandteile anzuheben. Davon aber wollen Spahn & Co. nichts wissen. Und genau aus diesem Grund ist es reine Augenwischerei, wenn sie behaupten, sie zielten mit ihren Entlastungen auf »die Mittelschicht«. Ein neoliberales Märchen eben.
89: »Öffentlich-Private Partnerschaften machen Politik wieder handlungsfähig!«
Es war einmal ein Vorstandsmitglied eines großen deutschen Baukonzerns. Sein Name – Nikolaus Graf von Matuschka – war lang und edel. Seine Sorge um die Verkehrsinfrastruktur war groß. Im Dezember 2014 sprach er seinen Freunden vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft für deren Verbandszeitschrift Folgendes ins Mikrofon: »Öffentlich-Private Partnerschaften können das Finanzierungsproblem der deutschen Infrastruktur lösen und helfen, den Modernisierungsstau abzubauen. Sonst steuern wir unweigerlich auf einen Verkehrsinfarkt zu.«
Öffentlich-Private Partnerschaften sind eine Form von Privatisierung. Dabei geht eine staatliche Stelle einen längerfristigen, zeitlich begrenzten Vertrag mit einem privaten »Partner« ein. Dieser übernimmt umfassend die Errichtung oder Sanierung sowie die damit zusammenhängende Planung, den Betrieb und meist auch die Finanzierung einer Infrastruktur. Dafür erhält der Private reichlich Entgelte. Die öffentliche Seite wiederum ist zu entsprechenden Zahlungen verpflichtet. ÖPP-Projekte stellen damit faktisch eine Form der Verschuldung dar, sie werden aber statistisch und politisch oftmals gar nicht als Verschuldung gewertet. Mit ihnen lässt sich daher elegant die Aufnahme von Krediten verstecken. Solche Modelle seien geeignet, den Staat bei den erforderlichen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur wieder handlungsfähig zu machen – so sagen es jedenfalls viele Neoliberale.
Und ihnen spielt dabei ein tatsächliches Problem in die Hand: Die Haushaltspolitik der zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte hat die Handlungsfähigkeit des Staates drastisch reduziert. Ausgabenkürzungen haben einen enormen Investitionsstau herbeigeführt. Ausgeglichene öffentliche Haushalte gelten seit Jahrzehnten als anzustrebendes politisches Ziel, und Verschuldungsregeln wie die deutsche »Schuldenbremse« setzen den öffentlichen Ausgaben engste Grenzen. Neue Kredite aufzunehmen gilt als schmutziges Geschäft; höhere Steuern zu erheben gilt als unmoralisch oder ökonomisch unklug. In der Folge zerfallen Schul- und Verwaltungsgebäude, Straßen, Brücken und Schienen, weil nur noch unzureichend investiert wird.
In gewisser Weise sind Öffentlich-Private Partnerschaften vor diesem Hintergrund durchaus folgerichtig. Und sie sind attraktiv: Für Bauindustrie und Finanzwirtschaft, weil sich mit ÖPP gutes Geld verdienen lässt. Für die Gesellschaft, weil sie auf eine intakte Infrastruktur angewiesen ist. Für die politische Elite, weil es ohne ÖPP weniger Flatterbänder zum Durchschneiden gäbe.
Sind ÖPP deshalb aber tatsächlich Lösungen für das »Finanzierungsproblem der deutschen Infrastruktur«? Mit Sicherheit nicht. Sie sind überteuert, weil sie Renditebedürfnisse der Privaten bedienen und hohe Zinskosten erwirtschaften müssen. Sie sind manipulationsanfällig, weil sie für alle Beteiligten falsche Anreize setzen. Sie sind undemokratisch, weil sie kaum mehr rückgängig gemacht werden können, also Bindungswirkung für viele Jahrzehnte (oder für immer) entfalten. Auch sind sie in ihrer Komplexität für demokratische Entscheidungsgremien schlicht nicht zu bewältigen. Und nicht zuletzt sind sie intransparent, weil die entsprechenden Verträge stets geheim gehalten werden.
Was ÖPP-Freundinnen und -Freunde zudem gerne übersehen: Die mangelnde Handlungsfähigkeit des Staates ist politisch gemacht. Sie ist eine Konsequenz neoliberaler Politik. Es waren bewusste (Fehl-) Entscheidungen, die Verschuldungsmöglichkeiten der öffentlichen Haushalte auf fast null zu reduzieren. Und es waren bewusste (Fehl-) Entscheidungen, deren finanzielle Misere durch Steuergeschenke zusätzlich zu verschärfen. Falsche politische Weichenstellungen lassen sich aber auch wieder umkehren. Das ist allemal klüger, als immer findigere, immer teurere und immer undemokratischere Modelle zu ihrer Umgehung zu entwickeln. Oder mit anderen Worten: Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Übrigens: Nikolaus Graf von Matuschkas Unternehmen verdient sein Geld unter anderem mit ÖPP. Dass er obiges Zitat in einem Interview mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft geäußert hat, ist daher kein Zufall. Denn die Finanzindustrie gehört zu den wichtigsten Befürwortern von Öffentlich-Privaten Partnerschaften, hofft sie doch auf profitable Anlagemöglichkeiten.