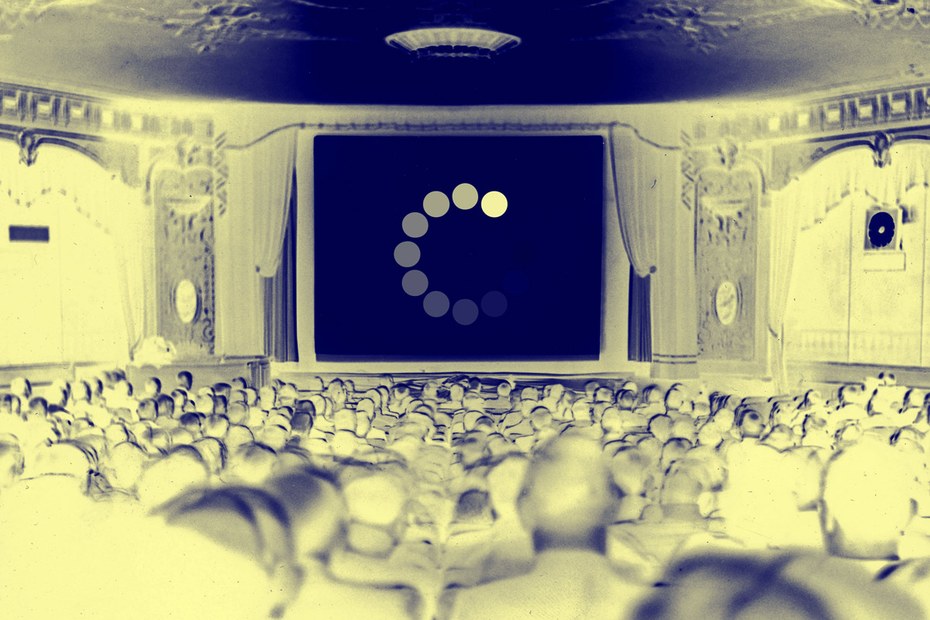Woran gerade kein Mangel herrscht, das sind Voraussagen. Manche davon betreffen auch das Kino. Wenig überraschend fallen auch hier die Aussichten im Moment tendenziell eher düster aus. Einerseits erleidet die Kino- und Filmindustrie in diesen Wochen dasselbe Schicksal wie alle Branchen, die zum Stillstand gebracht wurden: Dreharbeiten sind unterbrochen, Filmstarts verschoben und Kinos geschlossen. Der neue James Bond (dessen „Faust aufs Auge“-Titel Keine Zeit zu sterben wie ein Witz von Dieter Nuhr wirkt) soll erst im Herbst ins Kino kommen, während die Produktionsunterbrechungen an den Sets von Mission: Impossible 7 und Matrix 4 bedeuten könnten, dass die Fans ihre Terminkalender für 2021 womöglich überarbeiten müssen. Solche Ungewisshei
nd Matrix 4 bedeuten könnten, dass die Fans ihre Terminkalender für 2021 womöglich überarbeiten müssen. Solche Ungewissheiten verunsichern. Aber – ohne die Nöte all der im Filmbusiness prekär Beschäftigten kleinreden zu wollen – daraus ergibt sich nicht automatisch der Untergang für das Kino als solches.Zumal die Mehrheit der Filmsüchtigen auf ihre Lieblingsdroge gar nicht verzichten muss. Nicht nur, dass im Durchschnittshaushalt gefühlt 20 DVDs in Vollverschweißung im Regal liegen, die man endlich mal aufreißen könnte. Jeder zweite Haushalt in Deutschland war bereits 2019 an einen Streamingdienst wie Amazon, Netflix oder MagentaTV angeschlossen. Seither kamen mit Apple TV+ und Disney+ weitere Anbieter dazu, die aktuelle Situation treibt allen möglichen Video-on-Demand-Anbietern die Kunden regelrecht zu. Wer hier die Krisengewinnler sind, ist leicht auszumachen.Legales Streaming hat schon vor COVID-19 das illegale Streaming als neuer Hauptfeind des Kinos abgelöst. Im vergangenen Jahr sensibilisierte die Weigerung des Festivals von Cannes, Netflix-Filme in seinem Wettbewerb zu zeigen, die breitere Öffentlichkeit für die Konkurrenz der Geschäftsmodelle. Mit den aktuellen Schließungen geht nun die Angst um, dass sich die Filmliebhaber das Kinogehen ganz abgewöhnen könnten.Selbstgewählte PausenWomöglich könnten sie entdecken, dass der eigene 4K-Fernseher schärfere Bilder zeigt als Saal 2 des alten Programmkinos um die Ecke. Oder dass im heimischen Wohnzimmer niemand durch lautes Lachen den letzten Witz von James Bond übertönt. Oder wenn doch, dass man dann zurückspulen kann. Und überhaupt: dass man zum Streaming nie zu spät kommt, die Auswahl größer ist und kein 30-minütiger Werbeblock vorab die Konzentration erschöpft. Denkt man jetzt noch an kühle Drinks und selbstgewählte Pinkelpausen, ergibt sich eigentlich eine verheerende Bilanz fürs Kino: Streaming kann alles besser. Das Kino hat dagegen nur den einen Vorteil: Es ist kein Streaming. Das aber könnte der ganz entscheidende sein.Seinen größten Rückschlag hat das Kino sowieso bereits hinter sich. Er geschah in den 1950er Jahren mit der Verbreitung des Fernsehens. Der Niedergang ist lang verschmerzt, eine Kinobesucherzahl von 800 Millionen wie im Jahr 1956 wird nie wieder erreicht werden. Der Tiefpunkt der Statistik lag im Wendejahr 1990, mit 101 Millionen. Nicht zuletzt dank der technischen Aufrüstung der Multiplexe erholten sich die Zahlen dann wieder. Seit dem Höchststand von 178 Millionen 2001 zeichnet sich im schwankenden Hin und Her ein Abwärtstrend ab. Wobei bislang warmen Sommern und Fußballweltmeisterschaften immer noch ein größerer Einfluss als dem Streaming zugesprochen wurde. Außerdem sieht die Entwicklung europaweit gegenläufig aus: Da nehmen die Besucherzahlen zuletzt immer noch zu. In Großbritannien etwa wurde 2019 der höchste Wert seit 1970 erreicht. Vielleicht ist das Streaming nicht zwangsläufig der große Feind des Kinos?Zudem ist sich die Branche über die Bedeutung des Kinos bei der Filmauswertung im Grunde einig. Wie guter Wein durchlaufen Filme nämlich einen Veredelungsprozess, der mit dem Kinostart beginnt und in Fristen die Stationen DVD, VoD und TV-Ausstrahlung durchläuft. In Deutschland sind sie für geförderte Filme gesetzlich vorgeschrieben, die frei ausgehandelten Zeiten für davon nicht betroffene Werke sind meistens nur wenig kürzer. Keine noch so exklusive Streamingpremiere kann es bislang mit dem Modell des Kinostarts zur Aufwertung und Aufmerksamkeitsgenerierung aufnehmen.Verschiedene Verleiher versuchen sich derzeit an Wegen der Überbrückung. Während Majors wie Universal und Disney ihre „wertvollen“ Titel verschieben und für andere betont aggressiv auf VoD-Starts setzen, stellt etwa der deutsche Indie-Verleiher Grandfilm Titel seines Katalogs gegen Bezahlung ins Netz und verspricht, die Einnahmen mit den Kinos zu teilen. Ein anderer Verleiher, eksystent, wertet den für April vorgesehenen Film Isadoras Kinder über das Portal kino-on-demand.com aus, das ebenfalls einen Teil der Einnahmen mit den Kinos teilt, wobei sich der Zuschauer das konkrete Kino aussuchen kann. Die Akzeptanz für solche Modelle mag wachsen, aber noch ist es so, dass die mit den vielen Streamingabos auch diejenigen sind, die am häufigsten ins Kino gehen.Der erzwungene Verzicht rückt unterdessen wieder klarer ins Bild, worauf man da gerade eigentlich verzichtet: Ins-Kino-Gehen ist so viel mehr als bloßes Filmeschauen. Nicht nur, weil sich die Aufregung manchmal weniger auf den Film bezieht als auf den Menschen, der mitkommt. Das Kino ist zugleich große Öffentlichkeit und eine ideale Heimat für Einsame, die nicht länger zu Hause sitzen wollen, ein Ort des beiläufigen Genießens genauso wie für gemeinschaftliche Ausgelassenheit. Dieses schöne Oszillieren zwischen kollektiver Teilhabe und diskreter Dunkelheit, mit seinen Kennenlern- und Verbergungsmomenten, kann keine noch so gut bedienbare Webseite und kein Live-Twittern ersetzen. Mag sein, dass sich das Filme-Gucken und das Ins-Kino-Gehen in den nächsten Jahren immer weiter auseinanderentwickeln. Das Kino an sich hat die gleiche Zukunft wie eh und je: dunkel, aber voller Möglichkeiten.