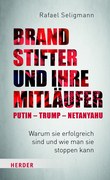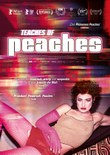Nachher radle ich noch einmal an den See zum Schwimmen, für eine kleine Abkühlung vor dem Rückflug. Die letzten Tage waren ein fast schon tropischer Hitzeflash, den auch kurze Gewitter kaum abkühlten. Ein Treibhaus wird die Stadt. Ist das notwendige Randbedingung für das Entdecken der nächsten Literatur?
Wolf Donner hat vor vierzig Jahren die Berlinale aus der Sommerhitze in die Kälte des Berliner Februars verlegt. Das ist ihr gut bekommen. So eine trübe frühwinterliche Kälte bekäme vielleicht auch dem Bachmannpreis besser. Es gäbe weniger Ablenkung. Das Frösteln kühlte den Verstand der Jury, machte ihn vielleicht auch wieder schärfer.
Die intellektuelle und rhetorische Unwucht in der Jury hat man bisher hingenommen als Randbedingung, die dem Proporz eines deutsch-österreichisch-schweizerischen Literaturpreises geschuldet ist. Die Herkunftsnachweise der Jurorinnen und Juroren können es nicht mehr sein. Denn mit dem neu an Bord gekommenen Michael Wiederstein sitzt, neben Hubert Winkels, Sandra Kegel und Meike Feßmann ein vierter Deutscher in der Runde, während der Schweizer Gmünder als Österreicher gilt. Bei der Schweizerin Hildegard Keller hat man den Eindruck, dass sie das Weite sucht, egal wo sie es findet.
Kegels Hitliste
Das Suchen nach Talenten der nächsten Literatur gelingt der seit drei Jahren jurierenden Kritikerin Sandra Kegel offenkundig besser als ihren teils schon langjährigen Kollegen. Die Bachmannpreise 2015, 2016 und 2017 gingen an Nora Gomringer, Sharon Dodua Otoo und nun Ferdinand Schmalz, alle drei von Kegel eingeladen. Sie hat die von ihr eingeladenen Autoren selbst angesprochen und nicht darauf gewartet, dass aus einer Flut von zugesandten Manuskripten ihr eine Perle ins Auge springt.
Das ist im übrigen auch deshalb eine abwegige Regel im Bewerb, wie sie den Zirkus hier nennen, weil Literarische Agenten und Lektoren ihre Arbeit gleichfalls aufgeben müssten, wenn sie darauf warteten, dass ihnen etwas zugeschickt wird. Dass das auch vorkommt und – selten – zu Erfolgen führt, ist die Ausnahme.
Das Neue verdankt sich nicht treibhausartiger Zucht. Das ist übrigens ein gut verborgenes Bild in Eckhart Nickels „Hysteria“-Text. Sein Satz, „mit den Himbeeren stimmte etwas nicht“ ließe sich als Ausdruck für Unwuchten im 41. Jahr des Bachmannpreises lesen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die Jury sich selbst auf die Probe stellte und untersucht, aus welchen Quellen, mit welchen Resultaten, durch welche Netzwerke erfolgreiche Texte und Autoren in den Bewerb gelangen und aus welchen nicht. Vielleicht wäre Kathrin Passig, mit ihrer "Riesenmaschine" im Rücken, dafür zu gewinnen, als „observer in residence“ die bisherigen Verfahren zu prüfen und dem Preis auf die Sprünge zu helfen.
Veranstalter und Jury müssen in sich gehen
Gibt es in der performativen Kritik von Texten auf offener Bühne eine Form, die einen anderen spielerischen Ernst möglich macht? In den Debatten dieses Jahres war zeitweilig offenkundiger Verdruss zu besichtigen. Im Eherecht nennt man das Zerrüttung. Am Ende bekommt es weder der Jury noch den Autoren gut, wenn ein Schlachtfest zu Lasten Dritter veranstaltet wird, nur weil ein schwelender Konflikt in der Jury selbst nicht gelöst werden kann. Der Unmut bekommt keinem.
Das liegt vielleicht auch daran, dass die Idee der „Entdeckung“ eine Art von Selbstbetrug darstellt. Was ist davon zu halten, wenn ein weltweit etablierter Autor in Wettbewerb zu Debütanten gebracht wird, ein Flugzeugträger gegen Jollen kämpft?
Das wäre mein Plädoyer dafür, einen Sängerkrieg zwischen schon großen (oder wachsenden) Namen mit einem Open Mike für die nächste Generation zu verbinden. Frei nach Willy Brandt: Nehmt auseinander, was auseinander gehört!
Bis zum nächsten Jahr ist ja noch etwas Zeit.