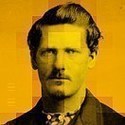Kleines »ø« mit Schrägstrich, deutsch-informelles »o«, oder wie man es spricht – »ö«? Ein Vorteil nordischer Namen ist, dass man es mit der Schreibweise nicht allzu eng nehmen muss. Das kleine »ø« ist schriftsprachlich korrekt. Das kleine »o« geht informell-schreibtechnisch durch. Und »ö« schließlich baut nicht nur aussprachetechnische Brücken, sondern kommt auch bei der Kurzvita von Ingvar Ambjørnsen auf der Webseite der Fischer Verlage so zum Einsatz – also bei den Profis. Kuriosität im vorliegenden Fall ist allerdings weniger das deutsch-untypische Laissez-faire in Sachen Rechtschreibung, sondern vielmehr der Umstand, dass Ambjørnsens Romanfigur Elling hierzulande weitaus mehr Menschen bekannt sein dürfte ihr Kreator.
Wer oder was ist Elling? Vorzustellen hat man sich unter ihm einen in Sachen Alltagsbewältigung dysfunktionalen, ins Skurrile gehenden Typen – in etwa die Art Figur, die der deutsche Regisseur Detlef Duck gern vor der Kamera einfängt. Der Unterschied: Ambjørnsens Elling ist nicht nur ein bißchen schräg drauf. Elling ist in der Sparte das große Programm: ein kindlich gebliebener, lebensuntüchtiger, dabei jedoch grundharmloser Sonderling, der Buch für Buch seine Umwelt erkundet und sich mit dieser – erwartungsgemäß, könnte man sagen – in den Crash-Modus begibt. Dass derartige Geschichten im Real Life selten spaßig verlaufen, unterschlägt der Autor keinesfalls. Das besondere Alleinstellungsmerkmal von Ambjørnsens Elling-Büchern sind somit weniger die Geschichten als solche, sondern vielmehr der Umstand, dass der Autor seine Leser(innen) dazu verführt, die Welt mit den Augen ebendieses Elling zu sehen.
Autoren werden älter; Figuren ebenso. Drei auf Ambjørnsens »Elling«-Figur basierende Geschichten wurden im Lauf der Jahre verfilmt: »Elling« (2001), das Prequel »Elling – Nicht ohne meine Mutter« (2003) und schließlich »Elling – Lieb mich morgen« (2005). Die vier ersten Bücher der Elling-Reihe erschienen zwischen 1993 und 1999. Beim Hamburger Verlag Edition Nautilus ist nunmehr der fünfte Elling-Roman herausgekommen: »Echo eines Freundes«. Ebenso wie Ambjørnsen ist auch Elling mit den Jahren nicht jünger geworden. Wenn auch nicht weniger entdeckungsfreudig. Im Alter von nunmehr 58 macht sich der – bislang nur betreute Wohnformen kennende – Protagonist auf nach Oslo, um erstmals in seinem Leben eine eigene Wohnung zu beziehen. Dass die Probleme mit den Alltäglichkeiten auf dem Fuße folgen und das Leben manchmal (zurück)beißt, ist dabei ausgemacht. Ebenso die Elling-typischen Fehlinterpretationen der Wirklichkeit: das (imaginierte) Interesse der Supermarkt-Verkäuferin an seiner Person beispielsweise, Posts auf Facebook oder mehr oder weniger sinistre Pläne seiner Vermieterin. Situationen, Interpretationen und Verwechslungen, die im Buch Situationskomik wie Tragik produzieren, im Endeffekt allerdings nichts weiter als übersteigerte Varianten dessen sind, was auch wir sogenannten »Normalen« uns als Gestern, Heute und Morgen zurechtreimen.
Mit das Auffälligste an Ingvar Ambjørnsen ist seine immense Produktivität. Sachbücher und zwei Kinderbuchreihen mit einbezogen hat er zwischenzeitlich rund 35 Bücher veröffentlicht. In seinen besten Zeiten produzierte der 1956 im norwegischen Tønsberg geborene Autor zwei Bücher pro Jahr. Anbjørnsen zu seinen Anfängen als Erfolgsschriftsteller: »Ich saß zu Hause und schrieb und schrieb. Ich habe im Frühjahr ein Kinder- oder Jugendbuch und im Herbst einen Roman herausgebracht – oder umgekehrt. Das lief so die nächsten zehn Jahre lang, wie am Schnürchen« (Quelle: Autoreninfo zur Frankfurter Buchmesse 2019). Bemerkenswert ist dieser Ausstoß im Anblick der harten Stoffe, die Ambjørnsen seinen Lesern zumutete – zumindest in seinen ersten Romanen. Als Ambjørnsens programmatischer Hauptroman gilt nach wie vor der 1986 erschienene Titel »Weiße Nigger« – in weiten Teilen autobiografisch, wie die taz 2017 in einem Autorenportrait konstatierte. Thema: die Freak-, Hippie-, Punk- und Outcast-Szene der Achtziger – das Milieu der nichtangepassten Siebziger- und Achtzigerjahre-Jugend, dass hier eine Art Schlüsselroman erhalten hat. Inhalt: eine sich über zwei Jahrzehnte hinziehende Geschichte dreier Protagonisten – ein als (Auto)Biografie geschildertes Lost-Generation-Drama, dass schließlich in einem besetzten Haus in Oslo zum Höhepunkt findet.
Mitte der Achtziger siedelte Ambjørnsen nach Hamburg über. Der KB-nahe Buntbuch Verlag veröffentlichte seinerzeit seinen Erstling: »Sarons Haut« – eine wüste, an Hesses »Steppenwolf« erinnernde Liebesgeschichte im Drogenmilieu, die zwischen Wahnsinn, Selbstanmaßung und Zerstörungsdrang oszilliert und mittlerweile nur noch über die antiquarische Schiene erhältlich ist. Es folgten ähnlich hartgesottene Kriminalromane: »Der letzte Deal», »Stalins Augen« und »San Sebastian Blues«. Ein Kontrapunkt war die 1989 gestartete Jugendbuchreihe »Peter und der Prof«. Mit zehn Titeln ist sie bislang Ambjørnsens voluminöseste. Ihr Inhalt: Kindheit, Jugend, Freundschaft, Liebe, Politik sowie persönliche Risiken in dem Milieu, welches eine bestimmte Partei und ihre Marktplatzredner gern mit dem Begriff »linksgrünversifft« umschreiben.
Ingvar Ambjørnsens Leben ist bis heute arbeitsreich geblieben. Das Arbeitspensum teilt er sich mit seiner Frau – Gabriele Haefs, die beruflich als Übersetzerin tätig ist und auch die Werke ihres Manns in completta ins Deutsche übertrug. Das Milieu der Ausgestoßenen und Prekären, derjenigen, die sich dem neoliberalen Funktionieren verweigern, ist auch in seinen späteren Romanen immer wieder Thema. Aufzuführen hier wären etwa »Aus dem Feuer« von 2016 – ein Entwicklungsroman, in dem der Autor die persönlichen Katastrophen in seinem (nunmehr arrivierten) Milieu aufs Korn nimmt. Oder »Die Nacht träumt vom Tag« (2014) – eine Geschichte, welche die Thematik von »Weiße Nigger« wieder aufgreift und sie in eine Art Landkommunensetting in Nord-Norwegen verlagert. Oder: »Die Nacht träumt vom Tag« – eine Story, die ebenfalls im Literatenmilieu spielt, im konkreten Fall jedoch das Altern des Schriftstellers zum Thema hat.
Für die Nachgekommenen – speziell die Generation der »Millenium Socialists«, die sich politisch mittlerweile unüberhörbar zu Wort meldet – sind die Freaks, Aussteiger und Linksundogmatischen der Siebziger zwischenzeitlich nicht mehr nur politisch erklärungsbedürftig, sondern ebenso auch mental. Hanna Mittelstädt, Mitbegründerin von Edition Nautilus, hat die Verständigungsprobleme zwischen alten Freaks und den politisch Korrekten anno 2019 jüngst in einem graswurzelrevolution-Beitrag zum Thema gemacht. Anlass: die Verwendung des N-Worts, welches in der Nautilus-Neuauflage von »Weiße Nigger« bewusst im Titel verblieb. Besagte Begriffs-Doppelung, so Mittelstädt, sei ein Ergebnis der seinerzeit gelaufenen »Konfrontation mit der spießigen Bürgerlichkeit, der gesellschaftlichen Moral, der verlogenen Anständigkeit, die Suche nach einer persönlichen und solidarischen Freiheit, nach Poesie, Lust und Freundschaft.« Entsprechend sei der Begriff eine Art trotziger Selbstzuschreibung, nach dem Motto: »Ihr habt uns die ›Nigger‹ dieser Gesellschaft genannt und uns so behandelt, als Aussätzige, als Unrat. Jetzt nennen wir uns selbst so«. Harsche Kritik übte sie darüber hinaus an dem Sprachpolizei-Verständnis mancher Linker, welche Codes definierten, was man sagen darf und was nicht, und Verstöße dagegen durch Anprangerung, moralische oder auch tätliche Angriffe ahndeten.
Dass die Sprachkommunikation des Internet-Zeitalters ihre eigenen Fallstricke hat, konstatiert der Autor ebenso. »Ich bin wirklich froh, dass viele meiner Interviews gemacht wurden bevor das Internet kam. Das ist dann so, als ob sie nie stattgefunden hätten«, so das dazugehörige Zitat im Buchmesse-Portrait. »Heute ist mir regelrecht unheimlich. Ich achte nun viel mehr darauf, was ich auf Facebook poste, worüber ich blogge und was ich in Interviews sage. Macht man etwas falsch, kommt die ganze Meute an und will dich zerfetzen. Sich darauf zu berufen, gekränkt worden zu sein – ob es nun um einen selbst oder um andere geht – ist dort draußen sehr verbreitet.« Die verbreitete Correctsprech-Mode, so Ambjørnsen, habe diesen Trend zum Assume Bad Faith, zur schlechtestmöglichen Annahme des Gesagten zusätzlich befördert: »Alle wollen so politisch korrekt sein und man will Sachen bewusst falsch verstehen. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, besonders wenn es Leute trifft, die auf so etwas nicht vorbereitet sind. Das kann einen Menschen kaputt machen.«
Mag sein, dass speziell die Deutschen eigen sind in Sachen Sprach-Codes, ihrer Form und ihrem Kontext. Mag sein, dass sich die internationale Kreativ(en)regel »Form Follows Function« hierzulande noch nicht recht eingebürgert hat. Kein Zufall ist es sicherlich, dass es letztlich Immigranten sind, woanders Geborene, die a) das strenge Bild der deutschen Literatur mit unverkrampfteren, weniger kopflastigen Stoffen auflockern, b) gesellschaftliche Schieflagen thematisieren – jedenfalls, soweit sie außerhalb mittelständischer Wohlstandsblasen stattfinden. Möglich, dass Hamburg – siehe etwa den Filmemacher Fatih Akin – für die Form künstlerischer Verarbeitung ein besonders erspießliches Pflaster ist. Wie auch immer: Wer unangepasste Literatur im geschichtenbasierten skandinavischen Stil mag, findet bei dem Deutsch-Norweger Ingvar Ambjørnsen eine ganze Winterabend-Bücherregalreihe davon.
Neuerscheinung: Echo eines Freundes. Edition Nautilus, Hamburg 2019. 320 Seiten, 24 Euro. ISBN 978-3960541837.