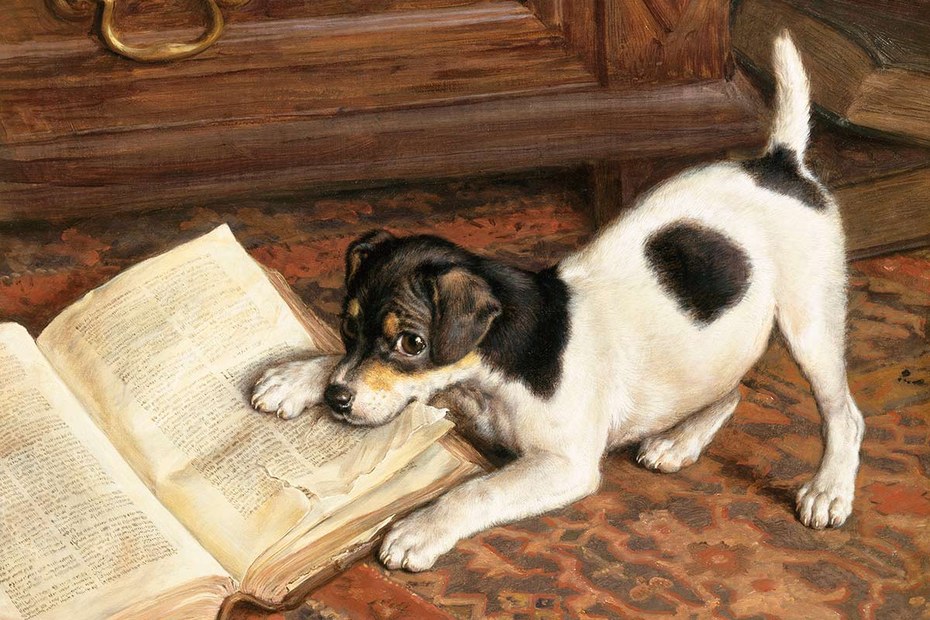Is dit Kunst oder kann dit weg? Schlechte Bücher kommen vor. Kritikern obliegt es dann, die Probleme aufzuzeigen. Oder den fraglichen Text zu beschweigen. Selten aber führt ein misslungener Text zur Grundsatzfrage, was Literatur heute sei. Karen Köhlers Roman Miroloi (Carl Hanser) veranlasste den Literaturwissenschaftler Moritz Baßler in der Taz zu eben dieser Grundsatzfrage. Miroloi, so lernen wir auch bei Deutschlandfunk-Kritiker Jan Drees, stehe für ein Problem des Literaturbetriebs: Das Buch entspreche dem feministischen Zeitgeist. Die Kritik packe diese Art von Text nicht allzu hart an, diagnostiziert er. Faszinierend, dass Miroloi als feministisches Buch gewertet wird!
Muss die nicht so plappern?
Ja, es geht bei Köhler um eine Frau, die in einer archaisch-
a, es geht bei Köhler um eine Frau, die in einer archaisch-patriarchalen Kultur aufwächst. Gewalt geht nicht nur, aber vor allem von Männern aus. Nicht einmal einen Namen besitzt die Frau. Dass sich ein Mensch gegen diese fundamentale Verweigerung eines Subjektstatus – nichts anderes bedeutet ja die Namenlosigkeit – wehrt, ist aber kein Feminismus. Oder nur dann, wenn Feminismus heißt, Frauen überhaupt als Menschen anzuerkennen.Drees wie Baßler stört das naive Geplapper der namenlosen Protagonistin. Tatsächlich ist das ein Kernproblem des Textes: Eine ungebildete Ich-Erzählerin muss sprachlich ungeschliffen daherplappern. Jedenfalls kann sie nicht plötzlich in Hochsprache philosophieren. Solche Konstruktionen gehen nur dann auf, wenn die beschränkte Perspektive aufgebrochen wird. Oder der Figur, neben einer geheimen Bildungsquelle, ein gerüttelt Maß Altklugheit angedichtet wird (man denke an Günter Grass‘ Oskar Matzerath). Man könnte einfach nüchtern diagnostizieren: Hier geht es nicht auf. Warum aber muss Miroloi für eine Fundamentalkritik herhalten?Baßlers Bemerkung, dass es sich bei der Sprache des Romans um „leichte Sprache“ handle, die bekanntermaßen zugunsten eines verständlichen Inhaltes auf komplexe Syntax und rhetorische Figuren verzichtet, verortet den Roman einerseits in der Welt der Gebrauchstexte. Der Kritiker führt als Vergleichgröße zudem ein Jugendbuch an: Wurde man vor 20 Jahren noch „scheel“ angeguckt, wenn man Harry Potter las, kämen Romane heute „direkt im Jugendbuchstil daher“. Jan Drees sieht‘s ähnlich: „Miroloi ist ein naives Jugendbuch für LeserInnen ab 14 Jahre, das sich als Erwachsenenlektüre tarnt“.Ein weiterer Vergleich Baßlers ist noch vielsagender. Wo denn der Roman zu verorten wäre, fragt er. „Irgendwo zwischen Wanderhure und Schäfchen im Trockenen, Krabat und dem Gastroführer Griechenland?“ Die Wanderhure, ist ein historischer Kriminalroman, der als mehrteilige Fernsehschmonzette verfilmt wurde. Womit dann klar ist, wohin dieser Vergleich führt: Miroloi ist Frauenliteratur, fast so schlimm wie die Serien, die vor allem Frauen gucken. Solche Literatur ist, wie Jugendliteratur, eigentlich gar keine echte Literatur. Denn sie richtet sich nicht an alle, sondern nur an einen Teil der Leserschaft. Anders als etwa Popliteratur gilt sie zudem als ironiefrei. Was bekanntlich auch eines der größten Probleme des Feminismus ist. „Das ist alles mit viel Hingabe gemacht und dabei komplett ironiefrei“ schreibt Baßler dann auch.Um nicht als antifeministisch zu gelten, stellt Jan Drees in seiner Kritik klar, dass früher auch mediokre Männertexte Aufmerksamkeit erhielten. Heute dagegen bekämen Autorinnen wie Anke Stelling Preise, heißt es gleich drauf. So wird dann auch der Buchpreisgewinner 2018 ganz klandestin zur „mediokren Literatur“. Was genau aber diese mediokre Literatur ist, bleibt im Dunkeln. Es mangelt an Kriterien, so scheint es. Doch wenn ein Kriterienkatalog zur Einordnung von Texten wie Miroloi fehlt, wie auch Baßler meint – wäre es dann nicht Aufgabe der Literaturkritik, ihn einzuführen? Sei es auch nur, um die eigene Daseinsberechtigung zu unterstreichen?Man kann Baßler, der selbst literaturwissenschaftlich viel daran gearbeitet hat, den Kanon zu erweitern, seine Hilflosigkeit bezüglich der richtigen Maßstäbe übrigens durchaus abnehmen. Denn haben nicht vielerorts schon, wie der Experte für Popliteratur richtig bemerkt, Lesecommunities die Stelle professioneller Kritik übernommen? Und bewerten die das Lesevergnügen nicht oft höher als die literarische Raffinesse? Und warum eigentlich nicht?Wenn Miroloi obendrein Seite an Seite mit Saša Stanišić, Marlene Streeruwitz, Nora Bossong auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019 auftaucht, dann zeigt sich, dass das Stil- und Geschmackempfinden Baßlers und Drees‘ nicht von allen Kritikern geteilt wird. Und dass somit vielleicht selbst in der Kritikerzunft die Kriterien so stark variieren, dass sie auf den Prüfstand gehören. Oder ist auch das nur der Beweis für Drees‘ These, wonach Bücher mit dem „Trend-Thema Feminismus“ einen Freifahrtsschein erhalten? Ist der Betrieb tatsächlich politisch überkorrekt, wenn es um Literatur von Frauen (11 von 20 auf der diesjährigen Longlist) geht?Vielleicht ist es vielmehr an der Zeit, den Begriff „Frauenliteratur“ zu reclaimen - sich also anzueignen, was abwertend gemeint war. Warum gruselt es uns Kritikerinnen und Autorinnen so sehr vor Texten von Frauen, die vielleicht tatsächlich eher von Frauen gelesen werden und Frauenthemen behandeln? Weil das Desinteresse von Männern an dieser Literatur ein allgemeines Werturteil bedeutet? Weil wir die Konnotation von „minderwertig“, die mit dem Wort „Frauen“ verbunden ist, so stark verinnerlicht haben? Eine Buchkritik, die gescheiterte oder jedenfalls nicht ganz gelungene Text nicht zu Grundsatzdebatten über eine bestimmte Art von Literatur nutzt, das wäre doch auch was!