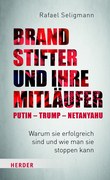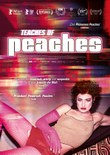Der 13. Februar war für viele linke Zusammenhänge jahrelang ein fester Termin. Galt es doch, an diesem Tag den Naziaufmarsch in Dresden zu verhindern. Mehrere Jahre lang traf sich die extreme Rechte in der sächsischen Hauptstadt und fand anfangs viel Verständnis in großen Teilen der Bevölkerung. Schließlich einte die als Trauer inszenierteEmpörung über die alliierten Bombardements vom Februar 1945. Im Laufe der Jahre änderte sich der politische Diskurs in Dresden. Die extreme Rechte konnte sichin Dresden nicht mehr wie ein Fisch im Wasser bewegen. Dielinke Bündnisarbeit zeigte Erfolge. Mit dem Blockadekonzept gelang es, die Erfolge der extremenRechten in Dresden Grenzen zu setzen. In diesem Jahr haben die verschiedenen rechten Formationen am 13. Februar auf eine Demonstration verzichtet. Grund genug sich wieder mehr dem offiziellen Dresden-Gedenken zu widmen. Mehrere Autor_innen zeigten im Buch auf, dass dieses Gedenken gegenüber den frühen 90er Jahren modernisiert wurde, aber noch immer einem Opferkult um Dresden huldigt. Da hat sichäußerlich einiges verändert, wenn auch im Kern vieles gleich blieb, könnte man das Fazit vieler Autor_innen nach fast zwei Jahrzehnten linker Aktivitäten rund um das Thema zusammenfassen. ,Allerdings könnte man diesen eher pessimistischen Befund auch umdrehen. Dresden war in den 90er Jahren noch eine No Go Area für Linke und Antifaschist_innen.
Modernisierung der Dresden-Mythen
So könnte man auch sagen, es war der Erfolg einer linken Strategie und Taktik, dass in Dresden heute die extreme Rechte in der Defensive ist und auch die alten Gedenkmythenn der Dresdner Offiziellen modernisiert werden müssen.
Der im letzten Jahr im Berliner Verbrecher -Verlag veröffentlichte Sammelband gibt einen guten Überblick über den mehr als zwei Jahrzehnte währenden Kampfgegen Neonazis und offiziellen Dresden-Mythos.
In dem gut lesbaren Band wechselten sich Beiträge von Historiker_innen, Mitarbeiterinnen von Gedenkinitiativen und linken Aktivistinnen ab. Oft kann hier keine Trennung gezogen werden. Schließlich sind aus vielen jungen Antifaschist_innen der späten 90er Jahre mittlerweile junge Wissenschaftlerinnen geworden. Vielleicht hat sogar das politische Engagement dazu beigetragen. Hierin nur eine Verbürgerlichung ehemaliger Linker zu sehen, greift zu kurz. Der Wissenschaftsbetrieb, gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, ist ein umkämpftes Feld. Mittlerweile bestimmen auch außerparlamentarische Linke die Diskurse mit. Das wird im Beitrag des Historikers Henning Fischer deutlich, in dem er sich mit dem Mythos Dresden im Wandel der deutschen Nationalgeschichte“ befasst. Schon im Titel wird eine Position deutlich, die Fischer aber auch alle anderen Autor_innen eint.“Gedenken abschaffen“ heißt der Konsens. Damit machen die unterschiedlichen Autor_innen deutlich, dass es ihnen nicht reicht, wenn die extreme Rechte am 13. Februar nicht mehr durch Dresden marschiert. Denn das wollen auch die Offiziellen, die sich in ihrem Gedenken dadurch gestört fühlen
Das Buch gibt auch einige Hinweise, wie eine linke Auseinandersetzung mit dem 13. Februar in Dresden aussehen kann, wenn die Neonaziaufmärsche nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Die historischen Spaziergänge, die auch in diesem Jahr unter dem Motto „ Mahngang Täterspuren“ von linken Gruppen organisiert werden, sollten fortgesetzt und ausgeweitet werden.
Dass dabei die Gefahr der Vereinnahmung für einen modernisierten deutschen Dresden-Mythos besteht, wird in vielen Beiträgen immer wieder thematisiert. Daher hätte man sich noch mehr Beiträge gewünscht, die eine eigene linke Geschichtserzählung verdeutlichten. Hennig Fischer macht hier in seinen Beitrag nur Andeutungen, in dem er mit Verweis auf den marxistischen Soziologen Leo Kofler den Begriff der „widersprüchlichen Totalität der Geschichte“ einführt. Hier hätte man sich eine Präzisierung erwünscht.
Manna vom Himmel
Eine Fundgrube ist das Buch für alle, die Argumente gegen die offizielle Erzählung von der unschuldigen Kulturstadt Dresden“, suchen, die unbegreiflicherweise von den alliierten Bombern heimgesucht worden sei. Sehr ausführlich wird von verschiedenen Autor_innen beschrieben, wie Dresden nicht nur eine normale deutsche Stadt im NS war sondern wie dort seit den 20er Jahren eine besondere völkische Grundströmung entstanden ist. Leider geht der Historiker Rene Haase bei seinen Geschichtsüberblick nur kurz auf den legalen Putsch ein, als eine aus Sozialdemokrat_innen und Kommunst_innen bestehende sächsische Landesregierung 1923 von der Reichsregierung unter Ebert durch Militär abgesetzt wurde. Das beförderte die Entwicklung Sachsens zur rechten Ordnungszelle, in der sich unterschiedliche völkische Bewegungen tummeln konnten, schon bevor die Nazis sich als die stärkere dieser Gruppen herausbildeten. Wichtig ist es daran zu erinnern, dass in Dresden bereits am 8. März 1933 eine öffentliche Bücherverbrennung durch die SA organisiert wurde und auch bei der Organisierung der Ausstellung „Entartete Kunst“ hatte Dresden Pionierfunktion. In mehreren Beiträgen kommen Überlebende der NS-Vernichtungslager zu Wort, die in der Endphase des NS-Regimes auf Todesmärschen auch durch Dresden getrieben werden. Sie erlebten die Bombardements teilweise in der Dresdner Innenstadt. Obwohl sie keine Schutzräume aufsuchen konnten, bezeichneten sie die Bombardements als Manna vom Himmel. Einigen wenigen gelang im allgemeinen Chaos die Flucht. Doch auch nach dem Bombardement funktionierte die NS-Volksgemeinschaft in Dresden bis zum Schluss. Juden, die sich vor ihren Häschern in den Ruinen verstecken wollten, wurden bis zum Schluss gejagt. Auch das gehört zur Geschichte Dresdens.
Liebe eine Bombe auf dem Kopf als nach Auschwitz
Es ist vor allem den antifaschistischen Gruppen zu verdanken, dass auch die Stimmen der NS-Verfolgten erwähnt werden. Mit der Parole „Lieber eine Bombe auf dem Kopf als nach Auschwitz“ zitierten sie den NS-Überlebenden Henry Brenner auf einem Transparent, das sogleich von der Polizei beieiner Vorkontrolle konfisziert wurde.Hier zeigen sich die Grenzen der Toleranz auch in Zeiten des modernisierten Dresden-Mythos. Im letzten Kapitel wird ein kurzer Überblick über zwei Jahrzehnte Widerstand gegen Nazis und Dresden-Mythos gegeben. Neben den abgedruckten Plakaten und einer Chronologie gibt es auch ein Interviews mit dem Angehörigen einer antinationalen Gruppe aus Hamburg, die in den frühen 90er Jahre einen Slogan prägten, der auch in der außerparlamentarischen Linken für heftigen Zwist sorgte. „Bomber-Harris do it again“, hieß der Spruch über einen Foto der Dresdener Ruinen. Es wird seitdem als Markenzeichen der sogenannten antideutschen Strömung gesehen und angefeindet oder gehypt. Nun polemisiert ein Krischan vom Antinationalen Plenum Hamburg, die den Slogan kreierte heftig gegen die sogenannten Antideutschen, denen er vorwirft dem Antisemitismus zum Hauptwiderspruch gemacht zu haben. So wird in dem Buch neben den großen Dresden Mythos auch en Passant mancher linker Mythos infrage gestellt.
Peter Nowak
Autor_innenkollektiv Dissonanz (Hg.)
Gedenken abschaffen. Kritik am Diskurs zur Bombardierung Dresdens 1945.
Verbrecher Verlag, Berlin 2013, Broschur, 344 Seiten, 15,00 €, ISBN 978 -3-943167-23-8#
http://www.verbrecherverlag.de/buch/698
Verbrecher Verlag, Berlin 2013, Broschur, 344 Seiten, 15,00 €, ISBN 978 -3-943167-23-8