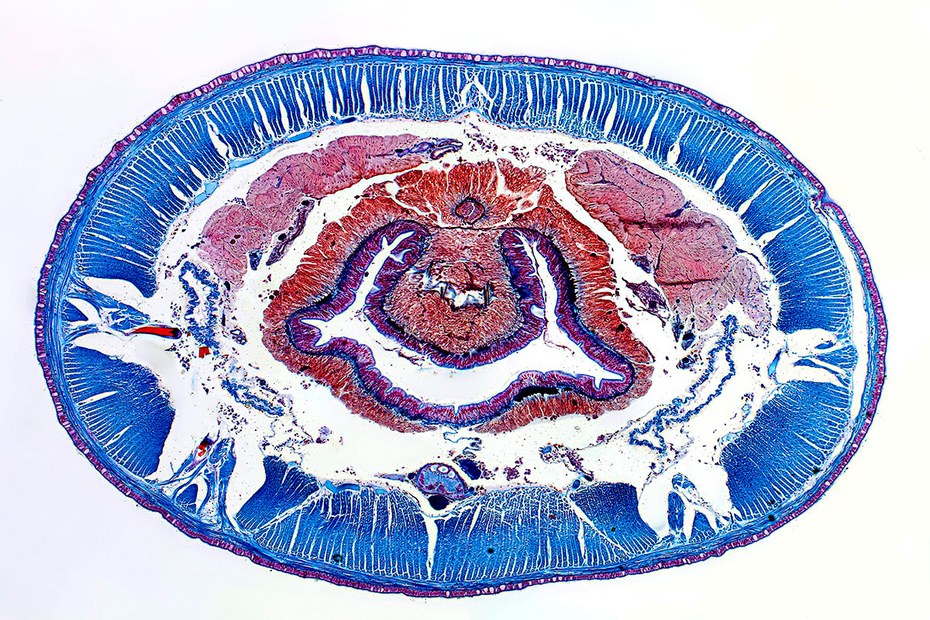Er gehört zu den Stärksten, ist Wohltäter und Gourmet. Vor allem aber kann er sich auf eine einzige Sache konzentrieren. Ist er mit Essen oder dem Liebesspiel befasst, lässt er sich durch nichts und niemanden ablenken. Wer verfiele ihm nicht mit Haut und Haar? Dass er nur eine Lippenfalte hat und keine Zähne, ist bei so vielen Qualitäten nachrangig. Von Nachteil ist, dass er unermüdlich ackert. Nun, er macht, was Regenwürmer so tun: Er „bioturbiniert“, das heißt, er lockert und belüftet den Boden. Er räumt auf mit pilzbefallenen Pflanzenresten und lässt in seinen Wohnröhren zahlreiche unterirdische Bodenlebewesen andocken. Er ist subversiv im besten Sinne: unterminieren und neu konstruieren zum Wohle aller.
Der Reg
Der Regenwurm ist nicht der einzige Kandidat für tierische Liebäugeleien in Florianne Koechlins und Denise Battaglias Was Erbsen hören und wofür Kühe um die Wette laufen. Die verpönten Pilze bilden unter dem Boden ein für Bäume unverzichtbares Geflecht aus Wurzeln und Pilzfäden. Dieses Mykorrhizanetz ist perfekte Symbiose: Pilze liefern Bäumen Stickstoff, Bäume geben Pilzen Zucker. Die perfekte Tauschwirtschaft: „Unter dem Boden ist die Individualität aufgehoben“, erklärt auch die Wissenschaftlerin Verena Wiemken.Die Natur als Vorbild für Gesellschaftssysteme zu nehmen, ist so abwegig nicht. Man muss sich ja nicht am „survival of the fittest“ orientieren. Das Pilznetzwerk zum Beispiel ist ein fabulöses Beispiel für Integration: „Wenn es irgendwo zerstört wird, übernehmen andere Partien die Funktion des Nährstofftransportes.“ Ein Best-Practice-Beispiel für so manche Meister des Missmanagements: „So gibt es keine Pannen mit Wartezeiten, wie dies beim Bahntransport öfters vorkommt.“Gut und schön, aber wer kann sich diesen Luxus schon leisten? Das ist das Erstaunlichste an diesem wundersamen Buch: „It pays!“ Ökologisches, naturverbundenes Wirtschaften zahlt sich aus. Koechlin und Battaglia zeigen das am Beispiel der Kuh: Mit Frischgras gefütterte Weidekühe produzierten am wirtschaftlichsten. Statt ihnen die Hörner abzusägen und sie in enge Ställe zu pferchen, sollten Bauern auf das Leibeswohl der Tiere achten. Letztlich profitierten Tier und Mensch.Dabei hätte man es freilich bewenden lassen sollen. Dem Anliegen hätten weniger Politisierung und Einbindung in die Tagespolitik gutgetan. Der Leser ist mündig, klug genug, die Konsequenzen einer Neuausrichtung der Landwirtschaft selbst abzusehen. Dass Monsanto ein diabolischer Umweltzerstörer ist, ist bekannt. Dass ausgerechnet Indien dem Giganten nun aber in der Baumwollproduktion einen patentrechtlichen Riegel vorschiebt, ist überraschend und rechtlich gesehen inspirierend. Allerdings hinterlässt das Monsanto-Bashing mit esoterisch-veganem Topcoat den unangenehmen Hautgout aktivistischen Eiferertums. Die Hoffnung, mehr über die auditiven Fähigkeiten von Erbsen und den Bewegungsdrang von Kühen zu erfahren, wird zwar erfüllt, aber überlagert von lautstarken Forderungen.Man wünschte sich, Koechlin und Battaglia hätten ihre Erkenntnisse über die südkoreanische Kultur, Landwirtschaft und Sprache nicht nur referiert, sondern auch verinnerlicht. „Es bedarf keiner steten Intentionalität, um die Welt zu bewegen und Dinge geschehen zu machen“, sagt die Philosophin Hoo Nam Seelmann, die Koechlin und Battaglia nach Südkorea begleitete.Mal in den Himmel horchenDas Kapitel über die Kunst des Loslassens, gefüllte Bambusschösslinge und die symbiotischen, jedoch nicht pilzartigen, da extrem hierarchischen Beziehungen in Südkorea ist viel wirkungsmächtiger als explizite Forderungen. Narziss und Nachfolger könnten sich ein Beispiel an dem an ein Beziehungsgefüge geknüpften Selbstbild der ostasiatischen Kultur nehmen. In Korea gibt es kein abgezirkeltes Ich, sondern ein „Ma-um“, das Herz, Seele, Geist oder auch Gewissen in einem bedeutet: „Das Ma-um ist eine schwebende, durchlässige Grösse.“ Vielleicht sollten wir uns einfach mal hingeben und die Welt der Dinge in uns eindringen lassen, denn schließlich ist sie – zumindest in Korea – schon immer in uns. Natürlich befinden wir uns in einem europäischen Sprachraum.Es wäre kurios, wenn wir plötzlich sagten: „Das Vogelgezwitscher kommt ins Ohr zum Hören.“ Den Blickwinkel zu ändern schadet jedoch nie. Das gilt für Bauern, Ökoaktivisten, Wissenschaftler genauso wie für Literaturkritiker. So manch einer hätte Han Kangs Vegetarierin anders analysiert in Kenntnis sprachlicher Differenzen. Da die koreanische Sprache eine viel größere Nähe zu Pflanzen ermögliche, sei es normal, wenn eine Koreanerin sage, „sie sei im früheren Leben ein Vogel gewesen oder eine Kiefer“. Sich vorzustellen, das Ohr zu sein, „das in den Himmel ragt“, ist bahnbrechender als ein politisches Manifest. Dem Regenwurm, Koechlin und Battaglia sei Dank!Placeholder infobox-1