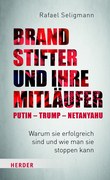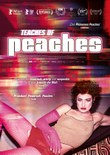Szenen im Halbdunkel. Es ist früher Morgen. Menschen stehen Schlange vor einer Warenausgabe. Ihr Gespräch verstummt neim Auftauchen von Spitzeln. Eine Kutsche fährt laut über das Pflaster. Es regnet in Strömen. Aus dem Türfenster schauen ein junger Mann mit Perücke und eine noch jüngere Frau stumm auf ein riesiges Fallbeil. Ein kleiner Junge steht nackt in einer Schüssel. Eine Frau wäscht ihn. „Du wirst ein guter Revolutionär.“ Der Junge muss die Menschenrechte deklamieren. Auswendig. Seine Kinderstimme klingt eingeschüchtert. Schon bei Artikel I stockt er. Hart fällt der Schlag der Frau auf die automatisch hingehaltene Kinderhand.
Totale und Terror
Schon die ersten kurzen Szenen in Andrzej Wajda Film „Danton“ erzeugen Angst. Die Musik spielt mit, und der Zuschauer weiß, was kommen wird. Er weiß es, weil er es gelernt hat, nicht nur in der Schule. Der Film „Danton“, in Polen und in Frankreich gedreht, kommt 1983 in die Kinos. Seit zwei Jahren führt General Jaruzelski die Regierung Polens. 1982 ist die Gewerkschaft Solidarnózc verboten worden. Oppositionelle sitzen im Gefängnis. Danton zu Walesa und Robespierre zu Jaruzelski zu machen, bietet sich in diesen Jahren an. Ebenso die Anklage des realsozialistischen Systems mit den Mitteln der „schwarzen Legende“ der Schreckensherrschaft Robespierres. Erklärt dies die zahlreichen historischen Fehler? Robespierre posierte nicht für den Revolutionsmaler David als Königspriester des „Höchsten Wesens“. Der Kult einer zivilen Religion wurde erst einen Monat nach dem Tod Dantons eingeführt. Robespierre konnte David auch nicht auffordern, den Dantonisten Fabre d'Eglantine aus dem Gemälde „Der Ballhausschwur“ zu entfernen, weil der arme Fabre nicht die Ehre hatte, darin zu figurieren. Auch das berühmte Fenster, aus dem Robespierre verstohlen auf den Karren der Todgeweihten blickt, hat nicht existiert. Gravierend ist die Entscheidung der Filmemacher, die Hinrichtung der Hébertisten auszulassen, ohne die der Fall der Dantonisten nicht verstehbar ist, Darf ein Atheist wie Hébert kein Opfer sein? Warum verzichtet der Regisseur auf die fragwürdigen Seiten Dantons, die belegte Bestechlichkeit etwa. Für eine gute Sache scheint Schwarz-Weiß erlaubt: Gnade und Nachsicht gegen Terror und Blut. Pralle Lebensbejahung gegen kalte kranke Lebensflucht. Wirklich? Gibt der Erfolg dem Regisseur recht?
In der Historiographie der 80er Jahre gibt der Historiker François Furet den liberalen Ton an. Er sieht im Film die Möglichkeit, endgültig mit der marxistischen Revolutionshistoriographie (Mathiez, Lefèbvre, Soboul) abzurechnen:
Die jakobinisch-bolschewistische Analogie kommt wie ein Bumerang und trifft diejenigen, die sie unvorsichtigerweise als Waffe geschwungen haben.
Der Erfolg des vom französischen Kulturministeriums ko-finanzierten Films liegt nicht nur am Darsteller Dantons, dem jungen vitalen Gérard Dépardieu. Es ist der Kontext. Das „Bicentenaire“ von 1989 steht an. Furet ist Kopf des liberalen „historical turns“, Autor des einflussreichen Büchleins „Penser la Révolution française“ (1978), eine Offensive gegen marxistische sozialgeschichtliche Interpretation des großen Umsturzes. Furets These: Nicht erst 1791 ist die Revolution „abgeglitten“. Die Dynamik des gesamten revolutionären Prozesses führt unweigerlich zum totalitären Terror. Die Analogie des „Jakobinismus“ mit dem Kommunismus und Nazismus ist historisch absolut gerechtfertigt. Dies wird in den 80ern von konservativen und reaktionären Gegenrevolutionären gern aufgenommen. Noch heute verweisen sie regelmäßig auf Furet. In diesem Kontext „entdeckt“ man erneut die brutale Repression des Vendée-Aufstands 1793/94... und transformiert diese geschickt in politisches und ökonomisches Kapital.
„Antijakobinisch“ ist mittlerweile auch die Position der regierenden Sozialisten. 1981, am Abend der Wahl Mitterands sangen sie noch, zusammen mit den Kommunisten und 200000 Parisern, die Marseillaise und die Internationale, begleitet vom Schwingen trikolorer und roter Fahnen. Das hat sich 1983 geändert. Wajdas Film bestätigt auch ihren „liberal turn“ und drückt die (marginal) mitregierenden Kommunisten weiter in die Defensive.
Der bekannte linke Historiker Max Gallo, Autor einer Robespierre-Biographie, schreibt irritiert einen „Offenen Brief an Maximilien Robespierre über die neuen Muscadins“ (1986), in dem er zeigt, dass der angeblich neue liberale Diskurs über den revolutionären Terror nur die alten konterrevolutionären Vorurteile des 18. und 19. Jahrhunderts reproduziert. Allein, was kann ein Text auf totem Holz gegen die schaurig schönen Bilder eines Films, in dem der freie Geist der Zeiten von einem Dépardieu inkarniert wird, Preisträger des Festival von Cannes als bester Schauspieler 1982. Der Film Danton wird tatsächlich weltweit zu einem effizienten „Classroom-tool“, besonders nach nach jenem Epochenjahr 1989. „Unser“ Bild der „roten Jakobiner“ ähnelt dem der „braunen Jakobiner“ zum Verwechseln, und beide ähneln den „echten Jakobinern“ der Französischen Revolution. Wer einen kennt, kennt alle. Es ist, als ob die Rache der Thermidorianer an Robespierre nie enden soll.
Dass sich Filmemacher, liberale Historiker und neoliberale Sozialisten thermidorianischer Klischees bedienen, ist – natürlich – kein Zufall. Bilder des Schreckens sind in bestimmten historischen Situationen ideale Instrumente im Kampf um die Hegemonie. Der „jakobische Terror“ Robespierres ist diesbezüglich ein besonders flexibles Werkzeug. Es existiert in unterschiedlichen Ausführungen und „Sondermodellen“, die sich widersprechend oder ergänzend, dem Zeitgeist anpassen, liberal, monarchistisch, blanquistisch, anarchistisch, ja, auch marxistisch. Es gibt die Basisdiskurse für die Armen, aber auch die gelehrten Diskurse de luxe für die gebildete Upperclass. Ihre Wirksamkeit entfalten diese in Krisensituationen.
Diese Gleichmacher!
Mit der Niederlage des Empires und der anachronistischen Restauration der Bourbonenmonarchie gewinnt der bourgeois-liberale Antirobespierrismus an Boden. Die liberale Madame de Staël, Bankierstochter, lässt die „gute“ Revolution 1791 enden. Das Übel beginnt vor allem mit dem „neidischen und bösartigen“ Robespierre, dem „Gleichmacher“ der Vermögen und soziale Ränge nivellieren will. Die großen Werke der liberalen Meisterhistoriker des 19. Jahrhunderts Thiers und Mignet rechtfertigen den Kampf der Bourgeoisie gegen die verknöcherte Aristokratie und kritisieren das „Abgleiten“ der Revolution in Gewalt und Terror mit dem Auftauchen des bewaffneten Volkes. Thiers setzt 1871 diese Ansicht als Präsident mit der brutalen Unterdrückung der Commune in die Praxis um.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die 48er Revolution den „Jakobinismus“ auf die Tagesordnung stellt. Es gibt sogar eine Revue: „Robespierre. Zeitschrift der sozialen Reform“, allerdings auch einen antirevolutionären „Almanach des Montagnards: doctrines, principes et but“:
Wie 1793 hat das Frankreich von 1848 seine Feinde des Eigentums... Die Kommunisten haben seit Babeuf Fortschritte gemacht. Proudhon geht noch weiter. Er erklärt das Eigentum durch die Revolution für abgeschafft...
Diesem Horror werden ganz thermidorianisch die Prinzipien „öffentliche Ruhe“, „Ehrlichkeit der Verwaltung“ und „ Ordnung und Wohlstand im Innern und Würde nach Außen“ gegenübergestellt. Interessant ist allerdings das Amalgam von Montagnards, Kommunisten und Proudhon. Letzterer, ideologischer Ahn heutiger Anarchisten wie Michel Onfray, hasst Robespierre über alles. Er beschimpft ihn als „Reptil“, als „Denunziant mit leerem Gehirn, aber mit dem Zahn einer Viper“. So wie der Musterrevolutionär des 19. Jahrhunderts, Auguste Blanqui, der in ihm einen Vertreter der Ordnung, den Exekutor der herrschenden Klassen gegen die „Enragés“ und die „Hébertisten“, die wahren Proletarier der Zeit, sieht. Zudem sei er ein religiöser Fanatiker:
Alle diese Meister Gottes sind wilde Seelen,von der Herrschaft besessen, mit dem heiligen Dolch bewaffnete Hypokriten. Dieser Robespierre, dieser gnadenlose Abschneider aller Köpfe, die ihm entgegenstanden, hört nicht auf, sich auf den eigens erwürgten Kadavern als Opfer zu posieren, den Klagerefrain des Sokrates wiederholend: Ich soll den Schierlingsbecher trinken.
Selbst (?) Blanqui nimmt ein gezielt gestreutes Gerücht vom Thermidor 1793, Robespierre sei der Messias einer Sekte, für bare Münze. Auch wenn man diese Urteile als Reaktion auf die verheerende Niederlage der Linken im Juni 1848 sehen muss, haben sie doch große Auswirkungen auf die revolutionäre Theorie der nächsten Jahrzehnte.
Auf der anderen Seite der Barrikade gibt es Nachschub durch das Pamphlet „Das Leben und die Verbrechen von Robespierre, genannt der Tyrann“, geschrieben im Jahr 1795, 1850 neu, zeitgemäß adaptiert, neu aufgelegt... und ein enormer Erfolg. Das durch die Revolution erschrockene Bürgertum erfreut und erschreckt sich an den zahlreichen erfundenen und halbwahren Anekdoten des Autors Abbé Broyart, einst stellvertretender Schulleiter des kleinen Tyrannen. Ihm verdanken wir Geschichten von gegrillten Priestern, Blutleitungen zu den jakobinischen Vampiren, aber auch die von keinem Biograph vergessene Episode einer frühen Begegnung des Schülers Robespierre mit Louis XVI., die – so der Historiker Hervé Leuwers überzeugend - nicht stattgefunden haben kann.
1871 lässt der Präsident (und große Revolutionshistoriker) Adolphe Thiers lässt die junge Drittte Republik mit dem Blut von 20.000 Kommunarden taufen. General Mac Mahon kann am 28. Mai 1871 ganz „thermidorianisch“ verkünden:
Die Armee Frankreichs ist gekommen, euch zu retten. Paris ist befreit. Ab heute ist der Kampf beendet: die Ordnung, die Arbeit und die Sicherheit werden zurückkehren.
Zum führenden Ideologen der rechten Linie im „Thiers Etat“ wird Hippolyte Taine. Seine „Origines de la France“ (1875) sind geeignet, der konservativen Bourgeoisie ihre Schuldgefühle zu nehmen. In der Tradition Burkes beginnt für Taine der Terror nicht erst 1793, sondern schon 1789, mit den Oktobertagen. Die Revolution ist ein Verbrechen gegen die Tradition und gegen die Natur. Denn, so Taine mit den Worten der reaktionären Ideologen der Zeit:
Aus dem Bauern, dem Arbeiter, dem Bürger, der durch eine alte Zivilisation gezähmt schien, springt plötzlich der Babar heraus, noch schlimmer, das primitive Tier, der grimassierende Affe, blutdürstig und lüstern, der mit höhnischem lachen tötet und auf dem angerichteten Schaden herumspaziert.
Das Übel liegt im Irrglauben der Aufklärung, vor allem Rousseaus, dass der Mensch frei geboren sei. Die Menschenrechtserklärung bestehe aus nichts als „abstrakten Dogmen“. Robespierre verkörpere
das letzte Stadium einer sterbenden intellektuellen Vegetation... Er ist die letzte Missgeburt und die trockene Frucht des klassischen Geistes. Eine erschöpfte Philisophie, von der er nur gelernte Formeln bewahrt..., Volk, Natur, Vernunft, Freiheit, Tyrannen, Aufrührer, Tugend, Moral, ein vorgefertigtes Vokabular, zu große Ausdrücke, deren Sinn, der schon bei seinen Meistern schlecht definiert war, unter den Händen des Schülers verdampft...
Und die Instinkte freisetzt, gegen die nur die Kräfte der Ordnung helfen:
der bewaffnete Gendarm gegen den Wilden, den Briganten und den Verrückten, den jeder in sich verbirgt.
In dieser Welt der Angst von Menschenrechten, Demokratie und Volkssouveränität zu sprechen, ist für Taine absurd. Man könnte ihn fast für einen Befürworters einer Terrorherrschaft halten. Einer weißen.
Diese pessimistische Sicht der Dinge widerspricht natürlich dem progressiv-liberalen Credo der damaligen Mehrheit der Republikaner, auch wenn sie die notwendige Gewaltanwendung gegen die Revoluzzer überzeugt. 1879 macht sie sogar den 14. Juli zum Nationalfeiertag... weniger als Erinnerung an die Einnahme der Bastille als an das große Föderationsfest von 1790. Der offizielle „Anti-Robespierrismus“ erlaubt es, mit der Revolution zu sympathisieren, ohne radikal zu sein. Denn, wie schon die Thermidorianer wussten (und hundert Jahre später François Furet): Mit der Erklärung der Menschenrechte und der Verfassung von 1791 ist die Französische Revolution beendet. Wer anderes behauptet, ist wie Robespierre: krank. Der Revolutionshistoriker Alphonse Aulard gibt den Ton an:
Marat, mit seinen caesaristischen Träumen, Robespierre, mit seiner Staatsreligion, waren Meister der Vergangenheit, Reaktionäre, die unserer Sache anders schadeten als die „roten Absätze“ aus Koblenz...
Aulard greift auf den historiographisch und literarisch (Büchner) überbetonten Gegensatz von Robespierre und Danton zurück. Der Verräter Robespierre habe
mit kalter Berechnung den Mann ermordet, der die weltliche französische Politik gegen das theokratische System verkörperte, seinen großmütigen Kameraden, den großen Danton.
Für die Massen reicht ein illustrierter „Album du centenaire“ (1889), der die üblichen „Sprüche“ abfeiert:
Aus Neid auf Dantons Volkstümlichkeit ließ Robespierre ihn festnehmen.
Die Terreur hatte eine Menge Staatsbürger verzweifeln lassen, die sahen, wie die Revolution ihre Kinder fraß.
In thermidorianischer Kontinuität verurteilt das Album auch den „Fanatismus“ der Aufständischen in der Vendée. Wieder einmal koinzidieren sie, die Abwehr von Monarchie und Anarchie, von „moralischer Ordnung“ und Commune.
Die historiographische Linke wird hegemonial
Auf der Linken kontert Jean Jaurès mit einer monumentalen „Histoire socialiste de la Révolution française“, die in preiswerten Bänden unters Volk gebracht wird. Jaurès verzichtet auf moralische Verurteilungen. Er versucht (ausgehend von der zeitbedingten Fortschrittsgläubigkeit der Linken), die Schwächen und Stärken Robespierres historisch zu erklären, seine Blindheit gegenüber dem den Klassenkampf und der Stärke der Bourgeoisie einerseits und sein Beharren auf der Souveränität des „Peuple“ und der Demokratie andererseits. Auch Jaurès Robespierre-Bild ist – wie kann es anders sein – gegenwartsbezogen: Der Kriegsgegner Jaurés (er wird kurz vor Kriegsbeginn 1914 ermordet) erwähnt als einziger seiner Zeitgenossen den Kampf Robespierres gegen den Bellizismus der „Gironde“ von 1792. Und er prägt diesen schönen Satz:
Die Girondins waren windige Verleumder, Robespierre war als Verleumder tiefgründig.
Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs verschiebt sich das hegemoniale Bild Robespierres, der Terreur und des „Jakobinismus“. Großen Anteil daran hat der Historiker Albert Mathiez mit seinem Aufsatz „Pourquoi nous sommes robespierristes“. Sein Versuch, dem „Unbestechlichen“ historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und den republikanischen Säulenheiligen Danton dokumentarisch zu entzaubern, wird vom historischen Kontext begünstigt: Die Repressionsmaßnahmen der Regierenden im Ersten Weltkrieg relativieren die so genannte „Herrschaft des Terrors“ von 1793/94. Mathiez, 1920 Mitglied der kommunistischen Partei, analogisiert sogar Bolschewismus und Jakobinismus, als
Klassendiktaturen, die mit denselben Mitteln operieren, Terreur, Requisition und Besteuerung, alles mit einem ähnlichen Ziel, der Transformation der Gesellschaft … zu einer universellen Gesellschaft.
Schon zwei Jahre später verlässt Mathiez die Partei. Er urteilt:
Die Diktatur ist nur in einer Katastrophensituation annehmbar, wenn sie wirklich unvermeidbar ist. Aber reiner Wahnsinn ist die Vorstellung, man könne Menschen Opfer durch Befehle von oben auferlegen. Freie Menschen werden sich dem immer verweigern. Disziplin, soviel man will, aber eine Disziplin der freien Zustimmung! Frankreich ist nicht Russland!
Als „Dank“ zeigt die Humanité anlässlich seines Todes 1930, dass auch die KPF Geschichte zu instrumentalisieren weiß. Mathiez war
ein kleinbürgerlicher Demokrat, ein versteinerter Jakobiner außerhalb der Bewegung der lebenden Geschichte.
Imeuropäischen Bürgerkrieg der Dreißiger und Vierziger Jahre wird Robespierre zur wichtigen Figur auf der linken Seite der Barrikade, während die Rechte die alten Klischees ruminiert. Die aktive Erinnerung der Französischen Revolution vereint Gewerkschaften, Sozialisten und Kommunisten. Die KPF gibt ihre „Klasse-gegen-Klasse“-Politik auf. Die Verfassung von 1793 wird Matrix der Volksfront. Endlich tragen Straßen, Schulen, ja sogar eine Metrostation den Namen des „Unbestechlichen“. Mit dem Beginn der kommunistischen Résistance 1941 wird dieser gar zu einer Art Stalin (1936 hat Trotzki denselben noch zum Thermidorianer erklärt). Es ist gewissermaßen konsequent, dass in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg die Schule des marxistischen Historikers Albert Soboul die historiographische Linie bestimmt: ein Bourgeois auf der Seite der Volksmassen, ein nicht korrumpierbarer Demokrat, der aber den Gesetzen des sich entwickelnden Kapitalismus unterliegt, unterliegen muss, denn dieser geht nun einmal dem Sozialismus voran.
Kalter Krieg
Die Kulturindustrie bedient sich edoch weiterhin der Schreckenslegende.. 1950 kommt Anthony Manns Kalter-Kriegs-Film „Reign of Terror“ heraus. Der Film ist als Gangsterfilm in Schwarz-Weiß konzipiert und enthält alle wichtigen Ingredienzen: anxiogene Musik, Schreckensbilder der Guillotine, der böse Jakobiner Robespierre vs. den guten Danton, die beiden ehrenwerten Thermidorianer Barras und Tallien als Retter der Republik. Fernsehfilme wie „Der Tod Marie Antoinettes“ (1958) des ehemaligen Vichysten André Castelot bestätigen das Bild in regelmäßigen, das Lernen verstärkenden Abständen. Allerdings unterbricht das Staatsfernsehen mit „Der Terror und die Tugend“ (1964) die negative Darstellung Robespierres. Der vom Publikum positiv aufgenommene Fernsehfilm endet mit der kompletten Rezitation der Menschenrechte von 1793. Vielleicht hat Wajda diese Sequenz zum Anlass seiner Eingangsszene genommen. Die Rezeption Robespierres ist ein Art Spiel mit Zitaten (auch mit denen der Gegenseite). Und stets politische Manifestation. Dass der so Dämonisierte 1964 im Staatsfernsehen so gut wegkommt, hängt sicherlich auch mit der franko-russischen Annäherung zusammen. 1965 besingt Gilbert Bécaud die russische Studentin „Nathalie“ und die „Place rouge“, und 1 Jahr später reist der General sogar nach Moskau.
Erst in den siebziger Jahren deutet sich auch in den Wissenschaften eine (alte) Hinwendung zur liberalen Interpretation an. Furets „Penser la Révolution“ (1978) wird zum Referenzwerk der Befürworter von Thatcher, Reagan … und der Sozialisten. Auch für Furet ist Robespierre eine Art Stalin:
Mittels der Fiktion des „Volkes“ setzt sich der Jakobinismus an die Stelle der Zivilgesellschaft und des Staates. Über den allgemeinen Willen fällt das Volk als Souverän künftig mythisch mit der Macht zusammen, ein Glaube, der die Matrix des Totalitarismus bildet.
Dieses Verständnis ist im Grunde nur eine Wieder-Anwendung von Interpretamenten der alten liberalen Schule (Constant, Tocqueville, Quinet), aber sie erwischt die marxistischen Revolutionshistoriker – wie so vieles - auf dem falschen Fuß... und ermuntert die Rechte. Robespierre wird nicht nur zu Stalin, sondern auch zu Pol Pot, die „Schreckensherrschaft“ nimmt den Gulag vorweg.
Straßen"kämpfe"
Ein Sprung in die Gegenwart, die wir mit dem Jahr 2011 beginnen lassen. In einem Jahr ist Präsidentenwahl. Im Mai ersteigert das Kulturministerium für 750.000 Euro Manuskripte des Unbestechlichen. Während die Historiker jubeln, zeigt sich die rechte Presse indigniert. Im selben Jahr beantragt der Alexis Corbière (damals noch Kommunalpolitiker des Parti de gauche) im Pariser Stadtrat, eine Straße im Zentrum nach Robespierre zu benennen (immerhin gibt es auch eine nach dem Kommuneschlächter benannte Straße Adolphe Thiers!) und erfährt eine brüske Zurückweisung durch de sozialistischen Bürgermeister Delanoë. Corbières „Held“, weiß der Maire, habe die roten Khmer inspiriert. Ein Abgeordneter der PS versteigt sich zu der These, Robespierre sei nicht nur Urheber der Terreur, sondern als Befürworter des Kults des Höchsten Wesens ein Gegner der Laizität gewesen (kurz zuvor ist auf Antrag der PS eine Straße nach Johannes Paul II. benannt worden). Zwei Jahre später wird ein einflussreicher Politiker der Rechten versuchen, die Place Robespierre durch eine „Place Nazet“ zu ersetzen, in Erinnerung um ein Paar, das sich um die provençalische Folklore verdient gemacht hat. Immerhin vergeblich.
Im Juli 2012 – mittlerweile heißt der Präsident Hollande - beantragt Corbière im Stadtrat, die Promotion für das Buch „Métronome“ von Laurent Deutsch zu beenden. Es wimmele von historischen Fehlern, verachte die Republik und die Französische Revolution. Der Schauspieler und Fernsehanimator Deutsch ist erklärter Monarchist (und mag die schiefe Wurzel-Metapher):
Für mich endet die Geschichte unseres Landes 1793 mit dem Tod Louis' XVI. Dieses Ereignis markiert das Ende unserer Zivilisation. Man hat unseren Wurzeln den Kopf abgeschnitten. Seitdem suchen wir sie.
Dass der Antrag abgelehnt wird, ist weniger interessant als die Reaktion der rechten Medien. Sie zeigen ihre (in die Jahre gekommenen) Instrumente: der revolutionäre Terror, der Krieg in der Vendée, der Hitler-Stalin-Pakt, der Gulag. Sébastian Le Fol, damals „Le Figaro“, heute Chefredakteur des „Point“, zeigt repräsentativ die gesamte bürgerliche Superiorität in Sachen Geschichte:
Schon immer haben es die Kommunisten geliebt, die Geschichte (neu) zu schreiben. Wer sein Leben unter den Fittichen eines ihrer Lehrer verbracht hat, hat Unterricht aus einem besonderen Blick auf die großen Ereignisse erlebt. Der revolutionäre Terror? Eine schlecht angewandte Dukan-Diät. Der Krieg in der Vendée? Ein schlecht ausgehendes Städtetreffen... Und trotz all ihrer Lügen haben sie noch immer die Stirn, uns Geschichtslektionen zu geben.
„Geschichtslektionen“ sind sie natürlich nicht, die Kommentare aus dem Jahr 2013 zu Hollandes Gesetzen zur Transparenz von Politikern nach der Cahuzac-Affäre (ein Finanzminister mit geheimen Schweizer Konten):
Der Druck der kleinen Robespierres (Peltier, Vizepräsident der konservativen UMP)
Man hört nur noch die großen Moralprediger, die neuen Robespierres, ja sogar die roten Neo-Khmers (Anna Cabana, Journalistin BFMTV);
Man wird den Verdacht ausweiten, als ob wir zur Terreur, zum schwärzesten Aspekt der Revolution zurückgingen (Alain Finkielkraut, Philosoph).
Sie haben die Geschichtslektionen ihrer Klasse gelernt. Slavoj Žižek denkt sie weiter:
Die Schlussfolgerung daraus ist die bekannte zynische Weisheit, Korruption sei besser als ethische Reinheit, schlichter Machthunger besser als die Zwangsvorstellung einer historischen Mission.
Und diese Doxa lässt zusammenwachsen, was nicht zusammengehört. Eigentlich. Dazu mehr im nächsten Beitrag
Alexis Corbière, Jacobins! Paris 2019 (Perrin)
Eric Hobsbawm, Ausx armes, historiens! Paris 2007 (La Découverte)
Sophie Wahnich, Freiheit oder Tod. Berlin 2016 (Matthes&Seitz). Vorwort von Slavoj Zizek.