In diesem Jahr lebe ich 35 Jahre in Berlin. Wenn ich durch die Schönhauser Allee gehe an einem heißen Sommertag, rieche ich manchmal noch die Erwartungen der aus der Provinz geflohenen jungen Frau, die sich an die olfaktorische Gegenwart der großen Stadt banden, den Geruch aus Lindenblüten und Wasser, das auf vertrocknete Straßen gesprüht wird, vermischt mit dem herberen von Einkellerungskartoffeln, Außentoiletten und toten Mäusen, versotteten Schornsteinen und Linsensuppe mit Speck, wenn man durch eine Toreinfahrt auf den Hinterhof wechselte. Die Kaputtheit der Stadt passte zu meinen zerstörten Kinderillusionen, da ließ sich etwas Neues aufbauen, und in den unrenovierten Räumen und auf den Friedhöfen waren die früheren Generationen ganz nah.
Die Berliner Friedhöfe sind Oasen der Stadt und tagsüber offene Orte der Stille. Angelegt vor den Toren der Stadt, wuchs die Stadt um sie herum. Einmal wohnten wir direkt an einem Friedhof, und die Kinder spielten auf den überwucherten Familiengräbern der Bötzows, Sieferts oder Endes, während wir Erwachsenen den Geschichten der Begrabenen nachgingen. Irgendwann wurde eine Ecke des lange geschlossenen Friedhofs freigegeben für die Beerdigung der Verrückten, Bohemiens und früh Verstorbenen meiner Generation, eine fröhliche Grünanlage mit viel Klimbim und versteckter Trauer.
Heimat und Solidarität
Nehmen Geflüchtete unser Land mitunter zärtlicher und schöner wahr als wir selbst? Am Beispiel Berlins: Widad Nabi ist eine syrisch-kurdische Lyrikerin. Ihr antwortet die Autorin Annett Gröschner
In der letzten Woche habe ich feststellen müssen, dass der Friedhof um die Hälfte verkleinert wurde. Der Rest wurde privatisiert und einem neuen Haus mit Eigentumswohnungen zugeschlagen. Wo die unbekannten Toten der Straßenkämpfe im April 1945 begraben wurden, stehen jetzt Mülltonnen. Sollte ich hier begraben werden wollen, ich würde keinen Platz mehr finden. Vielleicht werde auch ich im Meer enden. Es gibt keine Gewissheiten, dass wir davonkommen werden. Vielleicht schotten wir uns deshalb immer mehr ab, schauen weg, wenn einer um Hilfe ruft, äffen in der S-Bahn den Zeitungsverkäufer nach. Lassen Schiffe mit Geflüchteten nicht in unseren Häfen ankern. Kriminalisieren Retterinnen und Retter. Seit es Schiffe auf Meeren gibt, war die Rettung Schiffbrüchiger kein Gnadenakt, sondern das, was wir Zivilisation nennen. Auch wenn ich das alles nicht will, bin ich Teil davon, solange es mir nicht gelingt, daran etwas zu ändern. Was hindert uns, protestierend auf die Straße zu rennen, das Innenministerium zu besetzen, das Europarlament zu belagern?
Die Geflüchteten des Sommers 2015 waren es, die mich wieder lebendig werden ließen, die mich aus meiner Lethargie holten. Ich hatte meine Wohnung verloren, die mir Behausung und Arbeitsort, Archiv und Gedächtnis war. Ich verlor sie nicht an Geflüchtete und Fremde, ich verlor sie an Leute, die aussahen wie ich, die sprachen wie ich und die Angst hatten wie ich. Aber sie hatten das Geld, um ihre Angst zu kompensieren. Und zugleich wuchs etwas Neues: Berlin ist zu einer Arche Noah geworden, nicht nur für die Geflüchteten aus Syrien oder Afghanistan, auch für Künstler und Intellektuelle aus Ungarn, Polen, Türkei, Kroatien, selbst aus Großbritannien – die mit dem neuen Nationalismus ihrer Länder nichts anfangen können oder ihre Arbeitsmöglichkeiten aus politischen Gründen verloren haben. Gemeinsam haben wir eine Chance, der Abschottung etwas entgegenzusetzen.
Ja, Entschuldigung ist ein schweres Wort. Aber es gibt für auch für eine Muttersprachlerin und studierte Germanistin wie mich Wortverbindungen im Deutschen, die mich sprachlos machen, die nicht über meine Lippen wollen. Worte, die mit Absicht etwas anderes vortäuschen, um das Grauenhafte, das sich dahinter verbirgt, für Außenstehende harmlos erscheinen zu lassen. In den letzten drei Wochen habe ich viele dieser Worte in mein Notizbuch geschrieben, Dokumente eines menschenverachtenden Zynismus zum Zwecke des Machterhalts: Ankerzentrum, Asylwanderung, Asylwende, Fluchttourismus, Transitzentrum und am schlimmsten, zynischsten, menschenverachtendsten: „Zurückweisung auf Grundlage der Fiktion einer Nichteinreise.“ Ich habe die gleiche Angst wie Du, Widad, dass auch Berlin die Geflüchteten internieren könnte, aus den Augen der Zurückbleibenden, die so verarmen, dass es mit finanzieller Unterstützung nicht aufzuwiegen sein wird. Ich habe Angst, dass Berlin mir abhandenkommen könnte. Und vielleicht auch sich selbst.
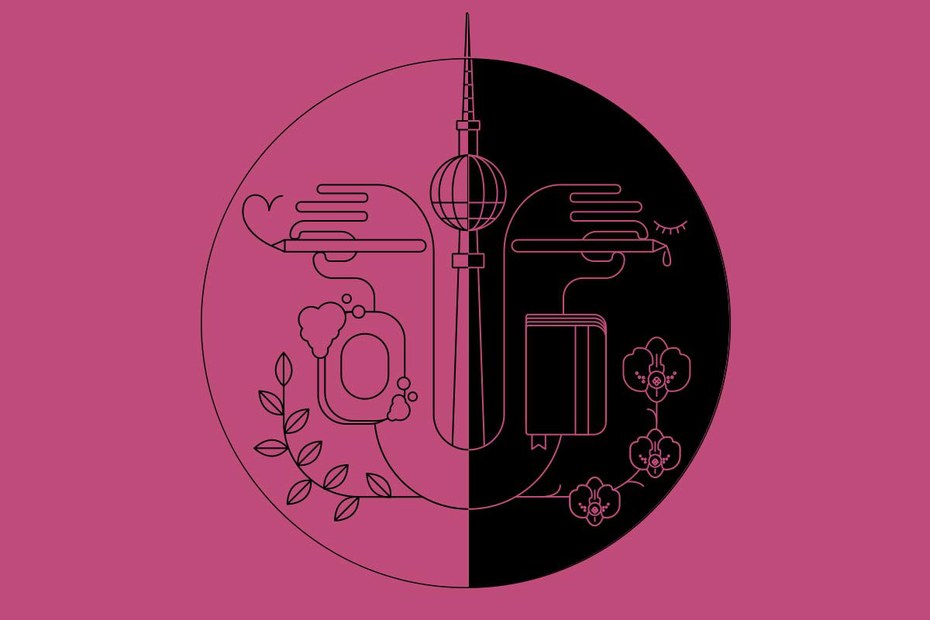





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.