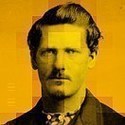Gut, dass es letztlich nur Pixel sind: Diese Welt dürfte klimakatastrophische Endzeit-Szenarien – vermutlich – um einige Längen toppen. Am New Yorker Times Square: Wolkenkratzer-hohe Hakenkreuz-Banner. Die Freiheitsstatur: Vergangenheit; stattdessen dort: ein Arier-Monument, entwachsen den größenwahnsinnigsten Führerträumen von Arno Breker und Leni Riefenstahl. Lediglich die kleine Welt offeriert Spurenelemente vom American Dream der Nachkriegsjahrzehnte: Radiosongs etwa von Frankie Laine, oder Premierenkino-Anschläge für den neuesten Streifen mit Rock Hudson und Doris Day. Das TV ist nicht viel besser. Medial verköstigt werden die amerikanischen Volksgenoss(inn)en mit Kochsendungen, in denen BDM-erprobte Köchinnen Rezepte für die arische Hausfrau zum Besten geben, oder Quizshows, in denen rangadäquat gewandete SA-Gruppenleiter knifflige Fragen zur Genese des Nationalsozialismus beantworten müssen. Ob U-Bahn-Anzeigen oder alltägliche Warnhinweise, etwa auf Trafokästen: überall sind Hakenkreuz und Adler des Großdeutschen Reichs präsent. Selbst der Pub um die Ecke eignet sich in dieser Welt nicht wirklich für die kleine Flucht mit oder ohne Absacker: nicht nur wegen der Kneipen-Flimmerkiste, sondern auch wegen ockerbraun uniformierter Mitgäste.
Die Auflösung des Ganzen: Deutschland und Japan haben den Zweiten Weltkrieg nicht verloren, sondern vielmehr gewonnen. Washington D. C. wurde via Nazi-Bombe eingeäschert, die Reste der US Army an den Stränden von Virginia Beach massakriert. Seither sind die USA ein geteiltes Land. Der Osten und die Mitte sind ein Protektorat des NS-Staats. An der Pazifikküste haben die Japaner das Sagen. Dazwischen, in den Rocky-Mountains-States, befindet sich ein Puffer-Gebiet, die Neutrale Zone. Das ungefähr ist die Ausgangssituation im Jahr 1962 – zumindest in »The Man in the High Castle«, einer Adaption des SF-Romans »Das Orakel vom Berge« von Philip K. Dick. Als Serie umgesetzt haben das Projekt zwei Genre-Routiniers: Ridley Scott, der bereits bei »The Blade Runner« seine Affinitäten zum Dick’schen Werk unter Beweis stellte, und David W. Zucker. Das einigermaßen weitverzweigte Setting im Kurzdurchlauf: Sowohl im Osten als auch im Westen gibt es Gute und Böse. Die Guten – tragende Figur hier: die durch eine Verkettung von Umständen in den Widerstand geratene Juliana Crain (Alexa Davalos) – sammeln sich in unterschiedlichen Untergrundbewegungen. Haupt-Böser bei den Nazis ist der Obersturmbannführer John Smith (Rufus Sewell), bei den Japanern Takeshi Kido (Joel de la Fuente), Chef der Kempeitai-Einheiten im Großraum San Franzisco und somit die japanische Version eines Gestapo-Polizisten.
Bereits im Verlauf der ersten drei Staffeln hat die Serie diverse Entwicklungen hingelegt. Die erste – gestartet 2015 – offerierte im Kern das Szenario einer Agentengeschichte. Im Mittelpunkt standen Spionage und verdeckte Operationen – ein gutes Mittel, um die Zuschauer mit der morbiden Welt von Vorlage und Serie vertraut zu machen; in zwei und drei folgten dann Fortführung der politischen Großwetterlage und weitere personelle Verwicklungen. Obwohl es dramatechnisch in gängiger Manier zur Sache geht und auch die Ambivalenz der einzelnen Figuren keinesfalls zu kurz kommt, ist die eigentliche Faszination von »The Man in the High Castle« weniger das »Was« als vielmehr das »Wie«. Sicher hat die morbide Inszenierung – also die Summe der Äußerlichkeiten wie stetig präsente NS-Assecoires, die abgespeckte Farbgebung Marke »Der Soldat James Ryan« sowie das detailstimmige Interieur der Vierziger bis frühen Sechziger – wesentlichen Anteil an der klaustrophobischen Gesamtstimmung: Der abgewetzte Pontiac unterm Hintern sowie der ebenso abgetragene Hut Marke Depressionsära sind hier sozusagen die halbe Miete. Inhaltlich ist es vor allem der stetig präsente Kontrast zwischen Elementen des wirklichen Geschichtsverlaufs und der alternativen Geschichtsdarstellung der Serie. In der Regel wird der politische Horror durch subtile Details vermittelt: etwa, wenn ein hilfreicher Highway-Patrol-Officer dem Durchfahrenden erklärt, bei dem herabfallenden Schnee handele es sich um Verbrennungspartikel – an bestimmten Wochentagen werde lebensunwertes Leben, so sei es in der Gegend eben, seiner Endlösungs-Bestimmung zugeführt.
Auch die Musik sorgt ordentlich für Irritation. RnB, Swing, Hillbilly oder auch Billie Holidays »Strange Fruit« untermalen Szenen, die einerseits illustrieren, dass auch in diesem Alptraum-Szenario noch nicht alles verloren ist, anderereits jedoch genau diese Art von Musik ad absurdum führen. Zusätzlich befördert wird die doppelte Zeitverpflanzung – die in die 1962er-Normalwelt und die der nunmehr Schritt für Schritt angestrebten Nazi-Weltherrschaft – durch dramatikbefördernde Orchesterklänge ähnlich wie in Filmen der Vierziger und Fünfziger. Insgesamt erzeugt dies eine Retro-Stimmung, die gerade wegen ihrer multiplen Bezüge eine geradezu klaustrophobische Wirkung entfaltet. Verschwörungstheoretisch Angehauchte werden die Serie darum vermutlich lieben: Um die Ecke scheint mitunter Maestro Orson Welles himself hervorzutreten – ein Regisseur und Schauspieler, der mit dem Radiostück »Der Krieg der Welten« 1938 derart stilecht eine Außerirdischen-Invasion in Szene setzte, dass zahlreiche Zuhörer(innen) in Panik gerieten.
Die Globalgeografie sollte man bei »The Man in the High Castle« stets mit im Blick behalten.
Andere Bezüge zu Welles sind bereits in der Romanvorlage angelegt. Hochkarätiger »Mystery« ist vor allem der rote Faden, welcher sich durch alle vier Staffeln zieht: eine Parallelwelt zur aktuellen, in der die Alliierten den Krieg gewonnen haben und die über ein – in den Händen der Nazis befindliches – Portal in beide Richtungen beschritten werden kann. Schlimmstmögliche Kalamität hier: Afroamerikaner, die in einer Bar nicht bedient werden, und natürlich der langsam Fahrt aufnehmende Vietnamkrieg. Um in die echte (beziehungsweise: die Serien-) Welt zurückzukehren: Ein Weltenswitch-Portal, an dem naturgemäß auch der Widerstand interessiert ist, und das in Staffel 4 noch zentraler als bislang in den Mittelpunkt der Handlung rückt. Dramaturgisch sind die Probleme der abschließenden Staffel ähnlich gelagert wie die der letzten Staffel von »Game of Thrones«: Ein sinnvolles Ende zu finden – respektive in 10 Folgen einzuparken – ist nicht ganz einfach im Anblick einer Konstellation, die von Staffel zu Staffel neue Handlungs-Pirouetten bereithielt. Szenario in vier, zeitlich mittlerweile im Jahr 1964 angesiedelt: Der Kalte Krieg zwischen Deutschland und Japan droht in einen heißen überzugehen. Der Führer, der sich diesbezüglich bislang eher durch Lavieren auszeichnete, ist mittlerweile tot. Der Neue – einer aus der allseits bekannten Paladin-Riege – ist da weniger friedlich gestimmt. Eine Geschmacksprobe, welche Pläne die Herren des Reiches anno 1964 schmieden, kann man sich – Achtung, Spoilergefahr – hier abholen.
Für Serien ist es nicht schlecht, wenn die angelegten Konflikte am Ende irgendwie aufgelöst werden. Kein ganz einfacher Part – in Sachen Komplexität hat auch »The Man in the High Castle« Staffel für Staffel eine Schippe draufgelegt. Nichtsdestotrotz sind zu Beginn von Season 4 Hoffnungsschimmer am braunen Horizont erkennbar. Im Westen tritt die Black Communist Rebellion als eine neue Widerstandsbewegung auf den Plan; gleichzeitig bekommt die japanische Friedenspartei mehr und mehr Oberwasser. Im Osten steht Reichsmarschall John Smith, erkenntnisgeläutert durch Portal-Exkursionen in die Parallelwelt, unter Druck seitens der Reichsspitze in Berlin – auch hier geht also noch Einiges. Wie die Serie endet, soll an der Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Gänzlich schlüssig – ergo: logisch – mögen die jeweiligen Auflösungen zwar nicht sein. Umgekehrt allerdings sind »Rückstände« bei dieser Form Großhandlung nahezu unvermeidbar. Zusätzlicher Tipp: Amazon als typisch amerikanischer Medien-Großplayer wäre nicht Amazon, gäbe die Serie zum Schluss nicht eine Art humanistischer Botschaft mit auf den Weg (jedenfalls in ihrer Kapitalismus-kompatiblen Variante) – eine Botschaft allerdings, die im Zeitalter der Qualitätsserien durchaus gebrochen ausfallen darf und auch den Zuschauer(inne)n Raum lässt, das Gesehene gedanklich zu verarbeiten.
Apropo Kapitalismus: Als ausgeschlossen gelten darf, dass amazon seine Renommierserie aus humanistischen Gründen auslaufen ließ. Die reellen Gründe – zu wenig Quote – sind vollkommen auf der Höhe der aktuellen Zeit. Durchwachsen, so jedenfalls kino.de, seien zudem auch die Kritiken ausgefallen. Werten kann man das Ende unterschiedlich. Für Fans mag die Einstellung sicherlich betrüblich ausfallen. Wer die Veröffentlichungspolitik der großen Streaming-Plattformen kritisieren will sowie das dort obwaltende Markt-Prinzip, hat hier ebenfalls seinen Fall. Künstlerisch hingegen ist die Einstellung nicht unbedingt ein Unglück: Mit Ausnahme der obligatorischen Mini-Abstriche (siehe letzten Absatz) hatten die Serien-Macher(innen) so die Chance, einen glaubhaften Schlussstrich unter ihr Epos zu ziehen. Eine Lösung, die nicht nur besser ist als das Ausdehnen zu Endlos-Events der Marke »Orange is the New Black« oder »Nashville«, sondern letztlich – siehe »Breaking Bad« oder auch »Die Sopranos« – die Möglichkeit offeriert, einen würdigen Abschluss zu finden.
Operation so: letztendlich geglückt. Und die Moral? Eine »Moral der Geschicht’« könnte simpel lauten: Gut, dass die Richtigen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Sicher sollte man derartige Botschaften nicht überstrapazieren. Doch auch wenn die Motive, diese Serie zu schauen, vorwiegend eskapistischer Natur sein mögen, bleibt als Wurm durchaus im Kopf: Eine Nazi-Herrschaft – egal ob in moderat-softem Gewand wie unter dem derzeitigen US-Präsidenten oder in der Hardcore-Version mit Vernichtungslagern, Massakern und Welteroberungsgelüsten – ist so ziemlich das Letzte, was zur Lösung der derzeitigen politischen Probleme beitragen würde. Summa summarum unterscheidet sich die Serie in genau diesem Widerhaken von echten Nazi-Trash-Produktionen, in denen der NS lediglich als Grusel-Beiwerk fungiert. Zutreffendste Einordnungs-Liga am ehesten so: Quentin Tarantinos »Inglourious Basterds«.
Fazit: letztendlich sicher (immer noch) eine Unterhaltungsserie. Immerhin kann man sich beim Streamen von »The Man in the High Castle« einem wohligen Gefühl hingeben: Goebbels hätte sie bestimmt verboten. Und auch bei den aktuellen Maßanzug-Nehmern des Reichs-Propagandaministers würde sie, sofern umsetzbar, sicher ebenfalls im Giftschrank landen.
The Man in the High Castle. TV-Serie, 4 Staffeln à 10 Folgen. Zum Streamen abrufbar bei amazon Prime.