Grob gesagt gliederte sich die Rockmusik-Anhängerschaft der Sechziger in drei Lager: das der Beatles, das der Stones- und das von Bob Dylan. Schnittmengen gab es zwar stetig. Die harten Kerne indess waren gegen derlei Lauheiten mit hoher Immunität gewappnet. Anhängerschaft dieser Couleur schlägt sich nun nicht nur lebensgeschichtlich nieder. Sie bildet auch relativ unverwechselbare Geschmackspräferenzen aus. Was mich persönlich anbelangt, ist es sicher kein Zufall, dass ein Stones-Song den Aufhänger abgibt für diese Songvergleich-Folge: Mit den rollenden Steinen wurde ich sozialisiert, Dylan rangiert für mich in der Götterliga, und den »Fab Four« (Lennon ausgenommen) begegnete ich bereits zu Band-Lebzeiten mit einer fast an Gleichgültigkeit grenzenden Indifferenz. Schlüsselsong für das dritte Viertel der turbulenten Sechzigerjahre – also jene Epoche, als die Jugend- und Studentenbewegung noch nicht auf ihrem Höhepunkt angelangt war, andererseits jedoch vernehmbar auf diesen zudriftete – ist für mich daher klar ein Stones-Klassiker: »Paint it black«. Begründung: Anders als andere Zeitlos-Hits dieser Übergangsära malt er die Welt nicht in peacy Regenbogenfarben, sondern so, wie sie ist – ziemlich schwarz. Düsternis schwingt mit; fast scheint es so, als hätten Mick Jagger und die Seinen die Ereignisse von Altamont musikalisch vorwegzunehmen versucht.
Für einen Vergleich wäre vielleicht gerade deswegen ein Beatles-Stück der idealtypische Konterpart. Das Problem: Während die Rolling Stones in den zweieinhalb Jahren 65–67 den ersten Achttausender ihres Schaffens erklommen und en passant ihren Ruf als weltweit härteste Band festigten, ergaben sich ihre Pilzkopf-Kontrahenten eskapistischen Spielchen sowie Sinnsuchen unter indischen Palmen. Anders gesagt: Titel von echtem Klassiker-Rang finden sich im Beatles-Oeuvre zwischen 1965 und 1967 nicht. Am nächsten kommt dieser Liga noch »Eleanor Rigby« – einer der wenigen McCartney-Songs, die richtig, herausragend gut sind. Allerdings: Selbst im Rückblick verführt der Vergleich Stones versus Beatles einen wie mich eher zum Aufwerfen pophistorischer Alternativszenarien. Fragen des Poprevoluzzers in spe: Wie hätten sich die Fab Four weiterentwickelt, wenn John & Yoko den faulen Laden zeitig abgefackelt und – ich meine: so richtig, konsequent – ihr eigenes Ding aufgezogen hätten? Nicht 1970, als alles bereits den Bach runtergangen war, sondern sagen wir 68 – auf dem Höhepunkt der Revolte?
Hätte Lennon gut mit Jagger gekonnt, und mit Richards? Wäre aus Yoko Ono am Ende eine verfrühte Patti Smith der Rockmusik geworden? Hätte George Harrison auf Studioproduzent umgesattelt und Ringo Starr auf Taxifahrer? Würde Rudi Dutschke heute noch leben, Lennon noch unter uns weilen? Die Fragen sind müßig. Musikalisch ergiebiger ist der Blickwinkel auf die echten Innovationsfelder der Sixties. Konkret: die musikalischen Symbiosen, die sich aus dem zunehmenden Crossover zwischen Rock- und Folkmusik ergaben. Bis weit in die erste Hälfte der Sechziger hinein waren Folk und Rock getrennte Welten – hier ordentlich angezogene Bürgerrechtler(innen) mit liberalem Background, da die bösen Jungs (und Mädels), die Dinge taten, die ordentliche Bürger schwer ins Grübeln brachten. Um 1965 allerdings schickte ein Top-Act der Folkszene sich an, die Seiten zu wechseln: Monsieur Robert Zimmermann aka Bob Dylan. Nicht nur das. Ebenso wie die Stones befand sich Dylan Mitte der Sechziger auf einem erstem Schaffenshöhepunkt. Ausbeute: fast im Vierteljahrestakt Titel, die bis heute zum Grundkanon der Rockmusik gehören. Ein Dylan-Schlüsselstück zu jener Zeit, vielleicht das Dylan-Schlüsselstück für die Periode schlechthin: der Vergleichs-Konterpart zu »Paint it Black« – »Like a Rolling Stone«.
Paint it Black
Beginnen wir unsere musikalische Zeitreise auf der britischen Insel. Oberflächlich scheint »Paint it Black«, enthalten auf der im Frühjahr 1966 veröffentlichten LP »Aftermath«, allen Trends gerecht werden zu wollen, die damals durch die Luft flirrten. Der Sitar-Sound des Intros geht konform mit den Experimenten, welche die Konkurrenten aus Liverpool seinerzeitig starteten. Love & Peace – also die Hippiebwegung – schwingt ebenfalls mit. Vergleicht man »Paint it Black« allerdings mit anderen musikalischen Begleittönen zur Hippie-Welle (etwa dem ein Jahr zuvor erschienenen Stück »California Dreamin’« der US-amerikanischen Formation Mamas and Papas), wird der Unterschied recht schnell deutlich. Hier weichgespülter, auf Mainstream getrimmter Folk der Sorte, den in Deutschland etwa das Duo Abi & Esther Ofarim zum Geschäftsmodell ausbaute, dort im Kern grunddüsterer Rock. Was nicht nur mit der im Titel mitschwingenden Farbe Schwarz zu tun hat. Im Kern ist »Paint it Black« ein Stück über die Hoffnungslosigkeit, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen (hier: die Freundin des Sängers) einhergeht.
Für die damalige Zeit war derart zelebrierte Trauer zwar sicher ungewöhnlich – umgekehrt allerdings nichts, was das Stück für die Rolle eines Rockmusik-Klassikers prädestiniert hätte. Allgemein im Trend lag jedoch die Zur-Schau-Stellung, die Exhibitionierung von Gefühlen. »Laß’ es raus!« – Für heutige, auf neoliberale Effizienz konditionierte Ohren mag diese Aufforderung exotisch klingen, vielleicht sogar unangemessen. Im Kontext der Sechziger und Siebziger allerdings waren Authenzität und Gefühlsausdruck ein erstrangiges Gut. Politisch war derlei neu. Sicher bewegt man sich mit derlei Aussagen auf dem Boden der Spekulation. Umgekehrt jedoch ist die Behauptung keinesfalls abwegig, das ohne diese offensive Expressivität »Paint it Black« kaum jenen Sog entwickelt hätte, welchen der Song im Verlauf seiner weiteren Karriere entfaltete.
Das Zeitfenster der Songkarriere ist im konkreten Fall durchaus bemerkenswert. Wie jedes Popmusik-Stück mit Klassikerrang wurde auch »Paint it Black« unzählige Male gecovert und neu eingespielt. Alleine die Live-Einspielungen der Rolling Stones sind Legion. »Paint it Black« wurde allerdings noch von einem weiteren Star-Act der britischen Rockmusik aufgegriffen: Eric Burdon. In der zweiten Hälfte der Sechziger startete der Ex-Animals-Sänger gerade mit einer zweiten Karriere durch. Die dritte begann 1969 mit einem auch für damalige Verhältnisse elaborierten Musikprojekt. Heute würde man Eric Burdon & War als multikulturelle Formation klassifizieren, den Stil eventuell als Weltmusik. In Wahrheit ging es Burdon und seinen (überwiegend afroamerikanischen) Mitstreitern darum, aus Black-Power-Programmatik, afroamerikanischem Funk, Rock sowie freien, aus dem Jazz entlehnten Improvisationsformen eine Art politisch-musikalisches Gesamtkunstwerk zusammenzuschmieden. Klingt hoch ambitioniert – die beiden Alben, welche diesem temporären Zusammenschluss entsprangen, lösten den Anspruch jedoch voll und ganz ein. Auch im Abstand von nunmehr 50 Jahren gehören sie zum Besten, was die Endsechziger- und Anfangssiebziger-Rockmusik zustandebrachte. Burdons Kriegserklärung ans Etablishment (sinnfälliger Albumtitel des Erstlings: »Eric Burdon declares War«) zeigt den Ex-Animals-Sänger auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Ein Highlight innerhalb dieses Highlights: der Stones-Titel »Paint it Black«: zwölf Minuten lang implodierend-expressive Energie – mehr ging auch später nicht allzu oft.
Like a Rolling Stone
Verglichen mit der Energie, welche die Stones und Burdon »Paint it Black« verliehen, kommt die Originalversion von »Like a Rolling Stone« vergleichsweise gemäßigt daher. Das Stück erschien im Sommer 1965 auf dem Album »Highway 61 Revisited«. Für Dylanologen ist das Album gemeinhin DER herausragende Meilenstein in Bob Dylans Oeuvre schlechthin. Darüber hinaus gilt es als die Wendemarke vom Folk-Stil der Anfangsjahre hin zu einem Rockmusik-orientierteren Sound. Einerseits lösen die Songs des Albums die Einordnung »Rock« ohne Wenn und Aber ein; bereits die unterstützende Begleitcombo lässt hier kaum Interpretationsspielraum zu. Andererseits gibt es gerade von »Like a Rolling Stone« höchst unterschiedliche Dylan-Interpretationen – vergleichsweise folkorientierte stehen solchen gegenüber, auf denen es der Meister richtig krachen lässt. Der Einschätzung, dass »Like a Rolling Stone« zu den herausragenden Kompositionen Dylans gehört, würde ich mich zwar ebenfalls anschließen. Andererseits ist gerade dieses Dylan-Stück eines der Wenigen, in denen die Kopie – zumindest einige davon – besser gerieten als das Original.
Die Preisfrage, welche Band »Like a Rolling Stone« nicht nur adäquat, sondern sogar besser einspielen könnte als Dylan himself, ist im konkreten Fall nicht schwer zu beantworten: Es sind die Rolling Stones. Ein anspruchsvolles Unterfangen: Textlich spielt die Geschichte um eine Frau aus gutem Haus, deren Selbstzerstörungstrieb sie zunehmend in Richtung Gosse führt, in der absoluten Oberliga. Von der Textstruktur her ist »Like a Rolling Stone« also im Geschichtenerzähl-Modus angesiedelt – einer Kunstform somit, für die der Folksong weitaus bessere Rahmenbedingungen bietet als die stärker auf das Gesamtergebnis fokussierte Rockmusik. Nichtsdestrotrotz schafften es die Stones auf dem (weitgehend) »unplugged« eingespielten Album »Stripped« anno 1995, diesen Klassiker des Folkrock auf eine Weise einzuspielen, dass man den Eindruck gewinnt, »Wie ein rollender Stein« sei ihnen auf den Leib geschrieben worden und nicht dem großen Troubador der Americana. Ein Dylan-Song als Schlüsselsong der Rolling Stones? Das Wortspiel mit dem rollenden Stein führt hier in der Tat in die Irre. Im Sprachslang des Blues ist »Rolling Stone« ein Synonym – für jemand, der sich herumtreibt (ähnlich wie »Backdoor Man« – eine Metapher, die auf fremdgehende Männer anspielt, die sich zur Hintertür herausschleichen) und sich dabei mit Menschen einlässt, die ihm oder ihr nicht guttun.
Nichts anderes meint der Begriff im Song – was auch das Video auf den Punkt bringt, dass die Stones zur gleichnamigen Tour 2012 herausbrachten. Dass »Like a Rolling Stone« vielleicht mehr den Stones auf den Leib geschneidert ist als seinem Schöpfer selbst, unterstreicht auch eines jener Live-Aufeinandertreffen, in dem Dylan & Stones den Song gemeinsam einspielten. Gemeinhin gibt es wenig Anlässe, mit Bob Dylan Mitleid zu haben. Die Art und Weise, wie Jagger & Co. den Maestro 1998 zum Statisten seines eigenen Stücks degradierten, sagt jedoch viel darüber aus, wie Rockmusik funktioniert. Kann es sein, dass Dylan bei jenem Auftritt spürte, dass ihm die Kontrolle über sein Werk entglitten war – möglicherweise sogar bleibend, unwiderruflich? Oder war es nur seine vielgerühmte – oder besser: berüchtigte – Laune, die er (immerhin: passabel und mit einspieltechnisch durchaus beachtlichem Ergebnis) unter Kontrolle zu halten versuchte?
Wir kennen die Antwort: Es ist letztlich egal; oder, macchiavellistisch gesprochen: der Erfolg rechtfertigt die Mittel. In Sachen personell eng gelagertem Folk-Rock-Crossover zwischen Ost- und Westküste des Atlantik wäre schließlich noch ein dritter Titel aufzuführen: »It’s All Over Now, Baby Blue«. Ebenso wie »Lika a Rolling Stone« ist auch »It’s All Over Now, Baby Blue« eine Dylan-Komposition aus dem Jahr 1965. Erstveröffentlicht wurde es auf dem »Highway«-Vorgängeralbum »Bringing It All Back Home«. Anders als »Like a Rolling Stone« ist »It’s All Over Now, Baby Blue« (noch) im klassischen Folk-Duktus gehalten. Allerdings: Anders als beim Steine-Titel gaben sich die Coverversions-willigen Rock-Aspiranten bereits direkt nach Erscheinen die Klinke in die Hand. Als erste in den Startlöchern stand die nordirische Band Them. Die 1965 veröffentlichte Them-Variante erwies sich als so erfolgreich, dass sie im großen Rückblick fast gleich mit der Originalversion steht. Nicht fehlen im Baby-Blue-Reigen darf schließlich Eric Burdon. Seine Einspielung mit den New Animals erfolgte in dem Fall vergleichsweise spät, nämlich 1977. Auch soundtechnisch klingt sie eher wenig inspiriert – so dass man, sofern man sich nicht mit Courtney Loves Band Hole den »Baby Blue«-Kick geben möchte, mit Them sowie Dylan selbst gut über die Runden kommt.
Eine einig Liga?
Zwei(einhalb) Songs, zwischen die, das Lametta der Zeit abgezogen, kein Blatt Papier zu passen scheint? Auf den ersten Blick sieht es so aus. »Paint it Black« ist, auf die Sixties bezogen, sicherlich programmatischer. Auch für die Rolling Stones hatte der 1966er-Hiterfolg sicher eine größere Relevanz als die dreißig Jahre danach vorgenommene Dylan-Adaption. In Sachen Gesamtwertung der beiden (oder drei) scheiden sich die Geister. Beim ganz großen Blick von oben dürfte »Like a Rolling Stone« besser abschneiden. Selten hat ein Rocksong derart literarische Höhen erklommen; selten haben sich – zumindest in der Massenkultur-Variante – (hochkulturelle) Poetik und Rockmusik derart eng berührt. »It’s All Over Now, Baby Blue« muß in der Liga leider ausscheiden. Vergleichbar sind das Trauer-Stück der Stones und Dylans Lied über eine Frau, die sich zugrunderichtet, letztlich auf einer anderen Ebene: der, nach welchen Gesetzmäßigkeiten Rockmusik funktioniert.
Womit wir zu den beiden Geschäftsmodellen Dylan und Stones kämen. Beide – der Ausnahme-Poet aus dem Herzen der Americana und die (ehemals) härteste Band der Welt – sind mittlerweile im fortgeschrittenen Alter angelangt. Nicht ausgeschlossen, dass es Rockmusik nach ihnen in der uns bekannten Form nicht mehr geben wird (zumindest nicht mit dem Pathos, der derzeit immer noch zuckt und Ansprüche anmeldet). Ob das gut ist oder schlecht, ist an der Stelle weniger von Belang. Bemerkenswert ist, auf welch unterschiedliche Weise die Helden von einst mit dem Faktor Alter(n) umgehen. Beide – Dylan wie Jagger & die Seinen – haben es geschafft, sich als Verwalter ihres jeweiligen Geschäftsmodells zu etablieren. Beide treten nach wie vor live auf – Dylan neuerdings mit Piano anstatt Gitarre, die Stones vermutlich mit exzellenten Fitness-Trainer(inne)n im Hintergrund. Unterschiedlich war und ist der Zugang zur jeweiligen »Familie«. Während die weltweite Gemeinde der Dylan-Anhänger(innen) eine Gemeinschaft der Conaisseure, der Wissenden und mit Geschmack Ausgestatteten bildet, ist der Zugang zur »Stones-Family« nach wie vor eine höchst formlose Angelegenheit.
Egalitär sind sie – in einem gewissen Sinn – beide. Dylan sorgt mit seinem Ausschlachten der amerikanischen Popularkultur stetig für genügend »Durchzug«; im Club der Stones ist man eh so lange dabei, wie man dazu Lust verspürt. Last but not least: Auch auf die aktuellen Lockdown-Umstände haben beide auf ihre jeweils eigene Art reagiert: Dylan mit einer nachgeschobenen Ad-hoc-Veröffentlichung, die Stones mit einem brandneuen Titel: »Living in a Ghost Town« – ein Stück, dass aller Umstände ungeachtet so klingt, wie ein typischer Stones-Titel eben klingt. Die Zukunft? Auf die Bühne wird es Jagger, Richards, Ron Wood und Charlie Watts vermutlich eh so lange ziehen, wie es die physische Konstitution mitmacht. Why, weil Kohle allein das Motiv schlecht sein kann? Vermutlich, weil sie es können. Und vermutlich – immer wieder – wissen wollen, dass sie nach wie vor die Größten sind.
Schwanzlängenvergleich? Ein bißchen wohl auch. So lange dabei allerdings Songs wie »Paint it Black« und »Like a Rolling Stone« rumkommen, wird sich niemand darüber ernsthaft beschweren.
Mashups (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die »Mashup«-Textreihe kapriziert sich auf Schlüsselsongs – wobei in jeder Folge zwei vergleichbare Popmusik-Stücke im Mittelpunkt stehen. Die Folgen:
Mashup Vol. 1: Hardrock versus Country
Mashup Vol. 2: Stones versus Dylan
Mashup Vol. 3: Feuerzeugballaden (folgt)

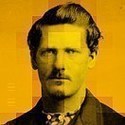



Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.