Kinder, die einen Skorpion in einen Ameisenhaufen setzen, Temperenzler, die Umzüge für eine Zeit veranstalten, die noch nicht gekommen ist, herumlungernde Revolvermänner, eine einreitende Bande – oder sind es doch nur Soldaten? Nach fünf Minuten The Wild Bunch sind zumindest zwei Dinge ausgemacht. Erstens: Im dem südwesttexanischen Kaff San Rafael wird demnächst die Luft explodieren. Zweitens: den Grundzwist zwischen zivilisatorischem Anspruch und delinquenter Realität werden auch die 140 folgenden Filmminuten – aller Voraussicht nach – nicht auflösen können. Gerissen hat Sam Peckinpahs Spätwestern von anno 1969 dafür gleich mehrere Marken: das bis dato geltende Level noch akzeptierter Gewaltdarstellung, das Level für nötig erachteter Zensureingriffe, den Konsens darüber, wie weit Western beim Dekonstruieren der glorreichen Pioniervergangenheit gehen dürfen, und schließlich das Ausmaß an Troubles während Dreharbeiten und Postproduktion. Lange Zeit umstritten war darüber hinaus die Rezeption des Films. Im Unterschied zur heutigen Kritik, die Peckinpahs Movie fast durchgängig als Meisterwerk wertet, war die zeitgenössische Kritik eher weniger gnädig gestimmt.
Dabei ging es Regisseur Sam Peckinpah – der Vietnamkrieg trudelte gerade seinem Höhepunkt entgegen – lediglich darum, Amerika zu zwingen, den Blick auf die Gewaltförmigkeit seiner Gesellschaft zu richten. Im Fokus von The Wild Bunch steht eine Bande im fortgeschrittenen Auflösungsprozess. Letzte Chance für Pike Bishop (William Holden) und seine sechs Follower: ein Überfall auf das Lohnzahlungsbüro der örtlichen Eisenbahngesellschaft. Der Überfall endet in einem blutigen Fiasko. Nicht nur das: Die erbeuteten Dollar erweisen sich bald als wertloser Kleinmetallschrott. Zusätzlich sitzt den fünf Überlebenden nunmehr eine Horde aus Strauchdieben und Kopfgeldjägern im Nacken. Engagiert hat die der skrupellose Eisenbahngesellschafts-Manager Harrigan; angeführt wird sie von Deke Thornton (Robert Ryan). Auch Thornton, ein Ehemaliger aus Bishops Bande, sitzt in der Bredouille. Seine überschaubare Alternative: entweder Bishop & Co. zur Stecke zu bringen oder ins Gefängnis zu gehen.
Dass sich die Bande über die mexikanische Grenze absetzt, sorgt erst mal für eine gewisse Beruhigung. Allerdings nur scheinbar. In Mexiko nämlich fangen die Probleme erst richtig an. Die dortige Revolution – wir schreiben das Jahr 1913 – hat sich im Bürgerkriegsmodus festgefressen. Grenzregions-Statthalter des im fernen Mexico City obwaltenden Diktators Victoriano Huerta ist General Mapache – ein feister, mit allen einschlägigen Wassern gewaschener Warlord. Dessen zwei Hauptprobleme da sind: a) Pancho Villa mit seiner Nordarmee, b) die schlechte Bewaffnung der eigenen Truppen. Bei letzterem kommen Bishop und seine Leute ins Spiel. Der Deal: Ein Überfall auf einen Eisenbahntransport auf US-Seite soll Mapache die ersehnte Armierung, Bishop und dem Rest seiner Bunch die nötige Altersversorgung einbringen. Doch wie das so ist mit den guten Plänen: kaum geschmiedet, zerschellen sie meist an der Realität. Der Jüngste der Bande, Angel, sympathisiert mit den Villisten. Eine Waffenkiste, die Angel für diese abgezweigt hat, bringt Bishop und seine Bande nicht nur dazu, über Altersversorgung nachzudenken, sondern – ganz unversehends – auch über Fragen grundsätzlicher Loyalität.
Um Logikbrüche dürfen sich die Zuschauer (und – so sie wollen: Zuschauerinnen) nicht allzusehr scheren. Bereits in der Eingangsschießerei in San Rafael opfert Bishop einen seiner Leute – der Geopferte, ein stark einfältig in Sene gesetzter Psychopath, geht mit Jubel in den Tod. Der Überfall auf den Eisenbahnzug gelingt – allerdings mit taktischen Schnitzern. Anstatt die abgekoppelte Lok ins Nirgendwo weiterfahren zu lassen und Armee und Kopfgeldjäger so auf eine falsche Fährte zu setzen, bevorzugte Peckinpah den Clash: Die Lok fährt retour – was inszenatorisch zwar ein ordentliches Spektakel abgibt, den improvisationsfreudigen Bandenchef allerdings als nicht sehr weitsichtigen va-banque-Spieler bloßstellt. Und überhaupt: die Frauengeschichten. Bishops Vorgeschichte mit Geliebter (sie wurde – natürlich – erschossen) ist Kitsch as Kitsch can und selbst für die glamourverliebten Sechziger Drittliga. Wenig Glück mit Frauen hat auch Banden-Junior Angel. Als er seine Verflossene als Mätresse des Lokal-Diktators wiederfindet, schießt er sie – so viel Ehre muß schon sein – vor versammelter Soldateska nieder. Ein eher – sagen wir: pessimistisches – Frauenbild vermitteln auch die oppulent in Szene gesetzten Bordell-Orgien. Was, alles zusammen, The Wild Bunch eher nicht so zu jener Sorte Film-Klassiker qualifiziert, die sich fürs erste Rendezvous anbieten.
Filmgeschichte schrieb vor allem das Ende – nach Bishop/Holdens berühmter Ansage „Let’s go“. Bishop & Co., von Mapache nunmehr an der langen Leine gehalten, besinnen sich darauf, dass einer der ihren – Angel – in der Folterhaft ihres Auftraggebers sitzt, und raffen sich auf. Was folgt, ist ein Showdown, der selbst die italowesterngewöhnten Showdownkonventionen der End-Sechziger in den Schattten stellte: ein zwanzigminütiges Gemetzel, in dessen Folge Bishop und der Rest seiner Bande, bevor sie selbst draufgehen, Mapache und fast den gesamten Rest seiner Garnison mit in den Tod reißen. Auch hier sparte Sam Peckinpah nicht mit Mitteln. Tarantino-gleich streute er als Gimmick – die Zimmermann-Depeche ist da nicht weit – einen deutschen Militärberater in den Mexiko-String seiner Geschichte mit ein. Die Showdown-Aufnahmen blieben zumindest halbwegs im angesetzten Zeitfenster: Mit 25 Tagen überschritten sie es lediglich um eine Woche. Neben Slow-Motion-Effekten, umgesetzt mit insgesamt sechs Kameras, setzte Peckinpah dabei auf ungewöhnliche technische Finessen: Der Weg in Mapaches Hauptquartier wurde mit einem extrem tiefenscharfen Teleobjektiv aufgenommen, welches Soldateska sowie die der Schießerei entgegengehenden vier Bunch-Mitglieder auf einer perspektivkomprimierten Ebene zusammenschweißt.
Wie der Film – so das Ende. Von der verfolgenden Kopfgeldjäger-Truppe, die sich das Gemetzel aus der Ferne angesehen hat, ist lediglich Thornton übriggeblieben. Der klägliche Rest von Bishops Bande ist eine subalterne Randfigur – ein alter, abgetakelter Bandit, der aus Bewohnern von Angels Heimatort nunmehr eine neue Bunch rekrutiert hat. Die Optionen sehen sowohl für den Alten als auch Thornton nicht sehr berauschend aus. Auf Thorntons Begrüßungsfrage, wie es denn so laufe, antwortet der Alte: »Nunja – geht so. Früher lief es besser“ Um dann trotzig lachend hinzuzufügen: „Aber es geht noch.“ Die wirklich wichtige Frage dieses Geplänkels folgt unmittelbar auf dem Fuß: „Und, wie siehts aus? Hast du Lust mitzureiten?“ Und so endet selbst Peckinpahs desillusionierter Spätwestern in einer Art Happy End – mit Rückblenden auf Bishop und seine Bande und dem Musikmotiv des Films: La Golondrina – ein mexikanisches Volkslied aus dem Befreiungskampf gegen die Franzosen und bereits zur Filmhandlungs-Zeit eines, das gern bei Beerdigungen zum Zug kommt.
Troubles waren nicht nur der Gegenstand von Peckinpahs Outlaw-Epos. Auch vor, während und nach der Dreharbeiten gab es reichlich davon. Im üblichen Rahmen blieb lediglich das Besetzungskarrusell. William Holden – erprobt immerhin an der Seite von John Wayne in dem Bürgerkriegswestern Der letzte Befehl – war zweite Wahl und kam erst nach der Absage von Lee Marvin zum Zug. Marvin hatte Peckinpah bereits zugesagt, sich dann jedoch für die Hauptrolle in Westwärts zieht der Wind umentschieden. Eine Absage erteilte auch ein berühmter deutscher Schauspieler: Mario Adorf. Anstelle Adorfs spielte der mexikanische Schauspieler Emilio Fernández Huertas Lokalprätendenten Mapache. Ironie der Geschichte: Fernández, der seinerzeit im Widerstand gegen (den echten) Huerta engagiert war (ironischerweise auf Seiten eines anderen, in der Opposition tätigen Huerta), mußte zeitweilig als Exilant in den USA Zuflucht suchen. Mental gesehen war das Drehklima bei Werner Herzogs Fitzgeraldo ein Klosterschülerpensionat gegenüber dem bei The Wild Bunch. Nachgerade berüchtigt war Peckinpahs Null-Fehler-Toleranz. Die Launen des exzentrischen Regisseurs bekamen auch die Hauptdarsteller ab. Peckinpah wurde von Hauptdarsteller Holden mehrmals wegen seiner Behandlung der Crew zurechtgewiesen. Der (ungewöhnlich oppulenten) Trivia-Liste bei IMDb zufolge avancierte Holden während des Drehs mehr und mehr zum informellen Rudelführer – während der Regisseur sich um die Fertigstellung des Projekts im Allgemeinen kümmerte. Ein eher stressiger Teamplayer war schließlich auch Jaime Sánchez, Darsteller des Bandenmitglieds Angel. Der 30-Jährige hatte ein überdurchschnittliches Faible für die Bewaffnung am Set entwickelt. Nicht sonderlich zuträglich für die Arbeitsatmosphäre am Set: Sánchez’ Angewohnheit, mit dem Revolver scherzhalber auf andere Crew-Mitglieder zu zielen.
Gegenüber den Entscheidungsträgern verstieg sich Regisseur Peckinpah auf einen Mix aus Bluff, Vermeidung sowie dem Setzen vollendeter Tatsachen. Seinen Schnitt-Chef Joe Lombardo etwa imprägnierte er mit der Anweisung: „Zeigen Sie niemandem etwas, was Sie geschnitten haben, bis ich es sehe. Wenn Feldman [der Produzent] hereinkommt, ziehen Sie den Stecker an der Moviola.“ Am Ende nutzte das Lavieren wenig. Um zu heftige Kritik zu vermeiden, wurde der Film stark gekürzt – obwohl Peckinpah und sein Drehbuchschreiber Walon Green gegen nachträgliche Veränderungen Sturm liefen. Beide führten inhaltliche Gründe ins Feld: dass das Projekt einen realistischen Blick auf den alten Westen werfe und dass die Handlungen der alten Westerner auf der Leinwand selten mit ihrer gemeinen und niederträchtigen Realität übereinstimmten. Green: „Ich mochte Western immer. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie zu heroisch und zu glamourös waren. Ich hatte genug gelesen, um zu wissen, dass Billy the Kid Leuten in den Hinterkopf schoss, während sie Kaffee tranken.“
Die Kritiken waren – was zu erwarten war – widersprüchlich. Nichtsdestotrotz schlug sich die – letztlich vor allem im inhaltlichen Teil – zusammengekürzte Version von The Wild Bunch in den Kinos ganz leidlich. Und das im Anblick von beeindruckender Konkurrenz. Den größten Schatten wirft Sergio Leones oppulentes Racheepos Spiel mir das Lied vom Tod. Was rückblickend gesehen nichts weiter ist als ein weiterer Zufall: Leone nämlich wäre – nach seiner erfolgreichen Dollar-Trilogie – gern in die Verfilmung der Geschichte des amerikanischen Mobs eingestiegen. Die Studiobosse legten hier jedoch Veto ein und verdonnerten Leone – zunächst – zu einem weiteren Western. Spiel mit das Lied vom Tod gilt heutzutage zwar als der Fixstern des Sechzigerjahre-Westerns schlechthin. Das Rennen an der Kasse machte 1969 allerdings Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ein Western, der – vordergründig – eine weitere Bunch zum Thema hat, in Stil, Inszenierung und auch Tiefenwirkung jedoch nicht gegensätzlicher sein könnte. Während Peckinpahs Rohgestein in die Tiefen der schmutzigen Jahrhundertanfangs-Realität hinabstieg, kalauerten sich in der Konkurrenzproduktion drei hoffnungsfrohe Nachwuchsschauspieler(innen) durch zwei mit Belanglosigkeit angefüllte Stunden. Marke: romantisch bis zum Sonnenuntergang, inklusive einem lockerflockigen Popmusik-Motiv (dem von Burt Bacharach komponierten Raindrops Keep Feeling of my Heart).
Was die Wahrheit über den alten Westen anbelangt, haben es schließlich beide Produktionen nicht allzu eng genommen. „Wild Bunch“ hatte sich im Verlauf des Jahrhunderts als Fixbezeichnung etabliert für die (historisch verbürgte) Outlaw-Horde von Butch Cassidy und Sundance Kid – ebenjener Bande, die Regisseur George Roy Hill in seiner Konkurrenz-Filmproduktion verewigte. (Darüber hinaus wurde er auch auf die Dalton–Doolin-Bande in Oklahoma angewandt, deren erster Zweig Namensgeber war für die Gegenspieler eines Cowboys in einer populären französischen Comic-Reihe.) Um die Verwirrrung bezüglich Historientreue komplett zu machen: Auch die (echte) Wild Bunch war lediglich Teil einer größeren Formation – einem ganzen Netzwerk von Gesetzlosen, der sogenannten Hole-in-the-Wall-Gang. Die allerdings trieb nicht längs der mexikanischen Grenze ihr Unwesen, sondern ein paar tausend Meilen weiter nördlich: in den Prärien und Bergen von Wyoming.
Am Ende setzten sich Qualität und Aussagekraft doch durch. Als enfant terrible des härteren amerikanischen Films arbeitete sich Sam Peckinpah auch in den Folgejahren an einschlägiger Thematik ab – etwa in Getaway mit Steve McQueen (1972), Pat Garrett jagt Billy the Kid (1973) und, nunja, Steiner, das Eiserne Kreuz (1977). Die Problematik angemessener Alters-Gestaltung machte auch vor den involvierten Regisseuren und Schauspielern nicht halt. Sam Peckinpah starb 1984 im Alter von 59 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Drei Jahre zuvor war Hauptdarsteller William Holden verstorben, ein guter Freund des späteren US-Präsidenten Ronald Reagan und einer der prominentesten Unterstützer der Republikanischen Partei. Robert Ryan, bekannt geworden mit dem Kriegsfilm Das dreckige Dutzend, war bereits 1974 an Lungenkrebs dahingeschieden; die Rolle des Deke Thornton in The Wild Bunch war sein letzter Auftritt in der filmischen Premiumliga. Ernest Borgnine schließlich, eines der bekanntesten Nebendarsteller-Gesichter der Sechziger und Siebziger und in The Wild Bunch Pike Bishops treuer Adlatus Dutch Engstrom, ritt 2012 in die bessere Welt hoch oben über den Wolken ein – und war somit noch Partyteilnehmer beim 40. Anniversary 2009.
Fazit: A la longue hat sich The Wild Bunch als Spätwestern-Monolith in die Filmrezeption eingegraben. Seine Werkbeständigkeit ist ironischerweise wohl mit auf seine Nebenaussagen in Sachen Loyalität und Zukunftsplanung zurückzuführen. Bei aller extensiv dargestellten Gewalt ist die Zukunftssorge alternder Outlaws letztlich das Motiv, welches die Handlung des Films in Gang setzt. Am Ende schließlich steht keinesfalls jeder gegen jeden. Am Ende geht es Bishop und dem Rest seines verbliebenen Quartetts (doch) um etwas so Schnödes wie Integrität – eine Haltung, vor der schließlich auch die materiell bescheiden abgesicherte Zukunft als Söldner zurückzustehen hat. Sicherlich ist „Banken ausrauben wegen der Rente“ kein Motiv, dass der verrückteste unter den Regisseuren des New Hollywood neu erfunden hat. Der Verlauf dieses Spätwesterns zeigt allerdings, dass Geld am Ende doch nicht alles ist. Sowohl Bishop & Co. als auch ihr temporärer Gegenspieler Thornton verhalten sich zumindest am Ende besser als die Gesellschaft um sie herum. Eine Filmaussage, die bis auf den heutigen Tag nichts von ihrer Aussagekraft verloren hat.
The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz. Darsteller: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O’Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez und Ben Johnson. Regie: Sam Peckinpah. Erscheinungsjahr: 1969. 145 Minuten.

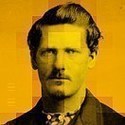




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.