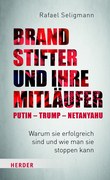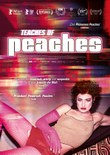Das Anliegen des Sammelbands ist im Titel genannt: Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) als sozialpolitische Antwort auf die Digitalisierung. Die in Deutschland wohl wichtigsten Aktivisten des BGE-Projekts, Ronald Blaschke und Werner Rätz, leiten das Buch ein beziehungsweise beschließen es. Rätz diagnostiziert am Ende, das Projekt sei in eine neue Phase eingetreten, nachdem sich jetzt auch Wirtschaftsbosse für ein GE aussprechen, so der Facebook-Chef Marc Zuckerberg oder in Deutschland Timotheus Höttges von der Telekom. Lange habe er, Rätz, es für im Kapitalismus unrealisierbar gehalten, jetzt aber komme Fahrt in die Debatte. Im Grunde hält er es weiterhin für unrealisierbar, denn ein BGE für alle, und das sogar weltweit – es wird inzwischen auch im Süden gefordert –, könne vom Kapital nicht integriert werden.
Der Kampf darum lohnt sich trotzdem oder gerade deshalb. Dabei geht es zuerst darum, den „emanzipatorischen“ Begriff eines Grundeinkommens vom neoliberalen abzugrenzen. Für die Neoliberalen, so Blaschke, ist das Grundeinkommen eine pure Geldzahlung, die die sozialpolitischen Systeme ersetzen soll. Timo Daum und Lisa Spelge stellen dar, wie diese Spielart schon von Milton Friedman, dem Ahnherrn des Neoliberalismus, ins Spiel gebracht worden war. Dagegen sind alle Autorinnen des vorliegenden Buchs einig, dass das Grundeinkommen die sozialpolitischen Systeme vielmehr ergänzen soll. Blaschke nennt den Grund: Zum „selbstbestimmten Leben, frei von materiell erpresster Unterordnung“, soll es dienen – und dieses Prinzip sei nicht an Geld gekoppelt.
Das ist der Ausgangspunkt, der in vielen weiteren Beiträgen vertieft wird. So stellt Margit Appel heraus, dass sogar Hartz IV, die böse Karikatur eines Grundeinkommens, angeblich der Existenzsicherung diene, in Wahrheit aber eine Investition ins Wirtschaftswachstum sei, weshalb der Fokus dieser „Leistung“ bekanntlich im Fordern, Fördern und Aktivieren liegt. Wie Appel gleichzeitig betont, erhöht das BGE „die Verhandlungsmacht von Frauen, sich weder den Arbeitsmärkten der digitalen Ökonomie noch den Festlegungen auf unbezahlte Sorgearbeit unterwerfen zu müssen“. Andere Autorinnen machen deutlich, dass die Verhandlungsmacht der ganzen Arbeiterinnenklasse erhöht werde, denn keine Frau, kein Mann müsste noch eine Arbeit annehmen, die ihr oder ihm nicht sinnvoll oder aus anderen Gründen nicht zumutbar erscheint.
Wenn auch IT-Manager heute für ein GE plädieren, dann weil sie wissen, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze vernichtet. Das könnte ja für Unruhen sorgen. Wolfgang Strengmann-Kuhn macht deutlich, dass nicht gleich Berufe, sondern zunächst nur Tätigkeiten überflüssig werden. Jedenfalls werde aber das Ende des „Normalarbeitsverhältnisses“ bewirkt und darauf sei das BGE die angemessene sozialpolitische Antwort. Andere Beiträge fragen, was Digitalisierung überhaupt ist. Laut Charly Hörster ist sie ein Beitrag zum Wissen nur dann, wenn die Menschen sich die Informationen, die das Internet bietet, auch selbstständig aneignen können. Sie müssten daher, statt nur aufzunehmen, auch eigene Fragen stellen können. Diese Fähigkeit wird heute vom Internet eher zerstört. Da reicht es nicht, wenn man Schulen mit den Geräten ausstattet. Hörster schlägt virtuelle Parlamente vor, zu denen Schülerinnen verschiedener Schulen im Netz zusammentreten können.
Das kleine Buch verdient weite Verbreitung.
Info
Digitalisierung? Grundeinkommen! Rätz, Paternoga, Reiners und Reipen (Hg.) mandelbaum 2019, 200 S., 14 €