Am 6. Juni 1950 hielt Martin Heidegger in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste seinen berühmten Vortrag "Das Ding". Da C. F. v. Weizsäcker erst am nächsten Tag anreisen konnte und Heidegger großen Wert auf seine Beurteilung des Vortrages legte, wurde verabredet, dass Heidegger im Hotelzimmer von Carl Friedrich seinen Vortrag wiederholen würde. Wie gesagt so getan.
Nach seinem Vortrag schaute Heidegger gespannt auf von Weizsäcker und sagte: "So, Herr Professor, was sagen Sie dazu?"
"Ach, mein lieber Heidegger, was könnte ich dazu sagen." Er schwieg eine Weile und schaute nachdenklich durch das Fenster. "Vielleicht folgendes: Als Mois (Freund Kumpel ...) morgens um acht Uhr durch die Stadt ging, kam er an einer Kneipe vorbei. Er schaute herein und sah an der Theke seinen besten Freund Sam mit einem großen Weißbier sitzen. Er schüttelte seinen Kopf und ging weiter. Als er zwei Stunden später zurückkam, sah er Sam noch immer mit einem Weißbier an der Theke sitzen. Nach dem Mittagessen hatte er wieder etwas in der Stadt zu erledigen. Er ging wieder an der Kneipe vorbei und Sam war noch immer da. Und auch als Mois wieder nach Hause ging, saß Sam noch immer an einem Weißbier. Jetzt reichte es ihm und er trat in der Kneipe ein. Er setzte sich neben Sam.
´Sam, warum sitzt Du den ganzen Tag mit Weißbier in der Kneipe? Was ist los?´
´Meine Frau.´
´Was ist mit deiner Frau, ist sie krank?´
´Nein. Sie redet.´
´Sam, geh nach Haus zu deiner Frau.´
´Aber sie redet und sie redet.´
´Es ist doch nicht schlimm, dass sie redet.´
´Es ist schrecklich: sie redet und sie redet und sie sagt ja nichts!´"
Als von Weizsäcker Martin Heidegger dann anschaute, lachte dieser auf. Es ist bezeichnend für Heideggers Charakter, dass er diese Anekdote gerne immer wieder weitererzählt hat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt". (Wittgenstein)
Zumindest auf der Ebene des sprachlich vermittelbaren. Das beinhaltet nicht zwingend, dass es darüber hinaus nicht noch andere Kategorien gibt.
Entnommen: "Philosophischer Wegweiser" Verlag Karl Alber, Herausgeber Lukas Trabert
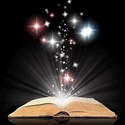




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.