Eines der Bücher, an denen mir am meisten liegt, sind die Selbstbetrachtungen Marc Aurels. Ich besitze mehrere Ausgaben des Werkes, die das Herz des Bibliophilen mit je eigenen Mitteln höher schlagen lassen. Manche verfügen über ein besonders hübsches Cover, andere bieten Lesebändchen, hochwertiges Papier oder einen sorgfältig zusammengestellten Anmerkungsapparat. Ich muss zugeben, dass dies alles erheblich zur Steigerung meines Lesegenusses beiträgt. Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass ich mir kaum vorstellen könnte, mit dem Werk anders als in eben dieser Form in Beziehung zu treten. Würde nicht ein nachlässig gestalteter äußerer Rahmen auch das geistige Produkt selbst in den Schmutz ziehen?
Dabei sind die Selbstbetrachtungen natürlich auch im Internet frei zugänglich. Und – auch dies muss ich zugeben – gerade in diesem Fall gibt es gewichtige Argumente, die für die elektronische Lektüre sprechen. Da ist zum einen und vor allem die Tatsache, dass die Buchform gerade bei diesem Werk im Grunde eine dreiste Lüge darstellt. Denn Marc Aurel hat die Selbstbetrachtungen ja keineswegs als einheitliche Schrift konzipiert. Vielmehr sind die einzelnen Aphorismen, aus denen das Werk besteht, erst Jahrhunderte nach seinem Tod in der Form angeordnet worden, in der wir sie heute zu rezipieren gewohnt sind.
Hinzu kommt, dass die einzelnen Sprüche und Gedankensplitter in der Art eines Selbstgesprächs angelegt sind – als "Selbstbetrachtung" in dem Sinne, dass sich hier jemand immer wieder dieselben oder ähnliche Gedanken vorlegt, um sie im Lichte neuer Erkenntnisse oder Zusammenhänge zu überprüfen und sich so ihrer Wahrheit zu vergewissern. Will man das Beziehungsgeflecht, das sich zwischen den diversen gedanklichen Ansätzen entspinnt, besser verstehen, ist es hilfreich, die Selbstbetrachtungen nach Stichworten zu durchforsten. Hier ist die elektronische Ausgabe der Buchform natürlich weit überlegen.
Schließlich konnte Marc Aurel – als Kaiser, der ein Weltreich zu regieren und dessen Verteidigung zu organisieren hatte – auch keine grundlegend neuen philosophischen Konzepte entwickeln. Vielmehr sind die Aphorismen im Wesentlichen als sprachlich-gedankliche Aneignung und Weiterentwicklung der theoretischen Ansätze anderer, von ihm geschätzter Philosophen zu verstehen. Es ist in diesem Fall daher besonderes hilfreich, sich auf einen guten Anmerkungsapparat stützen zu können. Auch hier spricht Vieles für die elektronische Ausgabe, die einem lästiges Hin- und Herblättern erspart und zudem per Hyperlink die direkte Weiterleitung zu anderen, für die Entstehung der Selbstbetrachtungen bedeutsamen Werken ermöglicht.
In der Summe ergibt sich so die paradoxe Erkenntnis, dass gerade bei diesem altehrwürdigen Werk, das in unserer Vorstellung fest mit der Buchform verbunden ist – die freilich zur Zeit seiner Entstehung noch gar nicht existierte –, die elektronische Variante die angemessenere äußere Form zu sein scheint. Dies führt unweigerlich zu der Frage, warum ich und mit mir so viele andere dennoch der Buchausgabe den Vorzug geben.
Am wichtigsten erscheint mir hier zunächst der Aspekt der geistigen Initiation. Diejenigen, die ihre ersten geistigen Erweckungserlebnisse mit der Buchform verbinden, assoziieren dadurch offenbar auch die entsprechenden Inhalte mit dem Medium, durch das diese ihnen vermittelt worden sind. Das Buch ist dadurch für die Älteren unter uns weit mehr als das, was es de facto darstellt: ein Trägermedium für die Materialisierung und Verbreitung geistiger Inhalte.
Hinzu kommt, dass die assoziative Verknüpfung von Buch und Geist bei uns schon eine jahrhundertealte Tradition hat – und dadurch fest in unserem kollektiven Gedächtnis verankert ist. Die individuelle Erfahrung wird so verstärkt durch kulturelle Leitbilder wie das des in ein Buch versunkenen Mönches oder das des Zauberers, der aus einem geheimnisvollen Kodex weltverändernde Formeln herausliest.
Diese Bilder und Erfahrungen führen dazu, dass das Buch für uns nicht einfach nur ein positiv besetztes Medium ist. Vielmehr behandeln wir es in vielen Zusammenhängen wie einen Fetisch. Am deutlichsten wird dies im Bereich der Religion, wo das Buch, das den Geist des Göttlichen an die Gläubigen vermittelt, selbst als heilig gilt und entsprechend aufbewahrt und behandelt wird – als würden sich seine Seiten auf wundersame Weise mit der heiligen Aura tränken, die wir mit den in ihm aufgezeichneten Inhalten verbinden.
Dies alles hat zur Folge, dass wir ein geistiges Produkt stärker wertschätzen, wenn es uns in Buchform begegnet – und zwar umso mehr, je aufwändiger diese gestaltet ist. Ein bisschen ist das wie in der Schule. Der Schüler, der seinen Aufsatz in krakeliger Handschrift verfasst, erhält im Zweifelsfall eine schlechtere Note als der, der seine Ergüsse in Schönschrift abgibt – selbst wenn der Inhalt das Gegenteil nahe legen würde.
Das Internet gleicht in dieser Hinsicht einem Lehrer, der alle Aufsätze zunächst abtippt oder noch besser abtippen lässt, um sie objektiv beurteilen zu können. Es gleicht die äußeren Formen einander an und macht die jeweiligen Inhalte so besser vergleichbar. Zwar treten sie uns auch hier nicht 'nackt' gegenüber, da bei der elektronischen Texterstellung verschiedene Schrifttypen, eine ansprechende Hintergrundgestaltung, eingestreute Bilder und vieles mehr das geistige Produkt aufwerten können. Dies gilt dann jedoch für alle Texte gleichermaßen und lässt sich bei Bedarf zudem leicht durch eine Umwandlung in schmucklos-nüchterne Formen ausschalten.
Dennoch – bei manchen geistigen Produkten ist man geneigt zu sagen: gerade deswegen – ist unsere Neigung zur Fetischisierung des Buches bis heute ungebrochen. Gleichzeitig hat allerdings die Umsonst-Kultur des Internets dazu geführt, dass die Bereitschaft, Geld für geistige Inhalte auszugeben, stark abgenommen hat. In Verbindung mit der Shareholder-Mentalität, die längst auch in der Buchhandelsbranche Einzug gehalten hat, führt dies zu einem starken Kostendruck bei der Buchherstellung.
Diesem Einsparungszwang tragen die Verlage zum einen dadurch Rechnung, dass sie die Bücher in Ländern mit geringen Produktions- und Arbeitskosten drucken lassen. Zum anderen werden Bücher nur noch dann gedruckt, wenn sie in hohen, kostensparenden Auflagen hergestellt werden können. Damit dies gewährleistet ist, werden Manuskripte nicht mehr in Abhängigkeit von ihrer Qualität in Buchform gebracht, sondern auf der Grundlage einer zielgruppenorientierten Marktanalyse. Flankiert wird dies alles natürlich von einem entsprechenden Marketing, das von der Pressearbeit bis zur passgenauen Werbung und Autorenpräsentation nichts dem Zufall überlässt.
Für die Literatur heißt das beispielsweise, dass komplexe oder kontemplativere Arbeiten keine Chance mehr auf eine Veröffentlichung haben. Denn Werke, die weder leicht konsumierbar noch in eventartigen Autorenlesungen anzupreisen sind, passen nicht zu den marktschreierischen Verkaufsstrategien der Branche.
Abhilfe verspricht hier ausgerechnet jenes Medium, das diesen Trend wenn nicht ausgelöst, so doch entscheidend verstärkt hat: das Internet. Hier gibt es keinen Lektor, der die Zielgruppenaffinität des Manuskriptes überprüft, keine Marketingabteilung, die jedes Werk durch die Brille von Bilanzen und Marktanalysen betrachtet. Hier kann jeder veröffentlichen, was er will – sofern er oder sie nicht gerade in einer jener 'gelenkten Demokratien' lebt, die im Zuge der geistigen Einzäunung ihrer Bürger zunehmend auch der im Kern anarchischen Freiheit des Internets Grenzen setzen.
Auch auf der formalen Ebene bietet die elektronische Veröffentlichungsform gegenüber der Buchvariante eine Reihe von Vorteilen. So kann man hier die Schriftart und -größe je nach den eigenen Bedürfnissen verändern. Ein E-Book – in das sich jedes Tablet mittels einer App verwandeln lässt – bietet zudem die Möglichkeit einer Anpassung an die Umgebungsbeleuchtung. Lästige Lichtreflexe auf glänzendem Papier oder die Notwendigkeit, die Buchseiten auseinanderzudrücken und dabei das Buch zu beschädigen, entfallen hierdurch. Auch in dieser Hinsicht kann die elektronische Veröffentlichungsform also die Nachteile der heute oft minderwertigen, weil kostensparend hergestellten Buchvariante mehr als ausgleichen.
Allerdings stellt sich die Frage, ob die Umgebung, in der das geistige Produkt veröffentlicht wird, nicht auf dieses selbst abfärbt – ob also das Internet seiner Struktur nach inkompatibel ist mit bestimmten geistigen Inhalten. Ich denke hierbei an Neil Postman, der in den 1980er Jahren seine radikale Fernsehkritik auf dem – Marschall McLuhan entlehnten – Satz aufbaute: "Das Medium ist die Botschaft" (Neil Postman: Wir amüsieren uns zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie, S. 17. Frankfurt/Main 1987: Fischer; engl. 1985).
Um seine These zu illustrieren, problematisierte Postman u.a. unser alltägliches – im Radio sogar allstündliches – Nachrichtenritual. Dieses setze sich, so Postman, aus "Bruchstücken" zusammen, "weil wir über eine Vielzahl von Medien verfügen, die sich ihrer Form nach zum Austausch bruchstückhafter Botschaften eignen" (ebd.). Erschwerend kommt hinzu, dass bei einer solchen Präsentationsform der Wert der einzelnen Information von der Bedeutung des Vermittlungsakts überlagert wird. Wichtig ist nicht die Information selbst, sondern die beruhigende Wirkung, die von dem regelmäßigen, von Wetterbericht und Verkehrsnachrichten gekrönten Muezzin-Ruf der Nachrichtensprecher ausgeht: Alles bleibt, wie es ist – mach' auch du so weiter wie bisher!
Ein wichtiger Aspekt der damaligen Fernsehkritik war auch, dass in einem Umfeld, in dem hirnerweichende Shows auf die Katastrophenbilanzen der Nachrichten folgen, denen möglichst noch ein gepflegter Krimi vorausgeht, die Vermittlung ernsthafter Informationen nicht möglich sei. Postmans Schlussfolgerung, wir würden uns "zu Tode amüsieren", also unser geistiges Ertrinken im Meer der Unterhaltung und damit das Ende des Projekts der Aufklärung sozusagen lachend hinnehmen, findet denn auch ihre Entsprechung in dem Begriff 'Infotainment', der ja keineswegs rein negativ konnotiert ist.
Nun ließe sich einwenden, dass diese Argumentation in der damaligen Zeit, als die Zuschauer den Programmschemata der einzelnen Fernsehanstalten noch mehr oder weniger hilflos ausgeliefert waren, eher eingeleuchtet hat als heute. Schließlich kann man mittlerweile ja online aus einem breiten Angebot verschiedenster Sendungen auswählen und so zu seinem eigenen Programmgestalter werden. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Denn erstens ist das Internet ein noch größerer Gemischtwarenladen als das Fernsehen, und zweitens zielt es – eben weil es einem nicht mehr ein bestimmtes Programmschema mit obligatorischen Werbeblöcken aufzwingen kann – noch stärker darauf ab, die Nutzer ab- und zu kostenpflichtigen Angeboten hinzulenken.
Wer längere Zeit im Internet surft, wird so leicht von einer gewissen Unruhe und Ungeduld befallen. Man klickt sich durch die einzelnen Webseiten, wie man sich früher durch die Programme gezappt hat, bis im Gehirn nur noch ein Haufen unzusammenhängender Informationsfragmente und Gedankensplitter zurückbleibt, ein Polterabend des Geistes. Wenn wir es aber noch nicht einmal schaffen, uns bei Suchanfragen über die dritte Seite hinauszuklicken – wie sollen wir dann im Internet komplexe geistige Inhalte aufnehmen können?
Gegenfrage: Müssen wir das überhaupt tun? Nur weil geistige Produkte im Internet veröffentlicht werden, müssen sie dort doch noch lange nicht produziert und rezipiert werden. Wer Ersteres tut, läuft Gefahr, in der Vielstimmigkeit des Netzes die eigene Stimme und damit seine geistige Autonomie zu verlieren. Wer Letzteres tut, liefert sich den Sirenenrufen der Internetökonomie aus und erschwert sich damit jene kontemplative Haltung einem geistigen Werk gegenüber, wie wir sie in unseren Idealbildern lesender Menschen verklären. Letztlich ist das Internet doch nur ein Bote, in dessen Gegenwart ich mich ebensowenig in ein geistiges Produkt versenken muss wie in Anwesenheit eines Briefträgers, der mir ein bestelltes Buch nach Hause bringt.
So erscheint es mir selbst bei einem Internet-affinen Werk wie den Selbstbetrachtungen sinnvoll, sich ihm zunächst in der klösterlichen Variante der stillen, ungestörten – und sei es auch elektronischen – Lektüre zu nähern. Erst in einem zweiten Schritt, wenn man durch den direkten Dialog mit den Gedanken des Autors bereits eine eigene Vorstellung von dessen geistiger Welt hat, kann für eine vertiefende Auseinandersetzung die Internetvariante herangezogen werden.
Dem individuellen könnte hier auch ein kollektiver Entwicklungsprozess entsprechen. Solange die anarchische Freiheit des Internets zugleich bedeutet, dass wir dessen für uns unkontrollierbarer Eigendynamik ausgeliefert sind, werden wir geistige Mittler brauchen, die uns zu jenen Inhalten führen, die vielleicht auf unserem Weg liegen, für uns im Dickicht des Netzes aber unauffindbar bleiben. Hier kann wiederum das Buch als geistiger Entwicklungshelfer für eine mündige Netz-Identität fungieren – das Buch, zu dem mir durch die persönliche Beratung in Buchhandlungen oder Bibliotheken der Weg geebnet wird. Eine solche mäeutische Funktion kann der Buchhändler ebenso wie die Bibliothekarin allerdings nur dann erfüllen, wenn es ihnen gelingt, sich von dem geistigen Diktat der großen Verlage und Zwischenhändler zu emanzipieren. Mit anderen Worten: Wer heute als Buchmakler fungiert, muss der Logik des Marktes die je eigene Logik von Schreibenden und Lesenden entgegensetzen, die durch seine Vermittlung zueinanderfinden.
Buch- und elektronische Veröffentlichungsform müssen also nicht notwendig in Konkurrenz zueinander stehen, sondern können sich auch gegenseitig ergänzen. Neutral betrachtet, handelt es sich ja auch bei beiden nur um unterschiedliche Medien für die Verbreitung geistiger Inhalte. Dabei bietet allerdings gerade die Publikation im Internet gegenüber der Buchform eine Reihe von Vorteilen. Sie ist nicht nur ressourcenschonender, sondern ermöglicht auch eine schnellere, einfachere und direktere Vermittlung zwischen Schreibenden und Lesenden. Hinzu kommt, dass Letztere im Netz eine größere Autonomie im Umgang mit den jeweiligen Texten erhalten. Indem sie diese ihren Lesebedürfnissen anpassen können, entspricht der geistigen hier von Anfang an auch eine materielle Aneignung, die – weil sie individuellere Konturen hat – Erstere eher unterstützen kann als die für alle gleiche Buchform.
Zu bedenken ist schließlich auch, dass ein im Internet veröffentlichter Text stets unfertiger, weniger abgeschlossen erscheint als ein in Buchform vorliegendes geistiges Produkt. Während das Buch mit dem Odium einer eigenen geistigen Welt behaftet ist, in die uns der Autor-Demiurg einführt, sehen wir in einem Internet-Text eher ein Fragment, einen kleinen Schnipsel im großen Kaleidoskop des geistigen Kosmos.
Rein philosophisch betrachtet, bildet damit das Internet die Wahrheit des Geistes, der dem tendenziell chaotischen Sein in einem unabschließbaren Prozess Formen abzuringen versucht, besser ab als das Buch. In diesem erhöht sich der Autor zum Genius, während er im Internet das gebrochene, kaum hörbare Stimmchen bleibt, das er in Wahrheit ist. Kurzfristig mag das unsere Neigung zur Fetischisierung des Buches sogar noch erhöhen. Langfristig dürfte das Internet in dieser Hinsicht jedoch ein Gegenmittel darstellen, dessen Wirkung wir uns kaum werden entziehen können.
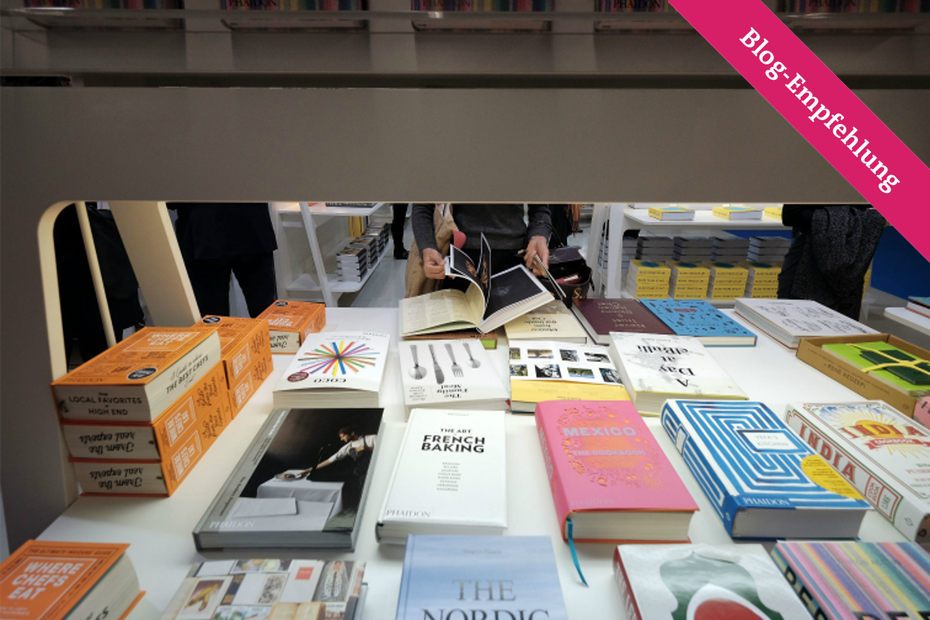





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.