30 Jahre nach dem Mauerfall in Berlin und dem darauf folgenden Zerfall der sogenannt real-sozialistischen Regime in Mittel- und Osteuropa, der schliesslich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion endete, wird gerne davon gesprochen, damals habe es sich um eine ‹Revolution› gehandelt. Tatsächlich konnten durch den Umsturz mehr oder weniger gute Bedingungen für die Entwicklung von Demokratie geschaffen werden. Zugleich ging aber das ‹Volkseigentum›, das im vermeintlich realen Sozialismus unter Kontrolle des Staates bzw. der Staatspartei stand, sehr schnell in die Hände Privater über. Auf diese Weise ergaben sich wieder ‹normale› kapitalistische Verhältnisse. Der Preis für wirtschaftliche Verbesserungen besteht allerdings in wachsender sozialer Ungleichheit, die einen zunehmenden Populismus nährt.
Wir sehen uns heute mit einer Inflation des Begriffes ‹Revolution› konfrontiert: Die Warenwelt produziert ‹Revolutionäres› am laufenden Band. Dagegen erzeugen Revolutionen, die diese Bezeichnung wirklich verdienen, eher Unverständnis. Und noch viel mehr: Sie werden mit einem Bann belegt, der Namen wie ‹diktatorisch› oder gar ‹totalitär› trägt. Das, was an ihnen einst emanzipatorisch, befreiend war, gerinnt zu einer Geschichte von Gewalt und Verbrechen. Oder wie Alain Badiou schreibt: «Der Tod einer Revolution wird durch gekonnte Verleumdung erreicht.»
Egalitäre Herrschaft schaffen
Der französische Philosoph versteht unter dem Wort ‹Revolution› den «Anfang oder Neubeginn der Geschichte der menschlichen Art». Diese menschliche Spezies wird von einer biologischen Basis bestimmt, auf der wir alle gleich sind. Badiou nennt dies den «unzweifelhaften Sockel, den die Identität der Menschheit als solche bildet». Die neolithische Revolution vor ungefähr 15‘000 bis 5‘000 Jahren schuf die Voraussetzungen für eine sesshafte Landwirtschaft, die Nahrungsmittelüberschüsse ermöglichte – und mit diesen Überschüssen die Existenz einer Klasse von Menschen, die sich nicht mehr direkt an der Produktion beteiligen mussten. Dies war auch die Voraussetzung für die Existenz eines Staates, mit dessen Hilfe sich eine Klasse gegenüber den anderen erhebt. Damit wurde aber die Gleichheit des Menschengeschlechts grundlegend in Frage gestellt. Hier lag zudem der «Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats», wie Friedrich Engels seine 1884 erstmals erschienene Schrift über das Entstehen der Klassengesellschaft nannte. Badiou erklärt, dass wir immer noch innerhalb der «Parameter» leben, die vor vielen tausend Jahren eingeführt wurden.
Jetzt wäre es an der Zeit, das Neolithikum hinter uns zu lassen und eine ihrer biologischen Basis entsprechende egalitäre Herrschaft der menschlichen Spezies zu errichten, ist Alain Badiou überzeugt. Im «Kielwasser» der französischen Revolution» von 1789 wollte die russische Revolution von 1917 genau diese Herrschaft schaffen, glaubt der Philosoph. Seine Position widerspricht der heute gängigen Erzählung. Wer aber beispielsweise das Buch der des Dogmatismus unverdächtigen Autorin Bini Adamczak Beziehungsweise Revolution liest, wird feststellen, dass es in Russland tatsächlich ein «Begehren nach Revolution» gab, das weit über die Kreise der bolschewistischen Partei hinausreichte.
Postneolithische Politik
Alain Badiou geht sogar so weit, den roten Oktober 1917 als «erste[n] Sieg einer postneolithischen Revolution in der gesamten Menschheitsgeschichte» zu bezeichnen – durchaus im Wissen um die im nachfolgenden Bürgerkrieg freigesetzte Gewalt und die von einem kranken Lenin geäusserte tiefe Besorgnis, dass sich die sowjetische Staatsbürokratie zu einer Macht über die Arbeiterklasse und alle Werktätigen erheben könnte; was ja dann auch geschah und von Stalin abgesegnet wurde.
Um genauer zu bestimmen, was eine «postneolithische Revolution» bedeuten könnte, analysiert der Autor Lenins Thesen vom April 1917, nach dem Sturz des zaristischen Regimes durch eine Massenbewegung. Es sei Lenin um den Ausstieg aus einer Politik gegangen, deren Zentrum der Staat ist, hin zu einer Politik, in der das Wort ‹Macht› die «egalitäre Aktion der Volksmassen und ihrer Organisationen bezeichnet». Ziel sei eine Revolution gewesen, «die sich zur Gründung einer neuen Moderne hin öffnet». Die Geschichte verlief dann allerdings anders: Partei und Staat behaupteten, die Arbeiterklasse und alle Werktätigen zu repräsentieren, so dass für deren eigenständige politische Betätigung keine Notwendigkeit mehr zu bestehen schien. Der Weg für eine Fortsetzung der «postneolithischen Revolution» wurde damit verbaut und Russland kehrte zum «neolithischen Konsens» (Badiou) zurück.
Erfahrungen der Kulturrevolution
Die chinesische Kulturrevolution der 1960er Jahre war ein weiterer Versuch, eine egalitäre Politik zu etablieren – und sie scheiterte wie die russische Revolution rund ein halbes Jahrhundert zuvor. Badiou zieht die Schlussfolgerung, dass es sich damals «als unmöglich erwiesen hatte, die politische Neuerung im Rahmen der Staatspartei zu entfalten». Formal war China zu jener Zeit ein ‹proletarischer› Staat, doch Mao Zedong hatte bereits vor dem Beginn der Kulturrevolution davor gewarnt, die Bourgeoisie könne innerhalb der kommunistischen Partei die Macht übernehmen und so dafür sorgen, dass das Land die Farbe wechsle. Wer heute die Politik der chinesischen KP verfolgt, muss zum Schluss kommen, dass Maos Warnung zur Wirklichkeit geworden ist.
Badiou meint, wir sollten die Erfahrungen der Kulturrevolution studieren, um aus ihren Stärken wie ihren Schwächen zu lernen. Auf der Grundlage dieser Auseinandersetzung wird es möglich sein, eine neue Politik zu praktizieren, die auf die Emanzipation des Menschengeschlechts zielt. Badious Buch liefert dafür wichtige Hinweise.
Alain Badiou: Petrograd und Schanghai. Die zwei Revolutionen des 20. Jahrhunderts. Aus dem Französischen von Brita Pohl. Wien: Verlag Turia + Kant 2019, 128 Seiten
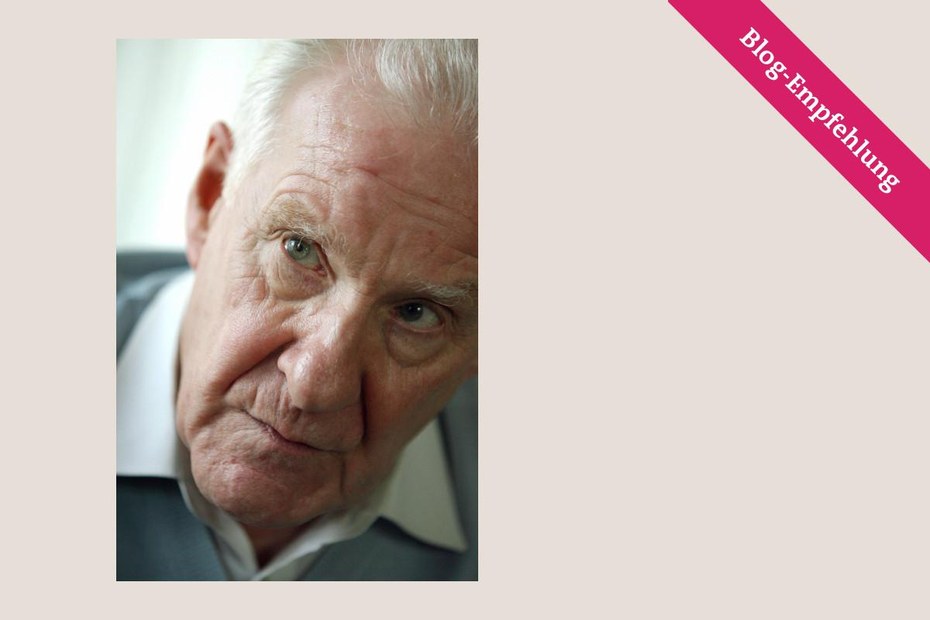





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.