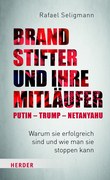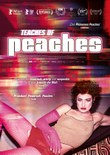Im weltweiten Kampf gegen den IS und andere militante religiöse Extremisten wird oft die psychologische Wirkung von Sieg und Niederlage übersehen. Seit der arabischen Herrschaft in Andalusien, die im 15. Jahrhundert zu Ende ging, mussten die Anhänger des Islam eine historische Niederlage nach der anderen hinnehmen. Die letzte große bestand in der Auflösung des 600 Jahre währenden Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg. In der jüngeren Geschichte mussten sich Araber im Konflikt mit Israel geschlagen geben und erfahren, wie Palästina unter israelische Militärhoheit gestellt wurde. Syrien, Ägypten und Jordanien verloren 1967 im Sechs-Tage-Krieg eigenes Territorium, und der Irak wurde zweimal durch eine von den USA geführte Allianz geschlagen, zu der auch arabische Alliierte gehörten.
Die IS-Ideologie verspricht jungen Muslimen, sobald ein Kalifat errichtet sei, kehre ein Goldenes Zeitalter zurück, das sie wieder zu Siegern erhebe. Ein Zusammenbruch des Daesh im Irak oder in Syrien wäre daher auf zwei Ebenen von Bedeutung. Auf operationell-militärischer würde dies dem IS die physische Kontrolle über eine Region und damit die Möglichkeit entziehen, dort Truppen auszubilden. Auf psychologischer Ebene wäre die Niederlage einer obskuren, menschenverachtenden Ideologie besiegelt und das jungen Arabern gegebene Heilsversprechen gebrochen.
Wenn es dazu kommt, sollten die Konsequenzen nicht allein den Militärstrategen und Politikern des Westens überlassen werden. Es bedeutet einen großen Unterschied, wer einen solchen Triumph für sich reklamiert und wem er tatsächlich zuzuschreiben ist. Um von Dauer zu sein, müsste ein solcher Umschwung vor allem mit einer glaubwürdigen Alternative einhergehen, die ungeduldigen jungen Männern, die sich so sehr danach sehnen, endlich einmal unter den Gewinnern zu sein, eine Perspektive eröffnet.
Mindestens ebenso essenziell ist die Frage, wer nach einem Sieg über den IS das ideologische Vakuum füllt, das dieser zwangsläufig hinterlässt. Als zehntausende junger Araber Ende 2010 und Anfang 2011 auf den Straßen von Tunis, Kairo oder Alexandria demonstrierten, glaubten viele von ihnen, die Geburtsstunde arabischer Demokratien sei nahe. Leider waren die Agenten des Wandels organisatorisch und von ihrem politischen Potenzial her nicht in der Lage, das Vakuum zu füllen, das durch die Flucht von Staatschef Ben Ali in Tunesien und durch die Verhaftung des Präsidenten Hosni Mubarak in Ägypten entstand.
Best-Case-Szenario
Ironischerweise haben die Stärke und kurzzeitigen Siege des Daesh wie ähnlicher Gruppierungen zu einer neuen radikalen und säkularen Bewegung geführt, die sich im Nahen und Mittleren Osten wie in Nordafrika formiert und ihre Debatten hauptsächlich in den sozialen Medien führt. Doch wie die Protagonisten des sogenannten Arabischen Frühlings haben auch sie kaum eine Chance, jenes Vakuum zu füllen, das eines Tages der IS hinterlassen könnte.
Was jetzt gebraucht wird, ist eine neue Partnerschaft zwischen moderaten politischen Akteuren in der arabischen Welt, Bürgerrechtsaktivisten und säkularen Strömungen. Voraussetzungen einer solchen Entente cordiale wären gegenseitiger Respekt und ein Ende der Rivalitäten. Daraus ergäbe sich die allein denkbare Alternative zum gewalttätigen Extremismus, basierend auf Gewaltenteilung, Inklusivität und Pluralismus. Die Raison d’Être dieser neuen Partnerschaft muss darin bestehen, demokratische Prinzipien und die Trennung von Staat und Religion zu wollen, wozu der Beistand moderater religiöser Kräfte unverzichtbar wäre, die freilich mehr von einem evolutionären statt revolutionären Wandel halten.
Auch das reicht immer noch nicht. Dem Herzen Nahrung zu geben und gleichzeitig den Körper darben zu lassen, wird die Probleme nur aufschieben, ohne sie wirklich zu lösen. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis die Konflikte erneut hervorbrechen. Es braucht schon einen „Arabischen Marshallplan“, um die gewaltige Arbeitslosigkeit unter den 20- bis 35-Jährigen einzudämmen. Das mag idealistisch klingen und ist für den Westen gewiss nichts Neues. Schließlich hat man sich dieser Realität ein ums andere Mal verweigert und stattdessen lieber das Arrangement mit autokratischen Regimes gesucht, weil kurzfristige Interessen bedient wurden. Die größte Gefahr in den kommenden Jahren besteht darin, dass der Westen seine Aufmerksamkeit wieder egoistisch auf sich selbst richtet. Nur zeigen nicht die jüngsten Anschläge in den USA, Frankreich und Deutschland, dass Isolationismus nichts gegen grenzüberschreitende Konflikte auszurichten vermag?
Beim Sieg über Daesh ist es wichtig, wer die Lorbeeren einstreicht. Das Best-Case-Szenario bestünde in einer inklusiven Regierungsstruktur, die allen Mitbestimmung gewährt, dem Nahen Osten eine bessere Zukunft ermöglicht und Rückfälle in die Barbarei des Fanatismus verhindert.