Tote Soldaten auf dem Schlachtfeld von Gettysburg, Juli 1863. Foto: Timothy O’Sullivan
Soll man Kriegsbilder zeigen, abdrucken, versenden? Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine kommt diese Frage wieder öfter zur Sprache. Eine kleine Auslese: entsprechende Beiträge in der Süddeutschen, auf dem Medienportal meedia, bei der Augsburger Allgemeine, auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung oder eben im Freitag. Auffällig an der Bilderkontroverse ’22 ist, dass sie fast ausschließlich von ethischen Erwägungen bestimmt wird – konkret: der Frage, wie viel den nachrichtenkonsumierenden Zuschauer(innen) darstellungstechnisch zuzumuten sei. Die historische Handhabung dieser Problematik – und deren jeweilige Folgen – ist hingegen eher selten Thema. Dabei wäre ein Vergleich hier höchst aufschlussreich. Von der im Embedded-Modus produzierten, explizite Bilder strikt vermeidenden Kriegsberichterstattung der letzten Jahrzehnte über Fotos vom Vietnamkrieg und der Landung in der Normandie bis hin zu den Abbildungen, welche uns das vorletzte Jahrhundert hinterlassen hat, sind Zeiten, ihre Akteure und ihr Publikum höchst unterschiedlich mit dem fotografischen Material umgegangen – praktisch, moralisch und auch auswirkungstechnisch.
Zur Mutter der Kriegsfotografie avancierte ein Großereignis in der Mitte des 19. Jahrhunderts – der amerikanische Bürgerkrieg. Vorhersehbar war die zündkräftige Dynamik aus Großereignis und (noch) junger Technik nicht. Zum einen war die Technik, mit der Unions- wie Konföderations-Fotografen – erstere in beeindruckender, letztere in eher spärlicher Anzahl – an die Front zogen, zu dem Zeitpunkt gerade einmal ein Vierteljahrhundert alt. Zum zweiten gestaltete sich die Handhabung am »Set« höchst ambitiös und sperrig. Das um die Jahrhundertmitte aufgekommene Nassplatte-Verfahren hatte die technischen Möglichkeiten zwar deutlich ausgeweitet. So hatten sich die erforderlichen Belichtungszeiten zwischenzeitlich auf ein handhabbares Minimum von wenigen Sekunden reduziert. Stärker noch wog, dass sich die neuen Bilder vervielfältigen ließen – anders als bei dem schon damals als überholt geltenden Daguerrotypie-Verfahren, wo stets Unikate das Ergebnis einer Foto-Session waren. Der Stand so: Bewegte Szenen lagen zwar noch in weiter Ferne, Außenaufnahmen waren jedoch durchaus drin. Und wurden bald in extensiver Weise praktiziert – vor allem von den Fotoberichterstattern der Union.
Mathew Brady
Der Bekannteste von ihnen ist wohl der New Yorker Mathew Brady. Bradys Bemühungen, das Großereignis seiner Zeit in einer ebenso groß angelegten Kollektion dokumentarischer Fotos festzuhalten, waren zumindest auf lange Sicht so erfolgreich, dass Fotokundige die Bürgerkriegsfotografie heutzutage fast automatisch mit seinem Namen verbinden. Ganz gerecht ist das nicht. Weniger deswegen, weil die Union auch ohne Brady über einen wohlausgestatteten Berichterstattungs-Service verfügte. Sondern vielmehr wegen der Tatsache, dass unter Bradys Ägide zeitweise rund zwei Dutzend Vor-Ort-Fotografen tätig waren. In Sachen Fotografie war der Abkömmling irischer Immigranten bereits vor dem Krieg ein Altgedienter. Auf (zahlkräftige) Prominenz versiert, rückte er seit den späten 1840ern allerlei Persönlichkeiten ins fotografisch optimale Licht – darunter den ein Jahr nach seinem Amtantritt verstorbenen Präsidenten Zachary Taylor. Später fotografierte Brady auch Lincoln – wobei angemerkt werden sollte, dass einige der zeitüberdauerndsten Lincoln-Portraits nicht von Brady selbst stammen, sondern einem seiner Angestellten: Alexander Gardner.
»Ich musste gehen. Ein Geist in meinen Füßen sagte ›Geh!‹, und ich ging.« Ob Brady als Geschäftsmann dachte, der ein wohlkalkuliertes, wenngleich auch risikoreiches Wagnis einging, oder als Besessener, der letztlich nicht anders konnte, bleibt bis heute Auslegungssache. Fakt ist, dass Brady sich für sein Unternehmen hoch verschuldete; den 10.000 Fotografien, die er und seine Angestellten produzierten, standen Auslagen von rund 100.000 US-Dollar entgegen. Das dicke Ende kam nach dem Krieg. Als Geschäftsmann, der auch über einige Verbindungen verfügte, hatte Brady darauf spekuliert, dass der US-Kongress ihm seine Sammlung abkaufen würde. Der verhielt sich allerdings zögerlich oder hatte, netter formuliert, Wichtigeres zu tun. Die Folge: Brady mußte Konkurs anmelden und verkaufte sein Unternehmen. 1875 schließlich lenkte der Kongress ein und bot ihm 25.000 Dollar für seine Sammlung – ein Tropfen auf den heißen Stein und viel zu wenig, um Brady als Geschäftsmann und Fotograf zu rehabilitieren. Tief verbittert und als Alkoholiker verstarb der spiritus rector der Bürgerkriegsfotografie 1896 nach einem Unfall in der Armenstation eines New Yorker Krankenhauses. Sein Begräbnis finanzierte am Ende nicht eine dankbare Legislative, sondern Veteranen des 7. New Yorker Infanterieregiments.
Aus heutiger Sicht bietet Mathew Bradys Lebenslauf Stoff für höchst unterschiedliche Sichtweisen. Für Fotohistoriker ist er ein Urgestein, ein Bolide seines Genres. Für romantisch Veranlagte ist er Stoff für die ganz große Bühne – mit Wagnis, Tragik und allen Verwicklungen, die da dazugehören. Realisten werden einwenden, dass sowas eben von sowas kommt (und entsprechend der gefälligen Businessfotografie das Wort reden). Wenig beleuchtet bei Brady sind hingegen die Widersprüchlichkeit und auch der Glamour-Faktor – die Neuartigkeit der Aufnahmen eben, die er und sein Team lieferten. Neuartig waren selbst die konventionellen Aufnahmen – hochwertige, vorwiegend von Brady selbst gefertigte Studio-Portraitaufnahmen. In ihrer stilistischen Konzentration auf das Wesentliche verweisen sie auf den französischen Berufskollegen Nadar; die Ferne zur Steifheit des Historizismus ist ebenso auffällig wie die zum Plüsch der Jahrhundertwende-Fotografie. Darüber hinaus findet man in Bradys Portrait-Oeuvre nicht nur Generäle wie McClellan, Farragut, Custer, Hancock inklusive einiger Vor- und Nachkriegsaufnahmen der Gegenseite (etwa von »Stonewall« Jackson sowie Lee), sondern auch massig Portraits ganz normaler Personen – Männer, Frauen, und auch Kinder.
Darüber hinaus war sich Brady auch für »Volkspreise« keinesfalls zu schade. Konkret: Portraitfotos für erschwingliche 30 Cent das Stück. Frage: Wollte der Geschäftsmann hier an der neu entfachten Nachfrage partizipieren? Oder war das lupenreine republikanische Gesinnung? Wie auch immer: Mit dem Bürgerkrieg erlebte auch das Genre der preisgünstig gestalteten Privataufnahme einen wahren Boom. Die Gründe waren vermutlich dieselben wie in den heutigen Instagram-Zeiten: Soldaten, die ins Feld zogen, mochten wenigstens ein Bildnis ihrer Liebsten dabei haben, zurückbleibende Frauen und sonstige Angehörige ein Erinnerungstück ihrer Ehemänner, Väter, Söhne und Brüder. Die Menge der in der Bürgerkriegsepoche gefertigten Privatfotos ist so unüberschaubar wie riesig; ein Bericht der Welt veranschlagte ihre Anzahl auf 25 Millionen. Erwartbar – und in den zur Schau gestellten Gesten durchaus modern – sind, wie etwa bei diesem Konföderierten aus Virginia, auch die zur Schau gestellten Posen: waffenfreudiges Pathos, dahinter Zuversicht, versteckte Unsicherheit und eben: Ungewissheit über das weitere Schicksal der Fotografierten.
Einige der Kriegs-Nobodies kamen schließlich vor ganz großem Publikum groß raus: nach ihrem Tod in der Schlacht. 1862 richtete Brady in New York eine Publikumsausstellung aus – mit den neuen, spektakulären Bildern, welche er und sein Team gefertigt hatten. Herzstück der Show, die eine nachgerade sagenhafte Publissity zur Folge hatte: Fotos von Gefallenen des Gemetzels von Antietam – mit fast 4.000 Toten die verlustreichste Ein-Tages-Schlacht während des gesamten Bürgerkriegs. Dass Brady und sein Team vor der vordersten Frontlinie nicht zurückschreckten, hatten sie bereits während der Ersten Schlacht von Bull Run unter Beweis gestellt – der Kriegs-Overtüre vor den Toren Washingtons im Juli 1861. Als Brady & Fotografen zusammen mit zurückweichenden Unionssoldaten den Rückzug antreten mußten, stand die Chance recht hoch, dass die Crême der Unions-Fotoreporter in einem konföderierten Kriegsgefangenenlager gelandet wäre – und das bereits wenige Monate nach Kriegsbeginn.
Alexander Gardner und Tim O’Sullivan
Es ging – um ein Haar – gut. So lieferte Brady bis zum Kriegsende – exklusive Ablichtungen von Prominenz der Zeit ebenso wie großangelegte Schwarz-Weiß-Wimmelbilder von den Kriegsschauplätzen. Oder vielmehr: ließ liefern – obwohl sich der Maestro, entgegen mancher späteren Zuschreibungen, keinesfalls vor Kriegsgebiets-Visiten drückte und in manchen dieser Bilder, gleich einem Hitchcock’schen Cameo-Auftritt, selbst mit abgebildet ist. Am Grundsätzlichen beißt die Maus allerdings keinen Faden ab: Selbst versierte Bildarchivare wissen oft nicht, welchem Fotograf genau »Brady«-Bild X oder Y zuzuordnen ist. Um den selbstgestellten Dokumentationsansprüchen gerecht zu werden, gründete Brady mehrere Außenstellen seines Unternehmens mit einer Reihe beauftragter Fotografen – darunter Genre-Koryphäen wie Alexander Gardner, Timothy O’Sullivan und George N. Barnard. Wie auch heute noch durchaus verbreitet, avancierte im #TeamBrady die Frage der Namensnennung zu einem erstrangigen Streitpunkt. Den Sitten der Zeit entsprechend deklarierte der Meister auch die Aufnahmen seiner Angestellten als die eigenen. Folge: zwei von Bradys Topfotografen – Alexander Gardner und sein Bruder James – machten sich selbständig und arbeiteten ab 1863 auf eigene Rechnung.
Der in seiner Jugend den genossenschaftlichen Sozialisten zugeneigte (und später gute Kontakte zur einflussreichen Pinkerton-Detektei pflegende) Gardner stammte aus Schottland und empfahl sich im Unternehmen Brady vor allem aufgrund seiner Fertigkeiten in dem neuen Nassplatte-Verfahren. Während des Bürgerkriegs erstellte Gardner eine Reihe hoch aussagekräftiger Vor-Ort-Aufnahmen – von spektakulären Schlachtfeldern, vom soldatischen Treiben in der Etappe und schließlich von den Schützengräben vor Petersburg und Richmond. Unmittelbar nach Kriegsende fertigte er von den in Haft einsitzenden Mitbeteiligten am Lincoln-Attentat Portraitaufnahmen und fotografierte bald darauf auch ihre Hinrichtung. Insgesamt als praktisch erwies sich die schauplatztechnische Streuung, welche die Fotografen aus Bradys Stall umsetzten. Während Alexander Gardner und sein junger Kollege Timothy O’Sullivan vorwiegend Bilder von den östlichen Schauplätzen lieferten, war ein weiterer Brady-Fotograf, George N. Barnard, bei Shermans Zug durch Georgia direkt vor Ort – und war so in der Lage, die Südstaaten-Vorzeigestädte Savannah und Charleston unmittelbar nach ihrer Zerstörung abzulichten.
Ebenso wie Mathew Brady war auch Alexander Gardner kein auf Uneigennützigkeit versierter Heiliger. Posthum einen Streit um die Glaubwürdigkeit von Fotografie erweckte ausgerechnet eines seiner berühmtesten Bilder – das des toten konföderierten Scharfschützen auf dem Schlachtfeld von Gettysburg. Gardner hatte – offensichtlich, um seinen Bild-Ausstoß zu steigern – Leichen auf dem Schlachtfeld neu angeordnet und Foto A als Bild eines toten Konföderierten, Foto B hingegen als das eines toten Unionssoldaten ausgegeben. Resummée: vor Fake News – und so auch Fake Fotos – war bereits die Fotografie im großen inneramerikanischen Ringen nicht gefeit. Gardners Vita hat der, sagen wir: freie Umgang mit dem Fotomaterial nicht geschadet. Nach dem Krieg fertigte er erst Auftragsarbeiten vom Eisenbahnbau im Westen und widmete sich dann dem Versicherungs-Metier. Auf die Bedeutung seines fotografischen Werks angesprochen, meinte er: »Es sollte für sich selbst sprechen. Als Erinnerung an die furchtbaren Kämpfe, die das Land gerade hinter sich gebracht hat, wird es hoffentlich von dauerhaftem Interesse sein.«
Das Ende vom Lied: 1954 kaufte die Library of Congress (in etwa das US-amerikanische Pendant zur Deutschen Nationalbibliothek) das Brady-Bildarchiv von den hinterbliebenen Erben auf und stellt sie unter dem Label Brady-Handy Collection seither öffentlich zur Verfügung. Für Mathew Brady, den ersten großen Kriegsfotografen, gab es so – wenn auch stark verspätet – wenigtens ein post-mortem-Happy-End. Als wegweisend erwiesen sich schließlich auch die Fotos des Dritten im Bunde – Timothy O’Sullivan. Weniger bekannt, aber eindrucksvoll vor allem durch die Haltung des Portraitierten: zwei Fotos von John L. Burns, einem Veteranen des Kriegs gegen die Briten 1812 bis 1815 und als Zivilist Mitkämpfer in der Schlacht von Gettysburg. Von den Aufgeführten trifft auf O’Sullivan wohl am ehesten das Bild zu, dass man sich von einem Kriegsfotografen macht: Faible für Abenteuer, ein unstetes Leben und ein ausbalancierter Sicherheitsabstand zur bürgerlichen Normalgesellschaft. Für das Kriegsministerium sowie den United States Geological Survey reiste er später quer durch den Westen. Wenn wir heute wissen wollen, wie der Canyon de Chelly, der Yellowstone Park oder die kalifornische Sierra Nevada im Urzustand aussahen, ist die Chance groß, dass wir dabei auf Aufnahmen von O’Sullivan stoßen. Das spätere Leben ihres Schöpfers verlief ähnlich Rückschläge-umweht wie das seines ehemaligen Chefs. Als Auftragsfotograf konnte er den Kopf soweit über Wasser halten. Ein Jahr, nachdem seine Frau 1881 infolge Tuberkulose verstarb, erlag auch Timothy O’Sullivan, 42jährig, seinen im Lauf der Vorjahre anakkumulierten Krankheitssymptomen.
Als O’Sullivan, Gardner und – in den 1890ern – Brady starben, hatte sich auch die Fotografie verändert. War die Bürgerkriegsfotografie noch eine ausschließliche Männerdomäne gewesen, machten sich nunmehr auch die Frauen im Fotometier zunehmend bemerkbar. Beispiel: die aus dem Bundesstaat Iowa stammende Fotokünstlerin Gertrude Käsebier und ihre Indigenen-Portraits. In Bezug auf die davorliegende Epoche stellt sich die Frage, was die Kriegsfotos von Brady, Gardner und O’Sullivan so einzigartig machte. Befund eins liegt auf der Hand: Ihre Bilder zeigten den Zeitgenossen eine Unmittelbarkeit des Krieges, die zuvor schon aus technischen Gründen nicht möglich war. Interessant ist auch ein zweiter, bislang wenig thematisierter Effekt: Während der Norden fotografisch aus den Vollen schöpfte, sind die Fotodokumente aus dem Gebiet der Konföderierten eher kärglich. Die seitens der Union verhängte Blockade war sicherlich ein Grund. Unter anderem führte sie dazu, dass der Süden sich die für die Fotoproduktion nötigen Chemikalien kaum noch besorgen konnte. Allerdings: Auch ohne Bürgerkrieg hätten die in der Konföderation zusammengeschlossenen Südstaaten kaum einen Fotowettbewerb gewonnen. Vergröbertes Fazit und durchaus empirisch erhärtbar: Während der Norden schon ab den 1840ern in großem Stil auf das neue Medium aufsprang, präferierte man im Süden weiterhin die althergebrachten Darstellungstechniken Stich und Gemälde.
Wie viel dürfen Kriegsbilder zeigen?
Interessant – speziell im Hinblick auf die auch aktuell wieder anschwellenden »Bilderstreits« – ist der Umstand, dass Brady & Co. sich vergleichsweise unreglementiert in den Kriegszonen bewegen konnten. Ähnliche Bilder – wenn auch nicht in der von ihnen gelieferten Drastik – offerieren allenfalls Dokumente von Ersten Weltkrieg. Bereits im Zweiten Weltkrieg war die Rolle von Fotoreportern weitaus durchreglementierter und »eingebetteter«. Allerdings gab es auch in jener Epoche Ausnahmen – etwa die von Robert Capa und seiner später gegründeten Agentur Magnum, und natürlich die Fotos des Duos Capa/Taro aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Im Vietnamkrieg schließlich wurden die Bilder zu einem Politikum, die zumindest ideell mit kriegsentscheidend waren. Die Crux: Während die Amerikaner und Amerikanerinnen ihre Gedenkbilder haben (und so einen Ausgangspunkt, eine realistische Form der Erinnerungskultur entwickeln zu können), sind die neuen Formen des Krieges seltsam bildlos. Nur in Ausnahmefällen – Beispiele etwa: die Massaker von Butscha und das Grauen von Mariupol – gönnen uns die Medien einen (verpixelten) Einblick in die Realität des Tötens und Sterbens.
Sollte man Kriegsbilder zeigen oder nicht? Sicher – es lassen sich für beide Seiten Argumente finden. Unbestreitbar feststehen dürfte allerdings, dass historische Pioniere – wie etwa Alexander Gardner, Tim O’Sullivan und Mathew Brady – Anschauungsmaterial darüber geliefert haben, wie Krieg in der Praxis aussieht.
Die Fotos von Brady, Gardner und O'Sullivan sind großflächig im Inventar der Library of Congress enthalten. Weltweit zur Verfügung stellt sie Wikimedia Commons – das Bildarchiv der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Gesammelt zu finden ist das Foto-Oeuvre der drei Aufgeführten in eigenen Kategorien. Für
Mathew Brady: diese – auch Fotografien anderer Brady-Angestellter beinhaltende Übersicht,
Alexander Gardner: hier und
Timothy O'Sullivan: hier.

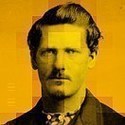




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.