https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Bundesarchiv_Bild_183-18594-0045%2C_Berlin%2C_Novemberrevolution.jpg
Kämpferisch, aber letzten Endes gescheitert: Demonstranten während der Novemberrevolution 1918 in Berlin. Foto: unbekannt / Bundesarchiv. Quelle: Wikimedia Commons. Lizenz: Creative Commons – Namensnennung unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland.
Definitionen
Als allererstes ist es vonnöten, Revolutionen abzugrenzen von Pendants, die – oberflächlich betrachtet – ähnlich daherkommen. Aufzuführen sind vor allem zwei: die Rebellion respektive der Aufstand und der Staatsstreich. Der Unterschied zwischen beiden ist einfach erklärt: Während Rebellionen und Aufstände eine enge Verwandtschaft pflegen mit voll entwickelten Revolutionen (und darum in der Regel als nicht voll entwickelte beziehungsweise im Verpuppungsstadium steckengebliebene Revolutionen betrachtet werden), handelt es sich bei Staatsstreichen in aller Regel um das Gegenteil: den – mehr oder weniger gewaltsamen – Versuch der reaktionären Kräfte, eine reine oder modifizierte Form des ancien régime wieder herzustellen. Aufstände und Rebellionen können in Einzelfällen zwar ebenfalls reaktionäre Intentionen haben (bekanntestes Beispiel ist sicher die »Rebellion« der US-amerikanischen Südstaaten 1861–65). Grosso modo fallen unter diesen Begriff allerdings Erhebungen, die von unten ausgingen – also dem gemeinen Volk, dem Plebs oder jedenfalls Teilen davon.
Nicht geklärt sind in allen drei Fällen Form, Ideologie sowie Verlauf. Die Form ist in aller Regel zwar eine bewaffnete – also eine (mehr oder weniger) gewaltförmige. Über Dauer und Ausmaß der Gewalt treffen die Begriffe allerdings keine Aussage. Ebenso wenig über die Ideologie. So heterogen wie die Form einer Revolution, eines Aufstands oder eines Staatsstreichs (Spektrum ungefähr: von relativ glimpflich und schnell wie bei der vielzitierten »Friedlichen Revolution« anno 1989 bis sehr blutig und sehr lange etwa in den Englischen Bürgerkriegen im 17. Jahrhundert), so vielfältig sind auch die Banner, unter denen sich Revolutionäre, Aufständische und Putschisten sammeln. Wobei es nicht immer gleich eine Ideologie sein muss. Die bekanntesten Revolutionen der Geschichte firmierten zwar unter den großen Labels Demokratie und Sozialismus. Einfachere Ziele sind jedoch ebenso möglich (Zwitterformen inklusive). Beispiele: die frühneuzeitlichen Bauernaufstände in Deutschland oder die Mexikanische Revolution.
Spätestens an diesem Punkt ist es an der Zeit, einen weiteren Begriff in unsere kleine Revolutionsabhandlung einzuführen: das Konzept des nationalen Befreiungskampfes. Daumen mal Pi dürfte die Mehrzahl der größeren nichtstaatlichen Auseinandersetzungen diesem Typ zuzurechnen sein. Ob polnischer und irischer Unabhängigkeitskampf, die Unabhängigwerdung der lateinamerikanischen Staaten, der antikolonialistische Krieg in Algerien oder der Jahrzehnte währende Vietnamkrieg: Unabhängigkeitskriege haben nicht nur die Tendenz, besonders blutig zu sein und lang zu währen. Die Erbitterung, mit der die Auseinandersetzung geführt wird, gleicht derjenigen »echter« Revolutionen – klare Oben, klare Unten, und ein Haß, der dem eruptiv explodierenden Klassenhass der »klassischen« Revolutionen in nichts nachsteht.
Eine Merkmal, dass »klassische« Revolutionen und Unabhängigkeitskämpfe teilen, ist das des Bürgerkriegs. Kaum eine historische Revolution kam ohne (anschließenden, gleichzeitigen oder parallelen) Bürgerkrieg aus – die französische nicht, die russische nicht, die (gescheiterten) deutschen nicht und auch nicht die neueste, unter dem Label »Arabellion« firmierende in Nordafrika und Nahost. Ob Revolutionen gelingen oder scheitern, hängt zuförderst von Kräfteverhältnissen ab: zunächst lokalen, spätestens ab den Steps zwei und drei allerdings stark mit von internationalen, weltpolitischen. Essentiell ab hängen sie natürlich von dem, was die Revolutionäre wollen. Allerdings nur zum Teil. Benito Juarez etwa reussierte zuförderst als Freiheitskämpfer gegen die Okkupation Mexikos durch einen französischen Statthalter-Potentaten. Der Kampf seiner Landguerilla trug allerdings klar die Züge einer sozialen, antifeudalen Revolution. Lenin und seine Genossen wurden ebenfalls eher zum Erfolg getragen, als dass er das Ergebnis zielgerichteter sozialistischer Agitation gewesen wäre. Allerdings profitierten sie von der umgekehrten Gorbatschow-Regel: Sie kamen nicht zu spät, sondern – in Politik wie auf der Arbeit nicht zur Gänze falsch – zu früh.
Verläufe
Eine Beobachtung scheint bereits bei der Betrachtung der bislang aufgeführten Beispiele immanent: Revolutionäre (sowie die Aktiven und Massen, die sie mobilisieren) erreichen nur bedingt das, was sie sich vorgenommen haben. Dies gilt selbst für den Klassiker schlechthin – die Französische Revolution 1789–99. À la longue war dem Kurs der radikalen Fraktion um die Montagnards zwar Erfolg beschieden. Die bürgerliche Demokratie (mitsamt sozial ausgerichteten Volksherrschaft-Komponenten) war nach der Terrorherrschaft quasi in trockenen Tüchern. Die Basics tastete selbst der Imperator, der danach kam, wohlweislich nicht an. Allerdings: Anstatt einen geradlinigen Weg hin zur demokratischen Volksherrschaft anzusteuern, schlenkerten die französischen Verhältnisse über 150 Jahre hin und her. Dauerhaftester Erfolg der »Großen Revolution« dürfte wohl sein, dass das Wissen »Revolte ist machbar (und führt manchmal sogar zum Erfolg)« tief in den politischen Genen des Landes und seiner Kultur verankert ist.
Ist Frankreich das Paradebeispiel dafür, dass Revolutionen zwar nicht das Gesamtgefüge ändern, manchmal jedoch den Spielraum innerhalb desselben, so liefert Deutschland das Anschauungsobjekt dafür, was passiert, wenn die Gegenkräfte dauerhaft zu stark, zu geschlossen und zu brutal sind. Ein frühes Beispiel dafür, wie verhängnisvoll sich der Pakt zwischen gemäßigten gesellschaftlichen Reformern und den alten Mächten auswirkt, ist die blutige Niederschlagung der Bauernaufstände in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Lokalgewalten bekamen dadurch nicht nur Spielraum für das weitere Ausagieren ihrer fürstlichen Separatinteressen – bis hin zum finalen »Spiel der Throne« in einem dreißig Jahre währenden Abschlachten. Auch die nächsten Versuche scheiterten – beziehungsweise standen, wie 1813 und 1860 ff. – von Beginn an unter reaktionären Vorzeichen.
Zum Scheitern verurteilt war schließlich auch der sozialdemokratische Versuch. Zum einen kam er gegen den Willen der Parteiführung zustande – aus blanker Not, als Reaktion auf Krieg und Staatszusammenbruch. Bekanntlich traten die Führer der Sozialdemokraten nicht nur beflissen in die Fußstapfen des frühneuzeitlichen Obrigkeitsapologeten Luther. Die Unterlassungssünden 1918–1923 schufen die Voraussetzungen für Aufstieg und Machtergreifung der Nazis – also den konterrevolutionären Staatsstreich. Sicher kann man den Aufstieg der Grünen Partei ebenfalls in diese Geschichte des gesellschaftsreformerischen Scheiterns mit einbeziehen. Für unser Thema mag diese Kurzabhandlung zeigen, dass die Guten manchmal einfach deshalb nicht gewinnen, weil die Gegenkräfte zu stark sind. Oder – ebenfalls eine Auslegungsmöglichkeit: die eigenen Führungsgestalten Trottel, Kollaborateure oder eine Mischung aus beiden.
Sehen wir uns das letzte Versuchsbeispiel an: Russland. Sind die Sowjetunion, der Stalinismus nicht ein Paradebeispiel dafür, dass bewaffnete Revolutionen zum Scheitern verurteilt sind? Schlimmer noch: in Blutbädern enden, gegenüber denen die Blutbäder der diversen ancien régimes Waisenknaben sind? Die herrschende – seit dem Systemcrash 1990–93 vorwiegend neoliberal orientierte – Geschichtsschreibung möchte (zumindest in ihrer mainstreamförmigen Variante) diese Sichtweise als die einzig mögliche, sozusagen »alternativlose« in die Gehirne verpflanzen. Doch reden wir über die Fehler. Zweifelsohne stand die Russische Revolution, standen deren bolschewistische Anführer vor Wegmarken, deren Abzweigungen sich im großen Rückblick als fatal erwiesen haben – als Wegen zu Verbrechen und Wegen, die das Scheitern 70 Jahre später vorwegnahmen. War Stalin als Leader ein großer Fehler – möglicherweise sogar der entscheidende? Möglich. Die Wahrheit ist: Wir kennen die Antwort nicht. Grund: Der Zeitabstand, um Folgen und Langzeitwirkungen gegeneinander abzuwägen, ist für derartige Betrachtungen einfach zu kurz. Wären die Kadetten eine Alternative gewesen – ein schmerzfreierer Weg in die russische Moderne? Möglich, dass bessere Geschichtswissenschaften Antworten auf diese Fragen gäben. Doch es ist wie bei der Katz’: Wir haben solche derzeit nicht.
Optionen
Revolutionen wägen Optionen ab. Das ist ihre Natur. Erste Option ist – natürlich – die Machtfrage. Die erste naheliegende Frage, die lautet: Können wir gewinnen? Man muß es nicht so romantisch haben wie bei Bolívar oder Garibaldis gesamtitalienischen Freischärlern, mit Schwüren, hastigen Abschiedsküssen vor der Fensterkulisse des fürstlichen Salons oder der konspirativen Einschiffung hastig zusammengestoppelter Brigaden. Spätestens dann, wenn es richtig zur Sache geht, werden die Optionen existenzialistisch. Im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht nur für das First Personal der Revolution, sondern alle (oder jedenfalls die meisten oder viele). Der Auftakt rankt sich oft um ein mehr oder weniger fest umrissenes Programm. In den meisten Fällen – jedenfalls bei den »klassischen« oder klar linken Revolutionen – trägt dieses eine radikaldemokratische Signatur, keinesfalls eine sozialistische. Sozialrevolutionäre Partien können ebenfalls mit enthalten sein – oft dann der Fall, wenn die Revolution in einem Feudalstaat antritt und eine Bauernbefreiung klar mit auf der Agenda steht. Ebenso kann sich ein Befreiungsprogramm um eine antiimperialistische Agenda ranken – in der Regel dann, wenn eine fremde Macht als Usurpator auftritt und die heimische Bevölkerung unterdrückt oder gar versklavt.
Fazit: Die meisten Ausgangsprogramme sind vergleichsweise gemäßiger Natur. Gleichberechtigung des Dritten Standes. Abzug der Briten, Irischer Freistaat. Krieg dem Krieg. Die Radikalisierung folgt durch den Widerstand danach – den Stöcken, die man der Revolution in den Weg legt. Ebenso die Fraktionierungen, die Auseinandersetzungen um Wege, um Ziele. Die Revolution frißt ihre Kinder – bekanntlich nicht nur ein Bonmot. Doch auch die restlichen Teilnehmenden bekommen oft nicht das, was sie sich ursprünglich erwünschten. Sind bereits die klassischen (also die gelungenen oder jedenfalls am Ende siegreichen) Revolutionen nicht das, was ein großer chinesischer Revolutionsführer als »Deckchensticken« bezeichnete, so führen gescheiterte mitunter zu Zuständen, die schlimmer sind als die Zustände »davor«. Anschauungsmaterial in jüngerer Geschichte: die Revolution im Iran 1978 sowie die »Arabellion« in Lybien, Ägypten oder Syrien.
Nicht das, wass man (ursprünglich) wollte, bringen manchmal auch ganz einfach die internationalen Kräfteverhältnisse. Beispiel: der amerikanische »Hinterhof«, Lateinamerika. Summa summarum bietet sich nach 100 Jahren Familienherrschaft, Militärdiktaturen, Caudillos linker wie rechter Provinienz, Volksfronten, bewaffneter Guerilla in jeder denkbaren Konsistenz sowie vorsichtigen Demokratieversuchen ein durchwachsenes Bild. Kuba wird schlussendlich wohl zu Kreuze kriechen, Chavez’ Nachfolger sich mit den Yankees arrangieren müssen. Die Sandinistas sind ernsthaft nicht mehr Modell, die Zukunft ihrer Epigonen in den südmexikanischen Dschungeln ungewiss. Dekliniert auf die weltpolitische Situation, lässt sich die Lage der lateinamerikanischen Linken am besten als Pattsituation charakterisieren. Ches Rache am Modell des übermächtigen Yanki sind aktuell weniger die moderat linken Regierungen in einigen Ländern, sondern die international agierenden Narco-Kartelle. Mit der Pointe, dass Bürgerkriegsgewächse wie MS-13, Los Zetas & Co. längst mit ein Faktor sind innerhalb der immer weiter segmentierten US-amerikanischen Unterschicht. Wobei – zumindest an diesem Modell hat sich nichts geändert – den Großteil der Zeche nach wie vor der südliche Nachbar zahlt.
Alternativen
Man muß die Diskussionen um die in der Folge von 68 zirkulierenden Stadtguerilla-Konzepte nicht erneut auflegen, um zu sagen, dass »Revolution« in den westlichen Industrieländern derzeit keine Option ist. Als Alternative flächendeckend etabliert haben sich im linken Milieu Konzepte von zivilen Kampagnen, mitunter auch von zivilem Ungehorsam, der (begrenzte) Regelbrüche mit beinhaltet. Auch wenn hier nicht der Platz ist, detaillierter auf die Grundlagen derartiger Konzepte einzugehen (ein italienischer Autor hat dies aktuell – mit einiger Resonanz, auch im Freitag – bereits getan), sollte doch die Frage gestellt werden, warum gewaltfreie Konzepte in der postmodernen Linken einen derart unvergleichlichen Zulauf haben. Die Frage nach den Erfolgsaussichten allein wird dieser Präferenz nicht gerecht (die Erfolge von King, Gandhi und anderen waren – wie Domenico Losurdo nachweist – summa summarum stückhaft, widersprüchlich und von zahlreichen Rückschlägen gekennzeichnet). Frage: Was ist es dann?
Das Konzept des zivilen Ungehorsams basiert letzten Endes auf drei Pfeilern. Pfeiler eins ist die Tatsache, dass westliche Industriegesellschaften immer noch vergleichsweise kommode Lebensumstände bieten. Ein Fact, der (wenn auch nicht mehr in den Ausmaß wie noch vor 20, 30 Jahren) auch die Ärmsten der Armen und sonstigen Underdogs betrifft. Profan gesagt: Zur Waffe (oder zum Transparent mit der Losung für den Umsturz) greift man nur dann, wenn alle (anderen) Optionen verbaut sind und man im Prinzip nichts mehr zu verlieren hat. Der zweite Pfeiler ist das Wissen um die Chancen. No Risk, No Fun taugt als Parole vielleicht für Zwanzigjährige. Das Wissen, dass Revolutionen anders enden können als erwartet (und ein mehr oder weniger langer Bürgerkrieg sozusagen das »Normalrisiko« ist), gehört – nach Arabellion, Maidan sowie dem festgefressenen Krieg in der Ostukraine – ebenso zum kollektiven Gedächtnis wie die Chancen für Jobs oder die Erwägung, mit einem Steuerbetrug ungestraft davonzukommen.
Pfeiler drei ist die Plusminusrechnung aus eins und zwei: die Ideologie, die besagt, dass es unter den (alles in allem noch immer) demokratischen Umständen besser ist, halbwegs zivile Formen des Protestes in Angriff zu nehmen. Verglichen mit dem va-banque-Spiel Revolution mindert diese Vorgehensweise nicht nur das existenzielle Risiko. Auch in Bezug auf Zukunftsvorstellungen machen derartige Erwägungen durchaus einen Sinn. Wo alles kaputt ist, ist es schwer, einen Neubeginn auf die Beine zu stellen. Demokratie also gerettet – beziehungsweise das postdemokratische Pendant, welches die aufgeklärten Eliten unserer Tage wohlweislich nur in verdaulichen Scheibchen servieren? Gut möglich, dass es für ein Ausrufen des »Endes der Geschichte« diesbezüglich zu früh ist. Wie schnell eine Stimmung selbst im aufgeklärt-zivilisierten Europa umkippen kann, haben 2014 die Ereignisse um die Kiewer Maidan und in der Ukraine gezeigt.
Darüber hinaus: Auch der Klassiker der Klassiker – die französische Revolution – fing mit einem einfachen Sitzstreik an.
Weiterführende Literatur:
Unsichtbares Komitee: An unsere Freunde. Nautilus Flugschrift. Edition Nautilus, Hamburg, April 2015. 192 Seiten, 16,– €. ISBN 978-3894018184.
Domenico Losurdo: Gewaltlosigkeit. Eine Gegengeschichte. Argument Verlag, Hamburg, Januar 2015. 288 Seiten, 33,– €. ISBN 978-3867541053.
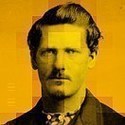




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.