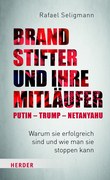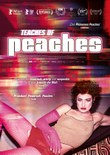Was ist „Relevanz in digitalen Zeiten“? Die Journalistinnen Marietta Slomka, Georg Restle, Florian Klenk und Vanessa Vu diskutierten darüber auf einem Podium der Netzkonferenz re:publica. Lassen sich Redaktionen von den Trends, die durchs Internet schwappen, zu stark treiben? Hat die durch Social Media erzeugte Resonanz die Hoheit über die weichere Währung Relevanz gewonnen?
Die Frage war eine ganz richtige. Viele Journalisten nehmen sich ja gerne der albernsten Aufreger an. Aber auch wenn sie einen klaren Begriff davon haben, was wichtig ist, kommen sie an vielen Themen schwer vorbei.
Dass etwa die AfD, die sich wie keine andere Partei in Deutschland auf den Einsatz von Facebook versteht, Themen gesetzt hat, denen dann Journalisten hinterher berichten, hat man in den vergangenen Jahren gesehen. Ebenso hat die von Donald Trump verbreitete Darstellung verfangen, es seien Journalisten, die „Fake News produzieren, während die, die sie produzieren, sich als Wahrheitsproduzenten gerieren“ – so formulierte es Florian Klenk, Chefredakteur des Magazins Falter in Österreich. Es gibt dadurch eine Notwendigkeit der andauernden Richtigstellung und des Faktenchecks. Klenks Anwesenheit legte nahe, auch über die FPÖ zu sprechen. Parteivertreter haben zuletzt etwa die Entlassung des ORF-Moderators Armin Wolf gefordert, nachdem der getan hatte, was Journalisten tun sollten: Er hatte rechtsextremistische Parolen und Hassbroschüren gegen „Migration“ nicht einfach weggelächelt.
In dieser Gemengelage wird ein Thema bisweilen journalistisch aufgegriffen, obwohl es keines ist. Die Einwände der berühmten „100 Lungenärzte“ gegen die Dieselgrenzwerte etwa: Die Rechnung war „wissenschaftlicher Mumpitz“, sagte WDR-Moderator Restle, und dennoch wurde sie zunächst ernstgenommen. Sein Eindruck sei, Journalisten seien „wund gerieben“ und froh gewesen, hier vermeintlich ausgewogen über den Diesel-Komplex berichten zu können: „Endlich können wir mal eine andere Meinung ins Programm bringen.“
Nur ist diese „false balance“, diese falsche Ausgewogenheit, im Interesse derer, die solche Rechnungen lancieren: Sie sorgt für den Eindruck, dass etwas ganz anders sein könnte. Mit diesem Eindruck wird dann – in diesem Fall etwa vom Verkehrsminister – Politik gemacht. „Wir erliegen zunehmend den Kampagnen im Netz“, sagte Restle. Debatten würden sich künstlich verstärken, die in der vordigitalen Zeit vielleicht weniger diskutiert geworden wären. Das Beispiel der Lungenärzte freilich zeigt, dass es unangebracht wäre, wenn Journalisten beim Stichwort „Kampagnen im Netz“ nur auf Lobbyisten oder Populisten deuten würden: In die Wahrnehmung gespült wurden die Lungenarzt-Thesen schließlich von Journalisten selbst – nur eben von anderen. Es sind also nicht „die“ Social Media, die dafür sorgen, dass Relevanzentscheidungen falsch ausfallen.
Was tun? Armin Wolf, der den FPÖ-Leuten ihre Ausfälle nicht durchgehen ließ, hat gezeigt, wie man agieren könnte: Man muss diese Ausfälle zwar aufgreifen. Aber man muss nicht so tun, als seien sie stinknormale Pressemitteilungen, die man einfach zu vermelden hat. Der Hinweis aus dem re:publica-Publikum auf eine Richtlinie der britischen BBC war ebenfalls hilfreich: Weil der menschengemachte Klimawandel nachgewiesenermaßen existiert, heißt es darin, sei es nicht notwendig, in Berichten darüber Menschen zu zitieren, die das bestreiten.
Richtig ist aber auch, was Marietta Slomka vom ZDF sagte: Von einer Polarisierung profitieren „wir als Medien“. Auch das: ein relevanter Hinweis.