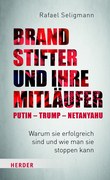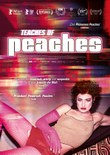Die Abstände werden knapper. Dem Attentat im Abendverkehr von Ankara am 15. März folgt nur vier Tage danach der Anschlag auf einer Geschäftsstraße in Istanbul. Keine 24 Stunden später wird aus Angst vor dem nächsten Inferno das Fußballspiel zwischen den Lokalrivalen Fenerbahçe und Galatasaray Istanbul abgesagt. Nicht nur ein Indiz, sondern das Eingeständnis für einen Verlust an innerer Sicherheit. Die Ausläufer des gegen die Kurden geführten Krieges und des militärischen Engagements in Syrien streifen nicht nur – sie erschüttern die beiden größten Städte des Landes.
Wer das im Einzelnen zu verantworten hat – ob der IS oder die PKK oder PKK-Dissidenten wie die Freiheitsfalken Kurdistans –, es kristallisiert sich als Motiv heraus, Grauen und Zerstörung aus dem Südosten in den Westen der Türkei zu tragen. Es wäre nachvollziehbar, sollte der kurdische Widerstand versuchen, die AKP-Administration auf diese Weise wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Kein aussichtsloses Unterfangen. Prestige und Glaubwürdigkeit des Präsidenten Tayyip Erdoğan gehen zu Bruch, kann er den Schutz seiner Bürger nicht mehr garantieren. Auch sind die Kollateralschäden der entstandenen Gefahrenlage schwerlich zu übersehen. Investoren fühlen sich kaum mehr eingeladen. Die Einbußen für den Tourismus sind enorm, Buchungen allein aus Deutschland seit Anfang 2016 um 40 Prozent eingebrochen. Russische Urlauber schenken sich Reisen in die Gegend zwischen Istanbul und Antalya gleich ganz, seit türkisches Militär im November einen russischen Jet abgeschossen hat.
Hausmacht und Wahlverein
Erdoğan salbt seine Ohnmacht mit martialischer Rhetorik und kämpft genau genommen gegen sich selbst. Offenbar fallen derzeit die bitteren Früchte seines Konfrontationskurses vom Baum. Die Waffen, mit denen Gehorsam erzwungen werden soll, schlagen zurück auf den Schlagenden. Erdoğan hat sich nach der Parlamentswahl im Juni, als die AKP ihre absolute Mehrheit verlor, dafür entschieden, den Friedensprozess mit der PKK abzubrechen und den Schirmherren staatlicher Allmacht zu geben. Die Neuwahlen am 1. November schienen ihn zu bestätigen. Nur wie? Zwar verfügt die AKP-Regierung seither wieder über die gewünschte Mehrheit, doch gebraucht sie ihr Mandat, um dem Land den inneren Frieden zurückzugeben? Wer seine Macht missbraucht, der zerstört politische Kultur, wie das die Militärdik-tatur des Generals Kenan Evren in den 80er Jahren zur Genüge bewiesen hat.
Wird sich das wiederholen? Es muss wohl. Aus der AKP heraus ist weder mit Kritik noch Korrektur zu rechnen. Es handelt sich um eine sultanisch geführte Partei. Sie ist Honoratioren- und Wahlverein, nicht geübt im Umgang mit eigener Willenskraft. Sie wird mit Erdoğan überleben oder untergehen.
Es liegt allein an ihm, was geschieht. Entweder muss der asymmetrische Krieg im Inneren schnell gewonnen oder wieder verhandelt werden. Alles dazwischen kostet präsidiale Legitimation. Besonders die USA dürften das mit Sorge quittieren. Ihr Status im Syrien-Konflikt ist auf einen gefestigten NATO-Partner Türkei angewiesen. Sollten also die Amerikaner der EU dafür dankbar sein, dass sie durch den Flüchtlingsdeal der Autokratie in Ankara beisteht? Nach dem jüngsten Brüsseler Gipfel kann sich die türkische Führung immerhin zugute halten, 75 Millionen Landsleuten demnächst einen visafreien Zugang nach Europa und eine EU-Beitrittsperspektive verschafft zu haben.