Der Winter ist da, und zumindest für die Harten unter den »Games of Thrones«-Fans ist die Zeit des Abzählens gekommen. Sofern HBO und Sky ihre Pläne einhalten, bedeutet dies: noch 80 mal schlafen, dann ist es so weit. Da Sky seine Doppelstrategie – erst ausstrahlen auf Sky TV, dann ab damit in das Streaming-Programm – sicher auch bei GoT 8 beibehält, müssen Freunde des Bingewatchings (der stoßweisen Konsumierung von mehreren oder auch allen Folgen am Stück) sich sechs Wochen länger gedulden. So viel ist klar: GoT 8 ist mit sechs Folgen zwar die kleinste aller bisherigen Staffeln. Ansonsten allerdings wird sie, so viel steht fest, ziemlich alle Rekorde brechen. Die Folgen – bislang im Schnitt maximal eine Stunde – haben zum Teil Spielfilmlänge. Neujustiert wurden auch die Maßstäbe bei den Schlachten. Die bisherigen Margen – der Kampf um die Mauer (Staffel 4) und die Schlacht der Bastarde (Staffel 6) – soll 8, so die aktuellen Vorabinformationen, nochmal deutlich toppen.
Außergewöhnlich viel – um nicht zu sagen: alles – steht allerdings auch im Handlungsteil auf dem Spiel. Die Mutter aller Fragen ist zunächst, ob die Koalition der Guten es schaffen wird, die heranrückende Armee der Toten zu schlagen. Doch auch jenseits der drohenden Vernichtung alles menschlichen Lebens auf den beiden Fantasiekontinenten Westeros und Essex sind die Spannungsmomente nicht zu knapp. Wird die Erz-Böse in der brüchigen Guten-Koalition, Cersei Lennister, ihren Bündnispartnern in den Rücken fallen? Wie wird es mit Jon Schnee und Daenerys Targaryen ausgehen? Ist ein Happy-End in Sicht, oder müssen wir uns auch im Finale auf düstere, blutige Überraschungen einstellen? Wie die meisten epischen Serien neueren Zuschnitts war »Game of Thrones« recht freigiebig beim Dahinscheiden handlungstragender Hauptfiguren. Entsprechend kursieren auch vor dem finalen Ende die unterschiedlichsten Theorien, welche der noch verbliebenen Figuren Season 8 nicht überleben wird. Last but not least: Ins Mutmaßungs-Metier über das anstehende Ende sind im Falle GoT auch Medien eingestiegen, die sonst eher auf strikt Faktisches versiert sind. So Spiegel Online – wo die Mutmaßung kolportiert wird (zumindest die kann als faktisch angesehen werden), dass ein Ende ansteht, dass die Fans möglicherweise polarisiert.
Unabhängig davon, wie »Game of Thrones« ausgehen wird: Bereits heute ist klar, dass es im Fantasy-Metier noch nie so viel Blut, Düsternis, sexuelle Freizügigkeit und moralische Ambivalenz gegeben hat. »Der Herr der Ringe«, die Eichmarke der 2000er-Jahre, ist gegen GoT ein Poesiealbum – ein (handwerklich gut gemachter) Karl-May-Film, der gegen einen Italo-Western der Machart »Spiel mir das Lied vom Tod« konkurriert. Die ambivalente Zweideutigkeit der Figuren sowie der grundweg düstere Grundton waren schon früh die Elemente, welche die Serie in den Olymp der Qualitätsserien hoben. Der mittelalterliche »Sozialrealismus« – kopiert zwischenzeitlich von anderen Serien wie zum Beispiel Vikings – sorgte als entscheidendes Wiedererkennungsmerkmal dafür, dass auch Zuschauer die Serie sahen, die sonst wenig mit Fantasy und Mittelalter anfangen können. Sicher ist hier nicht der Rahmen, näher zu untersuchen, inwieweit die verschiedenen Elemente des GoT-Merchandisings – Ausstrahlung, Rückmeldung, kulturelle Relevanz plus Folgeprodukte – am überragenden Erfolg von GoT mit beteiligt waren. Ausgehend von der These, dass ein popkulturelles Phänomen der Bedeutungsliga Beatles, Madonna und Lady Gaga Bedürfnisse, Sichtweisen und Gefühle widerspiegelt, die in einer breiteren Bevölkerungsgruppe vorhanden sind, ist bei GoT die Frage weniger die, ob das so ist, sondern vielmehr die, welche Stimmungen, Wünsche und Weltsichten von der Serie aufgegriffen und durch sie bestätigt werden.
Anders gefragt: Inwieweit ist die Welt vom »Game of Thrones« in Wirklichkeit die Welt von heute? Zugegeben: Kindesmord, Verwandtenmord und ähnliche Praktiken unter gekrönten Häuptern gerieten bereits im europäischen Hochmittelalter zu Auslaufmodellen. Im übertragenen Sinn jedoch hält die Serie der Welt durchaus ein Spiegelbild vor. Im »Real Life« wurden die Metzeleien lediglich verfeinert, in einigen Aspekten auch domestiziert. Ein gutes Beispiel hier ist der »Empire Crash«, bei dem am Ende des Ersten Weltkriegs die Dynastien purzelten (ein Finale, dass so wohl kaum eine Serie erfinden könnte). Man kann die Analogien sicher weitertreiben – auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass der Vergleich der Unoten-Armee mit den Greueltaten etwa der Nazis in die spekulative Beliebigkeit führt. Viel ergiebiger ist allerdings ein anderes Moment, dass sich konstant durch alle GoT-Staffeln zieht: die Allegorie der guten Regierung – ein Begriff, der naturgemäß vielseitig auslegbar ist. Ob Jon Schnee, Danaerys Targaryen oder der abgeklärte, im Grunde jedoch herzensweise Tyrion Lennister: Alle drei bedienen – zumindest ideell – die Vorstellung von und den Wunsch nach einer besseren, gerechteren Obrigkeit. Speziell die tragenden Hauptfiguren der Serie zeigen, dass es im konkreten Zweifelsfall viel Unterschied macht, ob ein psychisch kranker, sadistisch veranlagter Despot an den Schalthebeln der Macht sitzt oder aber jemand, der sich – zumindest im Rahmen der abgesteckten Verhältnisse – um Ausgleich und Gerechtigkeit bemüht.
Verstärkt wird dieses realistische Moment durch den Umstand, dass in der Serie auch die Guten, mit Verlaub, Dreck am Stecken haben. Jon Schnee ist gleich in der ersten Folge von Staffel eins Teil eines Aufgebots, welches einen Deserteur hinrichtet. Tyrion hat die Seiten gewechselt; Ähnliches deutet sich am Ende der siebten Staffel für seinen Bruder Jaime an, der dem inzestuösen Verhältnis mit seiner Schwester den Rücken kehrt und sich der Armee der Guten anschließen will. Danaeris schließlich, die Königin der Herzen, lässt den Oberbefehlshaber einer Streitmacht hinrichten, die sich der ihren ergeben hat. Insgesamt verleitet die durchgehend düstere Stimmung der Serie zwar dazu, die (mittelalterliche) Welt als eine Schlangengrube wahrzunehmen – als Ort der Intriganz und des (letztlich blutigen) Machtkampfs jeder gegen jeden. Beim Blick auf die aktuelle Politik sowie die kleinteiligen Sozialbeziehungen werden sicher viele Parallelen erkennen. Serien-Moral, zumindest auf den ersten Blick: Die Welt ist eine veritable Jauchegrube, und die Chancen auf ein »gutes Regieren« stehen insgesamt eher schlecht.
Doch selbst im »Games of Thrones«-Leben ist nicht alles Verrat (eine Form der Interaktion, wie sie beispielsweise am Ende von Season 3 in der »Roten Hochzeit« besonders eindringlich dargestellt wird). Die Freizügigkeit der Protagonist(inn)en ist zwar oftmals eher frivol als wirklich lustvoll. Nichtsdestotrotz liefert GoT auch Beispiele unerwarteter Hochherzigkeit. Beispiel: der unter dem Namen »Bluthund« agierende Sölder, der bei dem sadistischen Teenager-König Joffrey den Dienst quittiert und der der vor Joffrey flüchtenden Arya hilft, sich in den Norden durchzuschlagen. Oder die Lehnseid-schwörsüchtige Brienne von Tardt – überdurchschnittlich loyal zweifelsohne nicht nur für GoT-Verhältnisse, und eine Freundin, die mancher Zuschauer auch im echten Leben gut gebrauchen könnte. Eine kontrovers diskutierte Serienfrage ist es schließlich, ob es echte Liebe war zwischen der Prostituierten Shae und Tyrion, dem Gnom. Hat Shae Tyrion aus Berechnung verraten? Oder war es Enttäuschung – weil er sie wegschickte?
Auch wenn Spin-Offs bereits angekündigt sind: Das Original wird ab Juni Geschichte sein. Barack Obama mag die Serie. Ob sein derzeitiger Antipode sie mag, wissen wir nicht (bekannt ist derzeit eher Kritik an seiner Regierung mit aus der Serie entliehenen Anspielungen). Die Erkenntnis, dass es zumindest nicht ganz trivial (im Sinn von: bedeutungslos) ist, welcher Leader (oder welche Sorte davon) gerade an der Spitze steht, mag man vielleicht für eine Binse halten. Allerdings: Falls dies die Erkenntnis ist, die die Serie – neben allem anderen – befördert, war sie vielleicht auch in politischer Hinsicht nicht ganz umsonst.

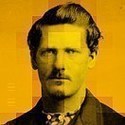




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.