Netflix-Kunden, die sich dieser Tage beim Sender ihrer Wahl einloggen, um sich die neueste Staffel der Erfolgsserie Orange Is the New Black anzusehen, dürften – wenn auch eher unfreiwillig – Teilnehmer(innen) eines historischen Moments werden: der Grabtragung des vormals vielbelobten Genres Qualitätsserie. Im konkreten Fall deutete sich der Qualitätssturz zwar bereits im letzten Jahr an: in Form einer dritten Staffel, deren widerborstige Inhaltsanteile sichtbar geglättet waren und die vom Szenario her – trotz noch präsenter Drama-Substanz – die Visitenkarte vorlegte für den Einstieg in das platte Kalauerniveau, welches Staffel 4 nun durchexerziert. Willkommen im Land der Banalität, willkommen beim sogenannten Qualitäts-TV.
Glattgebügelt und klitscheehaft: die neue Staffel der Netflix-Erfolgsserie »Orange Is the New Black«
Neflix 2016: Masse statt Klasse
Bemerkenswert ist der Absturz von Orange Is the New Black aus zwei Gründen. Zum einen ist die Serie eines der Originalproduktionen-Aushängeschilder des Streaming-Anbieters Netflix. Zweitens gilt Netflix – zusammen mit dem US-Anbieter HBO – als zweite Hochburg in Sachen anspruchsvolle Serienstoffe abseits von Popcornkino und Bügel-TV. Im konkreten Fall ist der Rückfall in die Serien-Kreisliga allerdings derart offensichtlich, dass sich die Frage nach den Gründen geradezu aufdrängt. Die Kurzkritik im Schnelldurchlauf: OITNB 4 bricht mit geradezu allen Handlungselementen, welche die ersten beiden Staffeln herausragend und die dritte immer noch überdurchschnittlich gemacht haben. Der Cliffhanger am Ende der Dritten (Spoiler: es geht um eine allseits geschätzte tragende Figur) wird bereits in den ersten Sekunden von Vier in Richtung allseitiger Harmonie aufgelöst.
Doch nicht nur das. Die Umstände besagter Auflösung sind, gelinde gesagt, krass unglaubwürdig. Zusätzlich verflüchtigt sich der Serienschauplatz Justizvollzugsanstalt vollends in Richtung einer Wohlfühl-WG – ein Element, das sich in der Vorstaffel bereits andeutete, dort jedoch noch von echter Drama-Handlung konterkariert wurde. In Staffel vier sind Handlungselemente (jedenfalls im eigentlichen Sinn) weitestgehend Fehlanzeige; stattdessen nervt die Hauptdarstellerin – was unter Umständen daran liegen mag, dass vier Staffeln für 14 Monate Haft schon krass überzogen sind. Ausgleichshalber kalauert sich der Rest der serientragenden Figuren vergnügt durch die ansonsten recht ereignislose Handlung, macht auf Sitcom und lustwandelt ausgiebig durch die grünen Parkanlagen dieses menschenfreundlichen TV-Knastes.
In etwa ist das Ganze so, als würde man – weil Robert De Niro und Al Pacino in der Lage sind, guten Filmen das Sahnehäubchen obendrauf zu verpassen – die Schlussfolgerung ziehen, dass die Kombination De Niro plus Pacino automatisch gute Filme garantiert und der Stoff drumherum Nebensache ist. Doch reden wir vom Rest. Ansprüche nicht einlösen konnte Netflix bereits mit einer weiteren Produktion, die kürzlich Online gestellt wurde: Marseille. Das chrompolierte Polit-Drama fand nicht nur im Feuilleton ein Echo, dass im Wesentlichen zwischen so-là-là- und Kann man vergessen changierte. Ärgerlich an dieser – plot- wie niveautechnisch eher in der Sat1-Filmevent- anstatt der Borgen-Liga spielenden Serie – war vor allem der stetige Vergleich mit einer anderen Netflix-Produktion: der Politserie House of Cards.
Die House-of-Cards-Ähnlichkeitswettbewerbe haben sich im Serienjahr 2015/2016 zu einer eigenen Liga ausgewachsen. »Ähnlich« oder »vergleichbar« sein wollte nicht nur Marseille. Auch die ARD (die ihren wirklichen House-of-Cards-Epigonen bereits vor sechs Jahren ins TV-Nirvana geschossen hatte) schickte mit Die Stadt und die Macht einen weiteren HoC-Ähnlichkeitsolympioniken ins Rennen. Dass all diese Produktionen – die eine mehr, die andere weniger – floppten, ist ein eigenes Thema. Ebenso die Tatsache, dass die Öffentlich-Rechtlichen ein klammheimlich liquidiertes Format, den TV-Mehrteiler, ebenso erklärungskarg wieder aufleben lassen und aus Marketinggründen – Zuschauer müssen offensichtlich beschumst werden – nunmehr mit dem zeitgemäßen Etikett »Serie« versehen. Der springende Punkt bei all den House-of-Cards- und Breaking-Bad-Nachfolgern ist indess Ausstrahler-unabhängig: Grundsätzlich nämlich stellt sich die Frage, wieso man einen Stoff, der bereits verfilmt wurde, wieder und wieder von Neuem verfilmen muß. Gibt es keine neuen? Oder, mal konkret gefragt: Sind die Aspekte des menschlichen Lebens mit dem Topos »Politikerkarriere« bereits zur Genüge abgedeckt?
Zugegeben: Ganz abgeblättert ist der Qualitätslack beim Hoffnungsträger Netflix noch nicht. Die zweite Staffel des Südstaaten-Dramas Bloodline hält – fast möchte man sagen: unerwarteterweise – das fulminante Niveau der ersten und schafft es sogar, ein paar neue Akzente zu setzen. Bemerkenswert ist diese Tatsache auch darum, weil das Kreativ-Umfeld beim TV-Newcomer nicht unbedingt nach Serienmacher-Traumjob aussieht. Zugegeben: Im Bereich der Qualitätsserien-Produktionen hat sich Netflix einen bemerkenswerten Platz erkämpft. Andererseits ist die Marktausforschung, welche der Streaming-Dienst betreibt, die nach amazon wohl Agressivste. Ohne penibelste Zuschauer- und Einschaltquoten-Ausforschung geht keine Netflix-Produktion an den Start. Dass diese Herangehensweise nicht unbedingt das ideale Umfeld abgibt für filmische Innovationen oder kreative Experimente (sondern vielmehr mainstreamförmigen Sehgewohnheiten zuarbeitet), kann man sich eigentlich an den Fingern einer Hand ausrechnen. Offensives Setzen auf Filmemacher und ihre Ideen, so wie das HBO tut, ist bei Netflix zwar nicht zur Gänze ausgeschlossen – umgekehrt jedoch nicht tragendes Prinzip.
Nostalgie, oder: die Rock’n’Roll-Revolution im Fernsehen
Verstärkend hinzu kommt, dass die Themen mittlerweile abgegrast sind und ein gewisser Sättigungseffekt eingesetzt hat. Reden wir Klartext: die stofflich anspruchsvolle, unkonventionelle Fernsehserie in der Tradition legendärer HBO-Produktionen wie etwa die Sopranos oder The Wire hat ihren Zenit überschritten. Dem langsamen, aber stetigen Abwärtstrend der Qualitätsserie hält aktuell eigentlich nur eine Produktion noch stand: die Siebzigerjahre-Vintageserie Vinyl, produziert von den beiden Fach-Koryphäen Martin Scorsese und Mick Jagger. Game of Thrones – für Vinyl-Produzenten HBO sicher die Goldgrube schlechthin – metzelt, meuchelt und intrigiert zwar auch in Staffel 6 auf dem gewohnt hohen Niveau. Inhaltlich rennt der Serie allerdings die Zeit davon. Konkret: Um die von den Zuschauern ersehnte »Koalition der Guten« handlungstechnisch umzusetzen, benötigte die – der Buchvorlage mittlerweile vorauseilende – Serie mindestens fünf weitere Staffeln. Da eine derartige Konstellation ebensowenig in Sicht ist wie das Gegenteil (der Serienkontinent Westeros geht unter in einem Knall, Blutbad oder auch beidem), wird sich auch Game of Thrones vermutlich weiter und weiter zerfasern.
Die Zerfransung und/oder Verflachung vormals guter Stoffe ist vor allem im Anblick der Fallhöhe bemerkenswert. Euphemisch formuliert kann man die Serienrevolution, die vor zehn, fünfzehn Jahren begann, als die erste popkulturelle Innovation des neuen Jahrtausends bezeichnen. Groß gegriffen hat sie Ähnlichkeit mit dem Aufkommen der Rockmusik ab den Fünfzigern, etwas realistischer formuliert ist sie vergleichbar mit der Etablierung des Nouvelle-Vague- und New-Cinema-Autorenfilms in den Sechzigern und Siebzigern. Auch von der soziologischen Warte aus kann man den Qualitätsserien-Boom schlecht geringschätzen. Serien wie Lost, Die Sopranos, The Wire oder (wenn auch vergleichsweise spät) Breaking Bad sind nicht nur Genre-Meilensteine, mittlerweile versehen mit einer eigenen Kanon-Klasse von Klassikern. Darüber hinaus avancierte die (anspruchsvolle) Serie zu dem Medium der »Generation Videothek« – einem Nischenpublikum, dass sich in den Neunzigern herausgebildet hatte und das für das klassische Programmkino zu unbildungsbürgerlich, für das Popcornkino des Mainstreams jedoch zu anspruchsvoll und zu urban war.
Wie weiter? Die beschriebene Dekade nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Ebenso wie die Rockmusik der Nachkriegsjahrzehnte abgelöst wurde durch monoton wummernde Großdisko-Beschallung sowie ebenso elektronikgestütztes Lounge-Soundgeklimper für den politisch korrekten Etepetete-Nachwuchs und das New Cinema von Scorsese & Co. durch multiplexgestützte Blockbuster-Events, so wird auch die Qualitätsserie à la longue abgelöst werden. Durch was, ist noch nicht raus. Eins ist jedoch sicher: dass die Stoff-Glätter, die Bedenkenträger, Taschenrechner und Es-allen-recht-machen-Woller, die Marketing-Experten und die Medienspin-Doctoren in den Firmenetagen der involvierten Networks und Sender einen entscheidenden Anteil daran haben werden.
Im Prinzip läuft es also so wie immer: Wo der Kommerz kommt, muß das Authentische, das Außergewöhnliche, das Widerborstige weichen. In der Praxis bedeutet das, was es immer bedeutet: Kreative zurück ins Glied, gnadenloses Trimmen auf größtmögliches Publikum und – damit fast zwangsläufig einhergehend: Zurückdrängen von Inhalten, die irgendwie als »problematisch« oder »anstößig« angesehen werden. Fazit: Die Industrie übernimmt; ein von viel »Rock’n’Roll« und Aufbruchsstimmung gepräger Populärkultur-Abschnitt neigt sich – wieder mal – seinem Ende zu.
Voraussschau, oder: vom unausweichlichen Sieg des Mainstreams
Nicht immer muß das Glätten & Verharmlosen guter Stoffe und Themen so dramatisch, so unübersehbar ausfallen wie bei Orange Is the New Black. Die Wege hin zu substanzloser Stromlinienförmigkeit verlaufen in unterschiedliche Richtungen. Nashville beispielsweise, ein von einem Major-Network produzierte Serie, versprüht in der vierten (und vorerst letzten) Staffel zwar Harmonie bis hart an die Schmerzgrenze. Umgekehrt hat die Serie allerdings genügend dramaturgische Substanz aufgebaut, um von dieser eine Zeitlang zehren zu können. Zwischenzeitlich hat abc Nashville an CMT verkauft; was heißt: der kreative Exitus steht möglicherweise noch bevor. Andere Serien sind zwar handwerklich solide gemacht, plottechnisch allerdings vorhersehbar und letzten Endes uninnovativ. Beispiele: die Noir-Serien The Red Road, Banshee und Power. Lapidar formuliert: Es gibt Schlimmeres, aber man verpasst auch nichts. Abseits des Genres Thriller ist zunehmend der Trend erkennbar, auf den bewährten Handlungsmix aus Halbstark, High Society und Hightec zu setzen – hier sind die Independent-Inhalte der neuen Serien im Grunde nie angekommen. Der Erfolg von Games of Thrones schließlich hat seine eigene Plagiatsklasse auf den Plan gerufen. Beispiele: die beiden im (echten) Frühmittelalter angelegten Historienserien Viking und The Last Kingdom.
Letzten Endes könnte die Zukunft des Metiers ähnlich aussehen wie die Art Programmplanung, welche der Multimediakonzern amazon heute bereits praktiziert. Das Modell: Serien werden zunächst mittels eines Piloten beim Publikum getestet. Nur die, welche beim Publikum ankommen, gehen tatsächlich in Produktion. Einerseits klingt das fast ein bißchen nach Pulp Fiction, wo die Gangsterbraut immerhin eine Vergangenheit als Pilot-Darstellerin hat. Andererseits: Keine der bisherigen amazon-Produktionen ist auch nur in die Nähe dessen gerückt, was Serienjunkies als Qualitätsausweis erachten – etwa die Verleihung eines der branchenbegehrten Emmy Awards. Im Gegenteil: Die Video-Eigenproduktionen von amazon zeigen aktuell, wohin die Reise gehen könnte: Durchschnitts-Krimiware wie die Polizeithriller-Reihe Bosch, schwülstige Nazi-Schmonzetten à la The Man in the High Castle oder auf Action-plus-Slapstick zurechtgestutzte Noir-Umsetzungen wie die kürzlich auf den Markt gebrachte Serie Preacher.
Fazit: Neue, aufsehenerregende kreative Stoffe sind auf dem Qualitätsserien-Markt derzeit nicht in Sicht. Fans innovativer Serien werden sich mit dem, was die nächsten Jahre – dem letzten Recken HBO sei Dank – noch kommt, strecken müssen. Oder sich nach anderen Medienformen umsehen.
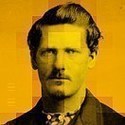




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.