Zelte, Papp- und Holzverschläge und auch ganz nackte Lagerplätze. Ob ich zur Arbeit will, zur Kita, zum Einkauf oder Sport: Im Alltag meines Berliner „Szeneviertels“ mit funky Image und irren Neuvermietungspreisen ist das Elend der Obdachlosigkeit mittlerweile allgegenwärtig. Über die Topografie zumindest der großen Städte unseres reichen Landes legt sich eine Slum-Schablone, allen Prinzipien zum Hohn, die unsere Gesellschaft angeblich begründen – ob Christentum, Aufklärung oder Sozialismus. Warum wird dieser Skandal seit Jahr und Tag hingenommen? Wo bleibt die Wut über all das Elend?
Nolens volens haben wir uns Strategien zurechtgelegt, die uns die Misere emotional vom Leibe halten. Eine erste bespielt das Reich der Berichte, Beauftragten und Agenden: Hat nicht die Bundesregierung 2021 die „Declaration on the European Platform on Combatting Homelessness“ unterzeichnet, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden? Hülfe denn Wut? Würde sie den „intensiven, Ressorts und föderale Ebenen übergreifenden Prozess“ beschleunigen, der laut Wohnungslosenbericht 2022 in einen „Nationalen Aktionsplan“ münden wird? Die Ohnmacht der Einzelnen, die in diesem Vokabular der Verfachlichung mitschwingt, wirkt auch erleichternd: Es ist, kann man sich sagen, kein einfach’ Ding, die Menschen von der Straße zu holen. Lassen wir die Profis ran, die sich ja kümmern.
Nun wissen wir aber irgendwo auch: Sicherlich werden bis 2030 keineswegs die 40.000 Menschen dauerhaft bedacht sein, die heute laut diesem Regierungsbericht auf der Straße leben – und auch nicht die 50.000 „verdeckt Obdachlosen“ sowie die 180.000, die „in der Wohnungsnothilfe untergebracht“ sind. Wahrscheinlicher sind allerlei Evaluations- und Folgereports zu jenem Wohnungslosenbericht, der ja der erste seiner Art war.
Die Not spitzt sich zu
Da also das Problem noch lange bestehen wird, trifft es sich quasi ganz gut, dass mit der Individualisierung des Elends eine zweite Entlastungsstrategie zur Hand ist – auch diesseits eines platten „selber schuld.“ Denn während zumindest jenes Regierungspapier – mit entsprechendem Entwarnungs-Spin via Leitmedien kommuniziert – das Problem zahlenmäßig um 20 Prozent geringer ansetzt als Selbsthilfeverbände, spitzt sich die Misere qualitativ zu: Aus der Straßenarbeit häufen sich die Berichte, dass unter den Betroffenen zunehmend Menschen mit augenscheinlich gravierenden, aber unbehandelten psychischen Erkrankungen seien. Steht also, fragt da ein Teil des entlastungshungrigen Mittelschicht-Selbst, nicht doch auch ein eher individualmedizinisches als sozialstrukturelles Problem im Kern des Elends, das mich so bedrängt? Müssten vielleicht psychiatrische Behandlungen niedrigschwelliger einsetzen und, horribile dictu, konsequenter betrieben werden – bevor Betroffene auf der Straße landen?
Reden wir da von Psychiatrisierung? Von Pathologisierung abweichenden Verhaltens? Der andere Teil des liberalen Großstadt-Selbst ist hellauf entsetzt von derlei Gedanken, die er als Stigmatisierung verwirft. Zuweilen denkt dieses Bewusstsein vielleicht sogar darüber nach, ob die unhinterfragte Gewohnheit, von „Obdachlosen“ zu reden, nicht schon ähnlich reduzierend und diskriminierend sei wie einst das Wort „Flüchtling“ für eine geflüchtete Person. Doch kann sich auch in dem humanistischen Motiv, Menschen ohne Obdach zuerst eben als Menschen zu begegnen, ein Entlastungswunsch verstecken. Wenn nämlich das Bemühen um einen „normalen“ Umgang mit denen im Elend in einen verqueren Lokalstolz umzuschlagen droht – „in unserem Viertel gibt es so viele Obdachlose, weil wir sie nicht diskriminieren“ –, normalisiert diese Haltung der Anerkennung ein Stück weit auch das Elend selbst. In meinem Kreuzberg ist diese Tendenz bisweilen zu verspüren.
Gewiss können wir Einzelnen weder die Menschen von der Straße holen noch ihr Dasein wirklich verbessern. Es ist auch in Ordnung, wenn uns dieses Elend zuweilen den Atem und die Sprache raubt. Nur eins dürfen wir uns nie selbst ausreden oder ausreden lassen: die bare Wut über die Verhältnisse, die bis heute Menschen auf die Straße setzen, wo es sich nicht leben lässt.
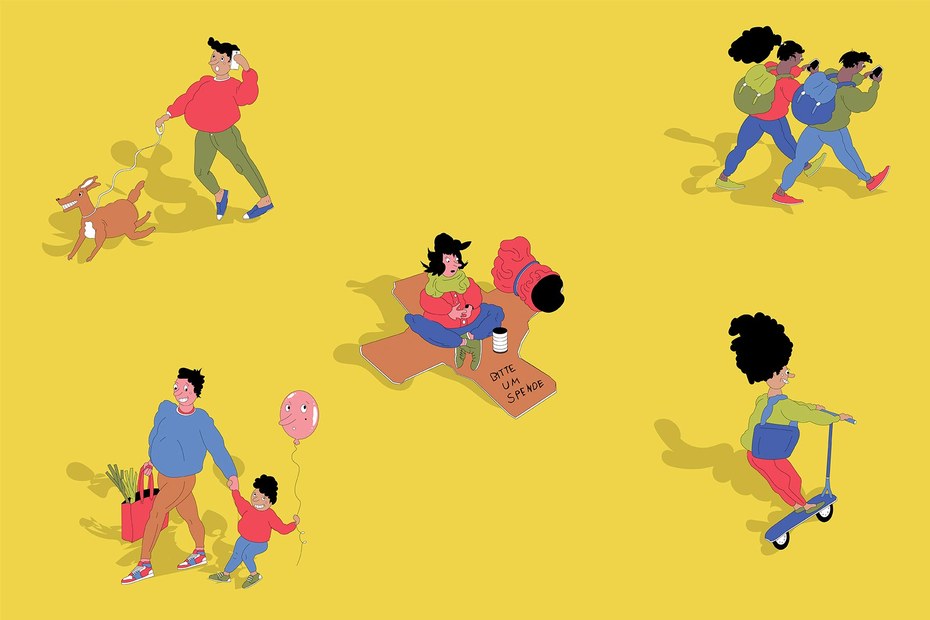






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.