Für die Rockmusik, speziell ihr progressives, unangepasstes Segment, waren die Mittsiebziger eine kritische Zeit. Der Sturm der Sechziger hatte sich gelegt. Ihre größten Helden waren den Heldentod an der Front der bewußtseinserweiternden Substanzen gestorben, und auch der Begründer des ganzen Aufritts, ein pilleneinschmeißendes Wrack, war längst nicht mehr der King früherer Tage. Es war die Zeit gigantisch großer Equipments, ein Job-El-Dorado für Tour-Roadies, eine Goldgrube für groß aufgezogene, meist kurzlebige Supergroups sowie die Organisatoren überteuerter Festivals und im Gestus schließlich ein Hohelied auf ehrliches, strebsam verfolgtes Handwerk. Die dazugehörigen Superbands trugen Namen wie Emerson, Lake & Palmer, Yes oder Pink Floyd. Angesagt waren eskapistische Dreams; der Rock’n’Roll schickte sich an, die heiligen Hallen der Kunst zu erobern. Sicher – ein paar Deserteure hatten diesem neuen Mainstream frühzeitig den Rücken gekehrt. Speziell die Glam- und Hardrocker wußten mit der neuen l'art pour l'art wenig anzufangen. Und auch in den USA nahm die Rockmusik eine Entwicklung, die zumindest in Teilen an den Spirit der Sixties-Counterculture anknüpfte – siehe etwa Crosby, Stills, Nash & Young oder auch die Aktivitäten von Meister Dylan. Insgesamt darf man jedoch ruhig fragen, wie es der Rockmusik ergangen wäre, hätten Yes, Mike Oldfield & Co. auf ganzer Linie gesiegt.
Dass es nicht dazu kam, ist das Verdienst einer heterogenen Koalition von Neuerer(inne)n. Der Begriff »Neuerer« ist insofern nicht ganz korrekt, als dass die »Neuen« eher den großen Rückgriff wagten auf die guten alten Roots – vorwiegend verortet im britischen Merseybeat der Anfangs- bis Mitsechziger sowie im Surf, Rockabilly, Blues und ähnlichen Gewächsen. Garage Rock ist eine mögliche Bezeichnung für diese Form Musik; Proto-Punk, Roots Rock oder auch Underground andere. Wie so oft zeigte sich das Neue auch in den Seventies als unbeobachtete, randständige Seitenspur im Alten. Rückblickend könnte Man Kick Out The Jams, ein Stück der Detroiter Agitrockband MC5, als Initialtitel dieser Richtung betrachten. Revolutionäre Pose, Sprüche und Big Money waren in jener Periode nicht weit voneinander entfernt. Beispiel: die Edgar Broughton Band – eine britische Band, die mit dem Anspruch der politpsychedelischen Totalzuständigkeit auftrat, sich kurz darauf jedoch in das Niemandsland des Prog-Rock verabschiedete und dort vermutlich verglüht ist. Metal – als große proletarische Sinnsuche zwischen Härte und Eskapismus – war in den von Ratlosigkeit geprägten Siebzigern ebenfalls mit angelegt. EINE Band allerdings begleitete die Entwicklung des Garage Rock wie ein Fels, ein Meilenstein: die New Yorker Formation Velvet Underground und ihr Frontman, Lou Reed.
War Reed, waren die drogenumflorten Eskapaden der Clique, die sich in Andy Warhols Factory zusammenfand, eine Rache der US-Ostküste an der Flowerpower-beseelten Westcoast? War es ein rüder Schubser, der die Blumenkinder auf die Realität verrotteter Metropolen hinwies? War es eine Absage an gesellschaftspolitisches Engagement – ein neuer Nihilismus, der sich eher die Weltsicht des abgehalfterten Junkies William S. Burroughs zu eigen machte als die Utopien der Beat-Poeten? Vermutlich von allem ein bißchen. Tatsache ist, dass das vielgerühmte Album mit der Banane überall da mit zum Soundtrack gehörte, wo die harten Drogen in die Flowerpower-Milieus einsickerten. Jedenfalls: Kaum ein Junkie jener Tage, der Reeds Beschreibung des beschissenen Gefühls, stündlich, täglich an der Straßenecke auf den Dealer zu warten (siehe Clip oben), nicht rauf und runter hörte. Noch deutlicher (falls das möglich ist) war Heroin – ein Song, den man als Lobpreisung der neuen Droge ebenso auffassen kann wie als Warnung vor einem Stoff, der dir am Ende alles nimmt. Die Band selbst offerierte auf ihrem 1967er-Erstling ein auch vom Gesamt-Oeuvre her Bestand habendes Kontrastprogramm zu Flowerpower & Co.: Run Run Run nimmt den Indierock der Neunziger vorweg. Auf All Tomorrow’s Parties sowie zwei weiteren Tracks reussiert gesanglich die Muse der Gruppe – ein deutsches Ex-Model mit dem Namen Nico. Nimmt man die Schlagzeugerin der Band, Maureen Tucker, hinzu, waren Velvet Underground nachgerade eine emanzipativ vorbildlich aufgestellte Band – ein Vorbild, dass sogar die Westcoast-Epigonen Jefferson Airplane mit ihrer durchaus expressionsbegabten Sängerin Grace Slick in den Schatten stellte.
Trotz – oder gerade wegen – der ergebnisoffenen Sinnsuche im Bermudadreieck von Kunstavantgarde, progressiver Rockmusik und New Yorker Boheme-Lifestyle gingen auch Velvet Underground den Weg einschlägig bekannter Bands. Die Platzhirsche – Keyboarder John Cale sowie Gitarrist/Sänger Lou Reed – verfolgten schon bald ihre jeweiligen Soloprojekte. Breitenpopulär rettete sich allerdings nur Reed in die Seventies rüber. Mit Walk On The Wild Side gelang ihm 1972 nicht nur ein Velvet-Underground-würdiger Klassikersong der Rockmusik. Auch textlich war das Stück nah an den Botschaften der alten Formation gebaut. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, spätere Veröffentlichungen in die Würdigung von Reeds Gesamtoeuvre mit einzubeziehen. Ein Ausnahmealbum (auch wenn der Spiegel da anderer Meinung sein mag) war etwa New York aus dem Jahr 1989. Das war bereits nach der Zeit, in der eine neue Generation die Palastrevolution der Garagerocker aufgegriffen und in einen neuen Stil – Punk – transferiert hatte. Doch selbst in den Zeiten von Post-Punk, New Wave und aufkeimendem Indierock zeigte Reed nach wie vor, was Songwriting-technisch eine echte New Yorker Harke ist. Romeo Had Juliette stellt die Shakespearsche Konstellation vom Kopf auf die Füße und macht ein Underdog-Pärchen zu den Protagonisten seiner zeitaktuellen Interpretation.
Anzumerken ist an der Stelle vielleicht, dass Reed, für Journalisten übrigens ein wahrer Alptraum, mit anderen Randständigen des Rock-Mainstreams durchaus gut konnte. Beispiel: ein Konzert 1997 zusammen mit Geburtstagskind David Bowie, in dessen Verlauf Reed und Bowie auch den New-York-Song Dirty Boulevard vortrugen (siehe Clip oben). Eher widerspruchsvoll behandelte Reed den musikalischen Nachwuchs – beispielsweise eine junge Frau aus dem Mittelwesten, die Ende der Sechziger im Big Apple ihre ersten musikalischen Schritte wagte. »Ich liebte es, zu tanzen, und zur Musik von Velvet Underground konnte man stundenlang tanzen«, so Patti Smith in einem Nachruf auf Lou Reed im US-Magazin New Yorker 2013. Allerdings: Reed habe sie oft als launisch, einschüchternd und belehrend erlebt. Auch habituell-musikalisch waren Lou Reed und Patti Smith zwei völlig unterschiedliche Gewichtsklassen. Während Reed sich auf das e-Gitarre-verstärkte Geschichtenerzählen verlegte, betrachtete die Lyrikerin, später auch Verfasserin beachtlicher Belletristik-Werke, Rockmusik als zeitgemäßes Vehikel für Poetry Slam. 1975 erschien Horses – Smiths erste LP und aus dem Stand bereits eine Offenbarung. Highlights auf dieser Platte lassen sich allenfalls subjektiv nennen. In meinen Augen ist es klar Gloria – ein alter Them-Song von anno 1964, der erst in der Fassung von Patti Smith zu seiner eigentlichen Bestimmung findet.
Für die Power, die Smith – gerade in ihrer Anfangszeit – auf der Bühne entfaltete, ist Gloria paradigmisch. Die Interpretation beginnt zurückgefahren wie ein aufgezogenes Uhrwerk, steigert sich von Minute zu Minute. Das Ende ist derart ekstatisch, dass Sängerin und Band eine volle Minute brauchen, die Energie und Verausgabung in einen geordneten Schluss zu überführen. Zur Ikone der Endsiebziger-Rockszene wurde Patti Smith mit einem anderen Song: Because the night – ein Auskoppler aus ihrer dritten LP, Easter von 1978. Easter enthält fast alle Stücke, die man heute gemeinhin mit Patti Smith assoziiert. Space Monkey etwa oder Rock N Roll N****r – ein von Tempo und Aufbau stark an Gloria angelehntes Stück, dass die gesellschaftliche Außenseiterrolle der »Generation No Future« auf den Punkt brachte. In ihrer klassischen Phase veröffentlichte Patti Smith vier Platten (und ich sage an der Stelle bewußt: Platten): Horses, Radio Ethiopia, Easter und schließlich Wave. Mit Frederick enthielt Wave eine Ballade, die auch die etwas sentimentaleren Stimmungen mit abdeckte. Ansonsten: In der linksalternativen Wohngemeinschaftsszene meiner Sturm-und-Drang-Zeiten hatte Patti Smith in jeder LP-Sammlung einen festen Vorzugsplatz (nochmals: in JEDER). Egal ob Sponti, Autonom, DKP oder Juso: Easter und Wave gehörten fast zwingend zum Inventar; Unentwegte legten sich – für die schweren Zeiten, die da noch kommen – gleich alle viere zu.
Die Rolle von Patti Smith als Türöffner(in) für Frauen im Musikbusiness ist oft hervorgehoben worden. Im Grunde kann sie gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Ohne Smith wäre eine Chrissie Hynde von den Pretenders ebenso schwer denkbar wie etwa Joan Jett, Johnette Napolitano (Concrete Blonde) oder Carolyne Mas. Auch die deutsche Rockröhre Nina Hagen hätte sich ohne die New Yorker Initialzündung wohl eher auf die Bretter kabarettistischer Kleinkunstbühnen zubewegt als auf den Weg zu E-Gitarre, lautem Gesang und plakativen Punkstücken. Smiths Affinität zu Bob Dylan und seinen Werk ist ebenfalls breit beschrieben worden. Vom Sujet her – respektive den Vorlieben für literarisch gefärbte Texte – liegt es auf der Hand. Mein Favorit hier ist Changing of the Guards – eine Smith-Neueinspielung aus dem Jahr 2007 von ihrem Coverversionen-Album Twelve. Sicher lässt sich kontrovers über die Frage rechten, ob das Engagement der großen Proto-Punk-Heroine zwischenzeitlich nicht etwas zu sehr Hang zum unangebachten Pathos aufweist – zu einer gutmenschlichen Attitüde, die den Zeiten vielleicht nicht mehr gerecht wird. Andererseits: Fehler findet man bei jedem. Patti Smith jedenfalls macht Ausrutscher – etwa die Annahme des Literaturnobelpreises an Statt ihres Freundes Bob Dylan, die man so oder so beurteilen kann – bis heute souverän wieder gut: im Zweifelsfall mit Auftritten, die kaum glauben lassen, dass zwischen Horses damals und heute über vierzig Jahre liegen.
Natürlich wurden Garagerock und Proto-Punk nicht von zwei Ausnahme-Musikern allein gestemmt. Ganz sicher zu erwähnen wäre Iggy Pop, ein Kumpel von Lou Reed und David Bowie und einer, der für Eskapaden mancherlei Art ebenso gut war wie für spektakuläre Liveauftritte. Da wir auch eine Pflicht gegenüber den nicht ganz so Berühmten haben, sei an der Stelle Willy deVille genannt. Biografisch war der 1950 in Connecticut geborene Gitarrist, Sänger und Songschreiber zwar ebenso ein New Yorker Gewächs wie Lou Reed sowie die aus dem Mittelwesten zugezogene Patti Smith. In Sachen Attitüde, Outfit und musikalische Präferenzen allerdings inszenierte sich Willy stetig als jemand, der die Gegenden nördlich der Mason-Dixon-Linie allenfalls vom Hörensagen kennt. Die Südstaatendandy-Attitüde war eines; ein anderes war die rauhe Stimme, die mit Swamp-Sound sowie Latinrock-Einflüssen aufgebrezelte Rockmusik und auf Konzerten eine Verausgabung, die unter Beweis stellten: der Mann lebt das, wovon er singt. Zumindest meines Wissens nach ist Willy deVille der einzige Rockmusiker, der die Fluppe nicht nur beim Gitarrespielen im Mund behält, sondern mit dieser im Mundwinkel auch zu singen vermag. Clip oben: die Nummer Spanish Stroll – ursprünglich eingespielt 1978 und hier dargeboten 1994 auf dem Montreux Jazz Festival. Ein weiterer deVille-Titel, fast ebenso bekannt, ist Cadillac Walk – textlich eine Nummer übrigens, bei der man sehr viel Kontextkenntnisse aufbringen muß, um in den Lyrics einen roten Faden zu erkennen.
Mit Willy DeVille sind wir bereits zurück im guten, alten Blues. Noch mehr »Old School« ist allerdings ein weiterer Hero, der beim Thema Garage Rock fast zwingend aufzuführen ist: Lemmy Kilmister und seine Formation Motörhead. Kilmisters Musik-Vita geht zurück bis in die Zeiten des britischen Merseybeat. Temporär bekannt wurde er als Bassist einer britischen Hardrockband mit dem Namen Hawkwind. Derem größten Hit, Silver Machine, verlieh er seine Stimme. Nachdem Hawkwind Kilmister gefeuert hatten, begründete dieser Motörhead. Seit Mitte der Siebziger sind Band und Sänger/Bassist eine Entität, bei der man nicht weiß, in welche Ecke man sie stellen soll. Viele sehen sie als Urgesteine, als Pioniere des Metal. Andere hielten sie – bis zum Tod Kilmisters 2015 und der anschließenden Auflösung der Band – für die letzten authentischen Übriggebliebenen des Hard Rock. Wieder andere sehen in ihr DAS wichtige Brückenglied zwischen Punk, Rock’n’Roll und Metal. Ich persönlich bin der Meinung, dass – egal wie man die Stilistik im einzelnen beurteilt – Lemmy und Motörhead eine Liga für sich sind: ein solitäres Ereignis der Sorte, von denen es in der Geschichte des Rock’n’Roll nicht allzu viele gibt. Remember, an der Stelle: Der liebe Gott sieht, was du tust: When The Sky Comes Looking For You, ein 2015, kurz vor Kilmisters Tod veröffentlichtes Video zu dem gleichnamigen Song.
Fazit: Über Musik lässt sich streiten, über die Ergebnisse nicht. Ende der Siebziger Jahre hatte in der Rockmusik ein unwiderruflich zu machender Generationswechsel stattgefunden. Nicht nur, dass die Revolutions von Punk und New Wave die komplette Szenerie durcheinandergewirbelt hatten. Auch im Mainstream-Rock spielten die neuen Epigonen eine völlig andere Musik als ihre Vorgänger zehn Jahre zuvor – nicht mehr Art Rock, Prog Rock, Psychedlic oder blueslastigen Hardrock, sondern schnelle, gitarrenlastige Musik, angereichert mit Reggae, Ska sowie anderen Stilen aus der Kolonial-Peripherie. Die neuen Bands – Police, Dire Straits, Pretenders, U2 – waren nur noch bedingt vergleichbar mit ihren Vorgängern. Ob handwerklich versiert wie bei Dire-Straits-Gitarrero Mark Knopfler oder punknäher wie bei Police oder Pretenders: Die Rockmusik wurde (wieder) publikumsnäher, tanzbarer und – last but not least – ein Stück politischer. Sicher kann man die Frage, ob Lou Reed und Patti Smith wesentliche Initialzündungen gegeben haben, so oder so beantworten. Meine Auffassung hier jedenfalls ist die, dass sich der Mainstream-Rock mit Punk und Wave schwerer getan hätte, hätte es die beiden nicht gegeben.
Die betrübliche Nachricht am Schluss: Aus den Reihen der in diesem Beitrag beschriebenen Haupt-Acts weilt lediglich Patti Smith noch unter den Lebenden. Lemmy Kilmister starb am 28. Dezember 2015. Willy deVille, der Meister des Swamp Blues, segnete 2009 das Zeitliche. Lou Reed starb 2013 in seinem Sommerhaus in den Hamptons. Patti Smith zumindest hat Reed seine oft überhebliche Art verziehen. Die Erinnerung an ihr letztes Zusammentreffen kurz vor Reeds Tod beschreibt sie in ihrem New-Yorker-Nachruf wie folgt: »Als Lou Goodbye sagte, schien in seinen dunklen Augen eine unendliche und gütige Traurigkeit zu liegen.«
Info
»Mashups« (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die Beitragreihe »mashupt« Themen, Künstler(innen) und Stile der Pop- und Rockmusik.
Staffel 1: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben | (6) Clash versus Cure | (7) Der »Club 27« | (8) Reggae-Time | (9) Venus, Glam & heiße Liebe | (10) Raves & Bytes
Staffel 2: (1) Die Hüter der Tradition
Die am 28. Dezember erscheinende Folge zum Jahresausklang widmet sich dem Schlager und seinem langen, steinigen Weg zum Pop. Held(inn)en: Gunter Gabriel und Juliane Werding.

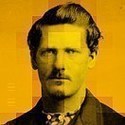




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.