Es ist gerade recht trostlos – und auch das Anschließen der Sommerfest-Lampionreihen an die nötigen Stromverteiler fiel im Sommer bereits weitgehend ins Corona. Nichtsdestotrotz müssen wir reden – über das Thema nämlich, um das es in dieser Folge geht. Frei nach dem Motto »Über Schlager redet man nicht – Schlager kennt man« scheiden sich speziell in Deutschland nach wie vor die Geister. Machen wir den Selbsttest anhand zweier Dokus zur popmusikgeschichtlichen Landeshistorie. Die erste, »Deutschland, deine Popmusik« aus der Reihe ZDF History, schlägt den Bogen über sämtliche Genres, die dies- und jenseits der Mauer seit 1945 en vogue waren. Man mag über den das-meiern-wir-jetzt-auch-noch-ab-Gestus des Formats meckern; die Grob-Zeitleiste triste Sixties – erster Deutschrock – neue Deutsche Welle bis hin zu Techno haben die ZDF-Fernsehhistoriker allerdings korrekt in trockene Tücher gebracht. Die zweite Doku hingegen – »Deutschland, deine Schlager« – führt unvermittelt rein in eine musikalische Parallelwelt. Will heißen: Interessant sind die dort getätigten Einblicke schon. Aber 24/7 die Chose hören? 2021 macht das wohl nur noch eine – stetig schwindende – Minderheit.
Schlager und kultureller Aufbruch der 60er: Bis heute sind das zwei verschiedene Paar Schuh’ – in gewisser Weise sogar diametral entgegengesetzte. Und doch hat sich dieses Verhältnis im Lauf der Jahrzehnte ein Stück weit geglättet. Rein praktisch, lebensweltlich hat sich etwas Drittes eingeschoben: der internationale, vorwiegend angelsächsisch geprägte Popmarkt und, mit ihm verbunden, Rock, Techno, Hip Hop. Schlagerhit-Crossovers wie etwa der hier von Schlager-Altikone Vicky Leandros mit Tekkno-Hallenbefüller Scooter sind mittlerweile Business-Normalfall. Klaro: Zumindest laut Adorno ist das Falsche noch immer das Falsche, aber – Hey, wer verspürt schon Lust, im Dickicht des Nahkampfs immer in den Büchern nachzuschlagen? Darüber hinaus tut man dem Metier insgesamt Unrecht. Es gab schon immer die andere Seite im Schlager: Nachdenkliches neben Schunkel-Seligkeit (Beispiel: Alexandra), Widerborstiges gegen Mainstream-Geglättetes (etwa: Lieb Vaterland von Udo Jürgens) und Anspruchsvolles neben allzu Einfachem (das frankophil angehauchte Beispiel von anno 1961: Britt Hagen mit Sag’ Adieu). In vielen Fällen gehen die Brüche direkt durch die Seele der Person. Etwa bei Schlagerparty-Shooter Jürgen Drews, der – wie dieser Kleinauftritt beweist – durchaus gerne in die Fußstapfen der Rolling Stones getreten wäre.
Reden wir über Schlager. Weil eine Mashup-Folge dafür bei weitem nicht ausreicht, beschränken wir uns auf zwei Charakterköpfe: Gunter Gabriel und Juliane Werding. Als zeitweiliges Kreativ-Team waren sie nicht unmaßgeblich beteiligt an der Transformation des Metiers – von einer recht zugeknöpften, Heile-Welt-Spießigkeit zelebrierenden Staatsuntertanen-Grundversorgung in den Sechzigern zu einer vergleichsweise aufgefächerten Szenerie zehn Jahre später. Gunter Gabriel reussierte als Country-Rocker mit glaubhaften Proleten-Appeal sowie Johnny-Cash-Attitüde. Die zu den ersten Wirtschaftswunderkrisen passende Klartext-Ansage 1974 klang lapidar so: Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld. Juliane Werding hingegen war eher für die soften Aspekte des Zeitgeists zuständig. Ihrem großen 1972er-Hit Am Tag, als Conny Kramer starb folgten Cover-Einspielungen ähnlicher Machart – nah genug gebaut am Spirit der Love-and-Peace-Kultur, gleichzeitig jedoch Mainstream-kompatibel genug, um in Dieter-Thomas Hecks Hitparade zum Stammgast zu avancieren. Beide – Gabriel wie Werding – lieferten im Lauf der Folgejahrzehnte ein ungewöhnlich vielfältiges, diverses Oeuvre ab. Zwei Schlüsselsongs, zwei Modelle, zwei Biografien: Schauen wir uns an, wohin sie führten und was sie bewegt haben.
Gunter Gabriel
Als Gunter Gabriel mit dem Trucker-Song Er ist ein Kerl (der 30 Tonner Diesel) 1973 in der ZDF-Hitparade reussierte, hatte er bereits einschlägige Naherfahrung mit den businesseigenen Höhen und Untiefen. Die Höhen waren solide: Sein Ruf als Songschreiber hatte sich in der Branche durchaus herumgesprochen. Die Untiefen waren der Preis, den der aus einer kaputten Familie entstammende Schulabbrecher eben hinnehmen musste: prekäre Jobs als Schlager-DJ, Plattenlabel-Promoter sowie andere Türöffner-Jobs. Gunter Gabriel war allerdings gekommen, um zu bleiben. Zum programmatischen Monument geriet vor allem sein 1974er-Hit: Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld. Auf den ersten Blick klang das so klassenkämpferisch, wie der ganze Typ rüberkam – informell von der Lederweste hinab zu den Cowboystiefeln, dazu stets einen zweideutigen Joke oder auch mal eine Klartextansage auf den Lippen. Wie schwer sich das Schlager-Establishment mit einem wie Gabriel tat, zeigt die Anmoderation unten in der ZDF-Hitparade. Dass ihm nicht gerade der rote Schlagerteppich ausgerollt wurde, hinterließ rückblickend einiges an Verbitterung – oder, wohlwollend formuliert, Desillusionierung. Nach den Steinen im Weg folgten die Versuche, den widerborstigen Proll wenigstens zu vereinnahmen, zu glätten. Gabriel 2003 im Tagesspiegel: »Mein Produzent sagte: Mach’ doch wieder so was Kuscheliges wie ›Komm unter meine Decke‹. Aber bleib mir mit Deinen Scheißarbeitslosenliedern weg.«
Gabriel zog den Schuh’ mit seinen »Arbeitslosenliedern« weiter durch. Inhaltlich jedoch waren seine Songs meist das Gegenteil davon. Ging es mal nicht um die kleinen Freuden des Lebens, wurde die Arbeit nachgerade vergöttert – mitunter bis zum schweißtreibenden Exitus wie in dem Song Intercity Linie Nr. 4. Hier werden die Schwellen in der angesetzten Frist verlegt – koste es, was es wolle. (Disclaimer: inklusive dem im Song beschriebenen Kollateralschaden, dass beim Bau der Strecke, die ein Bonze am Ende einweiht, tatsächlich einer draufgeht.) Den Appell ans 250-prozentige sozialdemokratische Arbeitsethos wiederum nahmen ihm die Linken übel. Noch übler auf stießen dort Gabriels regelmäßige Bezugnahmen auf die Nation, das Volk und so weiter – eine Aversion gegenüber dem Schlager-Außenseiter, die sich anlässlich eines schlechtlaunigen Arbeitslosenbashings von der Bühne herab zu einer regelrechten Anti-Gabriel-Haltung verfestigte. Der aus der linken Hip-Hop-Szene kommende Produzent und Musiker DJ Koze samplete Gabriels Ausfälligkeiten in einer Nummer, über deren musikalisch-erkenntniswertigen Gehalt man in der Tat stark unterschiedlicher Meinung sein kann.
Gabriel selbst indes war zu jener Zeit quasi von den Toten wiederauferstanden – und zuvor erst einmal richtig abgestürzt. Schuld daran war die übliche Mischung: Alkohol, Drogen, Spielsucht, Frauen, häusliche Gewalt, Immobilienzockerei und schließlich zu viel Schulden. Genauer: viel zu viel Schulden. Nicht wenige im Showbiz geraten in einen derartigen – durch unstetiges Geld, unstetige Arbeitsbedingungen sowie die psychologische Komponente des Ruhms verursachten – Strudel hinein. Die Hartgesottetsten greifen – vor der letzten Stufe, dem finalen Vergessen-Werden – zum letzten Strohhalm: dem Gig im Dschungelcamp. Auch Gabriel hat ihn absolviert. Dauerhaft aus der Flaute herausgerissen haben ihn nach eigenen Angaben jedoch seine Wohnzimmerkonzerte quer durch die Republik. Konkret: für tausend Euro war Gunter Gabriel für einen Abend buchbar.
Ein Sänger zum Anfassen, der sich für nichts zu schade war: Das brachte ihm Achtung und Respekt. Anerkennung in den heiligen Hallen der Kunst war das noch nicht. 2009 holte Gunter Gabriel auch die nach. Sein Album Ein Sohn aus dem Volk. German Recordings enthielt Songs von einer derartigen persönlichen Wucht und Tiefe, dass sich die Diskussion um künstlerische Wertigkeiten erledigt hatte. Das Album ist voll von guten Stücken; paradigmisch der Song Mein Weg – eine Lebensbeschreibung des gereiften Gabriel, nach der es im Grunde genommen nichts mehr zu sagen gab. Mit den German Recordings war Gabriel wieder drin – quasi als ein böser, nichtsdestotrotz jedoch gesellschaftlich anerkannter Vetter von Udo Lindenberg. Die restlichen Stationen: Gunter Gabriel spielte sein großes Vorbild Johnny Cash in einem Musical, mischte sich hier und dort ein – unter anderem für den Erhalt des Bürgerparks Flughafen Tempelhof (Clipvariante: hier; Small-Combo-Version: hier). 2017 verstarb er – womit sich zumindest eine Frage via Sensemann erledigt hatte: Deutschlands ein und einziger Country-Star weilt nicht mehr unter den Lebenden.
Juliane Werding
Ebenso wie Gunter Gabriel war auch die 14 Jahre jüngere Nachwuchssängerin Juliane Werding überdurchschnittlich stark auf Cover-Intepretationen festgelegt. Ihr Opener im Schlager-Biz war die Joan-Baez-Vorlage The Night They Drove Old Dixie Down. Der Song stammte ursprünglich von Robbie Robertson, einem Mitglied von Bob Dylans Begeleitcombo The Band, die 1969 auch die Erstversion einspielten. Baez machte das stimmungsvolle, im Country-Duktus gehaltene Antikriegslied zum Welthit. Die aus Essen stammende Schlager-Debütantin adaptierte die Vorlage – Grundstein ihres langanhaltenden Erfolgs – auf deutsche Drogenverhältnisse. Textlich kann man Am Tag, als Conny Kramer starb auf zwei Weisen interpretieren: zum einen, dass sowas zu sowas führt (im konkreten Fall: ein harmloser Joint geradewegs hinein ins schlimmste Heroin-Elend), zum anderen als Appell zu mehr Verständnis und Empathie. Im wesentlichen wurde Conny Kramer wohl auf die zweite Weise verstanden. Zwar nahmen Texter und Interpretin den Drogenepedemie-besorgten Teil des Publikums durchaus mit. Die Hauptbeschreibung konzentrierte sich allerdings auf die Drogenkarriere jenes omminösen Conny Kramer, dem keiner hilft und der an seiner Sucht schließlich zugrunde geht.
Summa summarum liegt man nicht ganz falsch, wenn man die 1972 veröffentlichte Conny-Kramer-Eloge als nicht unwesentliches Indiz nimmt in Sachen Umschwenker zu einer humaneren Drogenpolitik. Im Verlauf der Siebziger nahm nicht nur die Politik zunehmend Abstand vom Modell nackter, unvermittelter Repression. Parallel, wenngleich auch allmählich, wandelte sich auch die Haltung breiter Bevölkerungsschichten. Finaler Ausdruck dieser veränderten Betrachtungsweise waren der Erfolg des Buchs Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F. sowie der gleichnamige Film aus dem Jahr 1981. Gründeln darüber, inwieweit Heroes von David Bowie, der bekannteste Song aus dem Film, ebenfalls mit zur Popularisierung des Themas beitrug, würde an der Stelle zu weit führen. Fakt ist, dass Juliane Werding mit Conny Kramer einen Karriere-Grundstein von echtem Schrot und Korn vermauert hatte. Erst einmal lieferte die privat durchaus rockaffine Sängerin (Vorlieben: Jimi Hendrix und Deep Purple) Cover-Versionen einiger international bekannter Popsongs wie beispielsweise Lady in Black von Uriah Heep oder My Sweet Lord von George Harrison. Doch auch Liedgut aus deutschen Landen verschmähte sie keinesfalls. Beispiel: Wenn du denkst, du denkst von Komponist Gunter Gabriel.
Trotz anhaltenden Erfolgs war absehbar, dass das Konzept teils in Sichtweite zur Country Music gebauter, teils am angelsächsischen Pop-Mainstream orientierter Songs nicht ewig weitertragen würde. Behutsam, quasi Album für Album erfand sich Werding im Lauf der Neunzigerjahre neu – hin zu einer erwachseneren, Popmusik-affineren Form von Schlager. Rockige Untertöne waren bei Werding zwar stets präsent. Der neue Sound mit seinem Mix aus Synthie-Pop und Dire-Straits-ähnlichen Gitarrenriffs war allerdings aus einem Stoff, mit dem sich auch Rockenthusiasten anfreunden konnten. Textlich kaprizierte sich Werding zunehmend auf den Sinn des Lebens sowie ähnliche Fragen zeitüberdauernder Wichtigkeit. Zusammen kam mit der Zeit ein beachtliches Oeuvre unterschiedlicher Titel: Bist du da für mich etwa als bange Frage, was die Zukunft bringen mag, Zeit der Banden als vielschichtig verstehbarer Weckruf in Sachen zu viel Machismo, Ans Meer zurück als musikalisches Storytelling in Sachen letzte Wünsche vor dem Tod oder der desillusionierte Noch-einmal-von-vorn-anfangen-Song Es gibt kein Zurück.
Bühnenbestimmend – und auch auf Platte – blieb Conny Kramer, mit Techno-Elementen aufgefrischt in einer 2000er-Version, der Ankerpunkt in ihrem Oeuvre. Der Rest: feministisch angehauchte Gesellschaftskritik (Mitarbeit am Theaterstück Vagina-Monologe) und schließlich, als Einstieg in die Zehner-Jahre, der Abschied von der Bühne. Nichts Dramatisches; vermutlich eher die Clausewitz-Lösung nach dem Motto: Man soll gehen, so lange man es noch gut kann. Der Rest: ein solider Zweitberuf, der zum Erstberuf wurde (Heilpraktikerin) – manchmal können Popgeschichten auch richtig unspektakulär zu Ende gehen.
Die Transformation des Schlagers
Klar gehört ein persönlicher Disclaimer in einen Beitrag wie diesen mit rein. So sei es auch. Biografisch habe ich den deutschen Schlager erst mangels anderer Wahl, später dann mit gebotenem Sicherheitsabstand verfolgt. Klaro – punktuelle Fraternisierungen waren immer drin. Die beiden Epigon(inn)en dieses Beitrags indes waren bei mir ab Mitte der Siebziger weit vom Schirm. (Wieder-)Annäherungen erfolgten in eher behutsamer Form. Essentiell hinzu kam im Lauf der Jahre die große Chanteuse Hildegard Knef. Etwas verblüfft hat mich das Statement eines alten Freundes, mit dem ich mich über den »Conny-Kramer«-Hype Anfang der Siebziger unterhielt. Der Song, so seine Aussage, sei auch in seiner dörflichen Motorradclique rauf und runter gelaufen. Für einen Indierock-Enthusiasten wie mich firmierte Conny Kramer bis Ende der Neunziger unter »fernere Musikgeschichte«. Dann stieß ich – zuviel verbrachte Zeit in Plattenläden mögen der Anstoss gewesen sein – auf die neue, zeitaktuelle Werding. Und war begeistert. Die neue musikalische Begeisterung half mir nicht nur über eine etwas komplizierte Lebensphase hinweg. Auch in allgemeinen Sinnfragen avancierte Juliane Werding einige Jahre lang zu einer Art obersten Kompetenz. Zuviel Sentiment, Sentimentalität gar? Zum Teufel – Why Not?
Einer meiner Lieblingssongs ist übrigens ein Stück aus den Siebzigern: Drei Jahre lang. Es ist nicht von Gabriel, hat allerdings den Vorteil, dass es durchaus von ihm stammen könnte. Textlich geht es um die Freundin eines JVA-Insassen, der drei Jahre abzusitzen hat, um die Schwierigkeiten, die Treue zu halten und um Kontakt, der nur durch Briefe aufrechterhalten werden kann. Sicher lässt sich die Song-Konstruktion als Schwulst abklassifizieren, als musikalische Untermalung von Selbstmitleid in jedweder Form. Bezieht man allerdings den Gedankengang mir ein, dass Schlager nicht die großen Welterklärer sind (und das auch nicht sein wollen), wird in meinen Augen durchaus ein Schuh daraus. Letztlich geht es darum, über die Tage zu kommen – allein, wenn es gut läuft, vielleicht mit einem Partner. Gunter Gabriel wiederum hat mich 2009 ins Grübeln gebracht – zumindest über meine musikalischen Koordinaten und das, was wirklich gute Musik ausmacht. Für einige vielleicht eine schmerzhafte Einsicht: Auch Künstler(innen), von denen uns politisch / mental / sonstwie Welten trennen, können Hammer-Werke abliefern.
Ansonsten hat Gunter Gabriel seine letzten Jahre massig genutzt für Interviews sowie die weitere Kultivierung seiner Wohnzimmerformate. Was blieb bis zur letzten Stunde waren Klartextansagen. Man mag mit vielem nicht konform gehen. Fakt ist, dass Gabriel mit seiner Biografie gezeigt hat, dass man nicht um jeden Preis mit den Regeln spielen muss (sprich: sich ihnen unterwerfen), um am Ende zu gewinnen. Ob im Guten oder im Schlechten: Am Ende hat er es doch noch in die Cash-Liga geschafft. Unter anderem auch mit einer bemerkenswerten Adaption des Cash-Stücks A Boy Named Sue (Ein Junge namens Susie). Juliane Werding hat – ähnlich übrigens wie die in der Beziehung stark vergleichsfähige Marianne Rosenberg – an der Veredelungsfront des deutschen Schlagers ebenfalls ihre Verdienste erworben. Bemerkenswert erscheint mir hier vor allem der Umstand der von langer Hand eingefädelten Absetzbewegung – hin zu einer Form deutscher Popmusik, die ernsthafter ist und vor allem stärker zugeschnitten auf die interpretierende Person auf der Bühne.
Unter den genannten Aspekten haben beide den Schlager ehrlicher gemacht – Gabriel und Werding. Eine Leistung, die die Welt zumindest ein kleines Stück angenehmer und aushaltbarer gemacht hat.
Info
»Mashups« (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die Beitragreihe »mashupt« Themen, Künstler(innen) und Stile der Pop- und Rockmusik.
Staffel 1: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben | (6) Clash versus Cure | (7) Der »Club 27« | (8) Reggae-Time | (9) Venus, Glam & heiße Liebe | (10) Raves & Bytes
Staffel 2: (1) Die Hüter der Tradition | (2) Die Weitergabe der Staffel
In der nächsten Folge geht es hinaus in die große weite Welt. Thema: Popmusik und World Beats im Global Village.

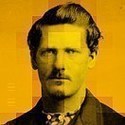




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.